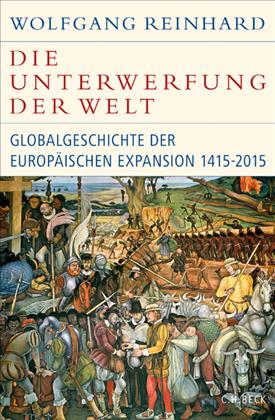Depressiv durchs Dasein dümpeln
Michael Kumpfmüller schreibt in „Tage mit Ora“ über die Reise eines Paares an der West Coast entlang
Von Anne Amend-Söchting
„I spent a week drinking the sunlight of Winnetka, California“ – so lautet das Inzipit des Songs June on the West Coast, den Conor Oberst, Gründer der Band Bright Eyes und meist ihr einziger Musizierender, singt. Auf einen ähnlichen Minimalismus wie das Lied, Gitarre und Stimme, reduziert sich die Planung der Reise in die USA, die Ora, Anfang 40, und der zehn Jahre ältere, namenlos bleibende Ich-Erzähler unternehmen. Mit ihren Gedanken hängen beide noch an früheren Partnern fest. Als sie sich zum ersten Mal begegnen, ausgerechnet auf einer Hochzeitsparty, interessieren sich die beiden Beziehungsgeschädigten sofort füreinander und beschließen wenig später, miteinander zu verreisen.
Im Juni 2016, mitten im Wahlkampf Hillary Clinton gegen Donald Trump, landet das Pseudo-Liebespaar in Seattle. Mit einem Fiat 500 machen sich die beiden auf den Weg nach Olympia. Von dort aus gelangen sie nach Heceta Beach, anschließend nach Eureka, wo sie sich betrinken und zum ersten Mal miteinander schlafen. Auf dem Weg über Bodega Bay nach Los Angeles treffen sie Evelyn und Dave, die einzigen Personen, mit denen sie auf ihrer Reise ins Gespräch kommen. Nachdem sie bei Evelyn übernachtet haben, sind sie in Winnetka wieder allein unterwegs. In San Diego, der darauffolgenden Station, gehen sie tanzen, entwickeln „ein neues Möglichkeitsgefühl“ und legen dort, wie es im Roman heißt, „weitere Hüllen ab“. Nun meinen sie, dass sie sich besser kennengelernt hätten und fangen an, „einander zu ertragen“. Dennoch beklagt der Erzähler „Oras Flüchtigkeit“, damit ebenso das Provisorische einer Beziehung, die sich vorwiegend in der weltfernen und „klimatisierten Kapsel“ eines Leihwagens abzuspielen scheint. Auf den letzten Strecken reisen die beiden Touristen durch Wüstengelände, dessen Schönheit sie in ehrfürchtiges Staunen versetzt. Wieder in Los Angeles angekommen, fliegen sie nach Deutschland zurück.
Mit dem geringen Maß an Planung kontrastieren die genauen Entfernungs- und Zeitangaben für die einzelnen Etappen. Diese Exaktheit gibt von außen den Takt für die innerlich halt- und schutzlosen Protagonisten vor. Es fällt ihnen schwer, sich aufeinander einzulassen, denn sie sind nicht nur in ihre alten Partnerschaften verstrickt, sondern haben vor allem mit sich selbst und der Komplexität ihrer seelischen Pathologie zu tun. Der Ich-Erzähler, freiberuflicher Autor, rühmt seine Seele, die er in einer „kompletten Gestalt- und einer Verhaltenstherapie“, des Weiteren in einigen Kriseninterventionen und einer abgebrochenen Analyse bis zur Perfektion geschliffen habe. Die „sechsundzwanzig größten Katastrophen“ seines Lebens bearbeite er aktuell mit einer Therapeutin, der Ora überhaupt nicht gefalle. Im Vergleich zum Erzähler, dessen angeblich vollendete Seele immer wieder einmal in Phasen depressiver Indifferenz gerät, sitzt Ora ihr „Biest“ im Nacken, ihre Panikstörung, wegen der sie mehrere Wochen in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung verbringen musste. Ein Bindeglied zwischen den beiden Menschen und ihrer psychischen Fragilität ist dasselbe Tablettenlabel, Citalopram, das von einem Beipackzettel umgeben sei, der das „halbe Feuilleton der FAZ“ hätte „füllen können“. In solchen Passagen, von denen man sich mehr hätte wünschen dürfen, blickt der Erzähler mit offensichtlicher ironischer Distanz auf sich selbst und seine Begleiterin.
Ora – nomen est omen – gesteht, dass sie bete, jedoch nur in Kirchen. Genauso gilt für sie der zweite Teil der benediktinischen Regel, „labora“, denn nur die Arbeit habe sie in den Wochen nach ihrem Psychiatrie-Aufenthalt gerettet. Oras Gegenüber bekennt, dass er seine eigenen Götter habe, Woody Allen und seine „shakespeareschen Götter“, die „unberechenbar“ seien und ihm Ora geschickt hätten. Für den Erzähler ist Ora darüber hinaus ein „Lab Ora“, ein Experiment, unter einigen anderen vermutlich, das sein Neurotikertum auflockert. Die Aufforderung „Ora et labora“, treffend für beide Protagonisten, muss ergänzt werden um die Dimension des Schweigens, das die beiden gegen Ende ihres USA-Aufenthalts nachdrücklich zelebrieren, es gar als „Ertrag“ der Reise apostrophieren. Es sei angenehm zu schweigen, wenn man den „Urgrund des Schweigens“, die Verzweiflung, nicht wahrnehme. „Das meiste“, so bilanziert der Ich-Erzähler, „hatten Ora und ich uns ohne Worte mitgeteilt, durch Schweigen, die Lücken im Text, der ja dauernd fortgeschrieben wird und letztlich wenig bedeutet, ungefähr so wenig wie bei einer therapeutischen Sitzung“. „Beredtes Schweigen“ oder „schweigsame Beredsamkeit“ – im hier insinuierten Oxymoron konzentriert sich nicht nur die Beziehung des Erzählers zu Ora, sondern sie impliziert ebenso die Absage an die psychotherapeutische Redekur im Freudschen Sinne. All dies wiederum prägt die Beziehung des Erzählers zu seinen impliziten Lesern, die er gerne einmal direkt anspricht, sich daneben aber ebenso im Setzen von Leerstellen gefällt. Einerseits sind die beiden Protagonisten mit psychologischer Raffinesse gezeichnet, andererseits bleiben viele Hintergründe opak, lassen sich nur erahnen. Aus dem Schweigen heraus entfalten sich Ora und der Erzähler als isolierte Entitäten, die sich bemühen, aufeinander zuzugehen, letztendlich aber daran scheitern, dass sie zu sehr in sich selbst gekehrt sind und aneinander abprallen werden. In Winnetka verstehe man „the weight of human hearts“, so singt Conor Oberst. Es dürfte kein Zufall sein, dass Winnetka nicht am Anfang (so wie im Song) der Reise steht, sondern als mittlere Etappe positioniert ist. Bevor sie in intensiveres Schweigen einkehren, haben sich die Protagonisten nicht nur einen „neuen Zustand ervögelt“, sondern ebenso eine Ahnung von der Gewichtigkeit ihres solipsistischen Seelenlebens erlangt.
Auf der Metaebene der Text-Leser-Beziehung manifestiert sich das beredte Schweigen des Weiteren, sieht man von den namentlich erwähnten Autoritäten Woody Allen und William Shakespeare ab, in einem offenen Input von Intertexten. Wollte man ihn methodisch fassen, dann läge er zwar jenseits der von Julia Kristeva proklamierten Vernetzung eines Textes mit allen vorgängigen Texten, würde aber, so wie bei Ora und dem Erzähler, „ein neues Möglichkeitsgefühl“ hervorrufen, eine Leichtigkeit der Lektüre oder gar die transtextuelle Inszenierung einer Komödie im Akt des Lesens selbst, wo doch in der geschilderten Paarbeziehung Humorvolles und Ironisches wohldosiert bleibt. So wie der Erzähler erlebt, so zeigt er sich auch im narrativen Akt, nicht unbedingt gänzlich gleichgültig, aber merkwürdig unengagiert. So wie Woody Allens Stadtneurotiker ist ihm in seinem Leben immer wieder einiges widerfahren, was sich seiner Kontrolle entzieht. Womöglich wähnt er sich gar in den Wirrungen des Shakespeareschen „Mittsommernachtstraums“, ebenfalls direkte Bezugsgröße im Roman. Die meisten Intertexte sammeln sich indessen im Topos der Reise, unterstreichen das stereotype Diktum „Der Weg ist das Ziel“. Auf dem Flug zurück nach Deutschland grinsen Ora und ihr Begleiter „müde, wie ein Verbrecherpärchen auf der Flucht“. Diese Anspielung auf Bonnie und Clyde ist gerahmt vom Architext der Road Novel und ihren vielgestaltigen Ausprägungen – angefangen bei Jack Kerouacs On the Road bis hin zu Wolfgang Herrndorfs Tschick oder Jonas Jonassons Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Alle „Road-Protagonisten“ befinden sich auf die eine oder andere Weise auf der Flucht, treiben fort in einem Gehäuse vermeintlicher Zeitlosigkeit, in dem sie die Zeit ihres „alten, bescheuerten Lebens“ (O-Ton Ich-Erzähler) dennoch unbarmherzig unter Druck setzt.
Trotz der vielschichtigen Hintergründe ist Tage mit Ora ein Buch der leisen Töne. Streckenweise wirkt es so lakonisch, dass es durch die Lakonie schon wieder Eloquenz erlangt. Vieles wird registriert, kaum vertieft, so dass beim Lesen selbst der Eindruck eines Hindurchreisens entsteht. Die beiden Hauptfiguren halten sich mit tiefersinnigeren Selbstoffenbarungen bedeckt. Sie präsentieren ihre Vulnerabilität als leidlich beschädigte, wohlhabende Stadtneurotiker, die Gefahr laufen, in ihrem Alltagstrott weniger einem „Burn“ als vielmehr einem „Bore out“ zu erliegen. „Wir beide waren Zitterkinder“, so konstatiert der Erzähler, und fährt fort: „Wir nahmen Tabletten, und wir machten zusammen diese Reise, was ja hieß, dass alles Etappe war, ein lustvolles Stochern im Nebel und, wenn es gut ging, ein großer Spaß“.Letzteren mag der ein oder andere auch beim Lesen erleben, viele andere jedoch werden das Buch, nachdem sie die Route mit dem Paar durchlaufen haben, gerne zur Seite legen.
|
||