
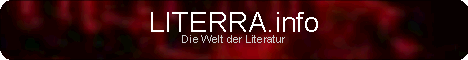
|
|
Startseite > Bücher > Crime > Dryas > Sophie Oliver > GENTLEMEN CLUB 1: DIE GENTLEMEN VOM SEBASTIAN CLUB > Leseproben > Leseprobe 1 |
Leseprobe 1
| GENTLEMEN CLUB 1: DIE GENTLEMEN VOM SEBASTIAN CLUB
Sophie Oliver Taschenbuch, 280 Seiten Mar. 2918, 12.00 EUR |
England, Sommer 1895
THEODORE
Während tagsüber in London die Sommerschwü- le den Smog bis in die kleinste Gasse drückte und die Luft stinken ließ wie einen stehenden Furz, der nicht verfliegen wollte, war davon auf dem Land wenig zu spüren. Zumindest nachts, sobald es auffrischte. Dafür drangen dann aus den Wäldern die lang gezogenen Rufe der Füchse wie heisere Schreie oder klagendes Kreischen, immer
einsilbig und durchdringend. Allein schon deswegen vermisste er das Landleben nicht. Die Geräusche der Stadt waren weit weniger enervierend und stammten zumeist von Menschen, nicht von Ge- tier. Während ein weiterer Fuchsschrei in der Ferne verhallte, atmete der Mann in Schwarz tief durch und ging zurück ins Haus. Genug frische Luft geschnappt, eine Aufgabe erwartete ihn.
Mit einer ruckartigen Bewegung zog er dem gefesselten Mann auf dem Stuhl den Leinenbeutel vom Kopf. Benommen blinzelte der eine Weile. Augenscheinlich hatte er Mühe, in der schummri- gen, nur von einer einzelnen Kerze erhellten Umgebung etwas zu erkennen. Kurz fragte sich der Mann in Schwarz, ob der Schlag auf den Kopf vielleicht ein wenig zu viel des Guten für sein Gegenüber gewesen sein mochte. Immerhin erhoffte er sich noch Informationen von ihm. Aber aus Transportgründen hatte er ihn vorübergehend außer Gefecht setzen müssen. Der Gefangene war zwar schmächtig, zudem schon etwas in die Jahre gekommen, trotzdem wusste man nie, was die Verzweiflung einem für Kräfte verleihen konnte. Und bei allem, was der Mann tat, stand Risikovermeidung an obers- ter Stelle. So war er schon immer gewesen. Er analysierte seine Feinde, lernte alles über seine Gegner und ging beherrscht gegen sie vor.
»Wer sind Sie? Wo bin ich? Was wollen Sie von mir?«
Als die erste Salve der obligatorischen Fragen abgeschossen wurde, war der Mann in Schwarz beruhigt. Das Gehirn des Gefan- genen schien zu funktionieren.
Er stellte sich so nah an die Kerze, dass das Licht auf seine Ge- stalt fiel. Wie erwartet, sorgte dies für schreckgeweitete Augen und Zerren an den Fesseln.
»Warum tragen Sie eine Teufelsmaske? Was haben Sie mit mir vor?« Die Stimme des Mannes klang panisch.
»Ich trage die Maske selbstverständlich, damit du mein Gesicht nicht siehst«, erklärte der Mann in Schwarz geduldig. Gerne hätte er hinzugefügt, dass er nicht einfach irgendein Exemplar ausge- wählt hatte, sondern eines, das möglichst wenig Furcht einflößend wirkte: eine Halbmaske aus bedrucktem Papier, die sein Gesicht bis zur Oberlippe bedeckte und Mephisto mit roter Kappe, darun- ter hervorlugendem Rabenschnabel-Haaransatz und den beiden obligatorischen Hörnern auf dem Kopf darstellte. Vollkommen harmlos.
»Was mit dir geschieht, bestimmst du allein. Ich werde dir eine Frage stellen, deren Beantwortung über den weiteren Verlauf deines Aufenthalts hier entscheiden wird. Du hast es in der Hand.«
»Wo sind wir? Wie bin ich hierhergekommen?«
»Einigen wir uns darauf, dass ich frage und du antwortest.« Noch immer klang der Mann beruhigend. Leider übertrug sich dies nicht auf den Gefesselten. Der brüllte nach Hilfe, und zwar so laut, dass seine Stimme grell von den Wänden des Raums wider- hallte und in den Ohren schmerzte. Unweigerlich drängte sich dem Mann in Schwarz der Vergleich mit den bellenden Füchsen auf, was an seinen Nerven zerrte. Mit einer behandschuhten Hand schlug er seinem Gegenüber hart ins Gesicht. Endlich herrschte wieder Ruhe.
»Theodore Hobbs«, fragte er ihn dann, »wo ist Kassiopeias Herz?«
Aus der Nase des Mannes floss ein kleines rotes Rinnsal in Richtung seiner Oberlippe. Mit schreckgeweiteten Augen starrte er Mephisto an. »Was?«
»Du hast mich schon richtig verstanden.«
»Irrtum! Ich verstehe kein Wort! Keine Ahnung, wovon Sie sprechen! Kassiopeias Herz? Nie gehört. Was soll das sein?«
Bedauernd schüttelte der Mann in Schwarz den Kopf. »Dann muss ich deiner Erinnerung wohl ein wenig auf die Sprünge helfen.«
Er griff in die mitgebrachte Ledertasche und zog einen Gegen- stand daraus hervor, der aus zwei parallel angeordneten Metall- stäben bestand, die über zwei senkrechte Gewinde miteinander verbunden waren.
»Was haben Sie vor? Was ist das?«
»Wir kamen doch überein, dass ich die Fragen stelle, nicht du. Und dieses praktische Gerät wird mir dabei helfen. Es dient der Wahrheitsfindung – hat sich seit Jahrhunderten bestens bewährt.« Während er sprach, näherte sich Mephisto dem Gefesselten und schob das Teil über den Daumen von dessen linker Hand. Weil die Handgelenke auf der Armlehne festgezurrt waren, blieb jeglicher Widerstand zwecklos. Der Mann in Schwarz nestelte ein wenig herum, bis er mit dem Sitz der Querstangen zufrieden war, dann drehte er an den beiden Schraubenmuttern, die Branchen näherten sich einander, fassten den Finger des Gefangenen und quetschten sein Fleisch. Theodore Hobbs schrie auf.
»Eine Daumenschraube? Das ist eine Daumenschraube! Sind Sie irre? Wir sind doch nicht im Mittelalter!«
Ohne darauf einzugehen, lockerte Mephisto den Druck wie- der. Er wollte fair bleiben und seinem Gast eine schmerzlose Entscheidungsfindung ermöglichen. Schließlich war man zivili- siert. »Also noch einmal: Wo ist Kassiopeias Herz?«
»Was soll das sein? Ich kenne keine Kassiopeia!«
»Ts, ts, ts. Sich dumm zu stellen ist in dieser Situation keine gute Strategie.«
Erneut zog er die Daumenschraube an, dieses Mal stärker, bis ein Knacken zu hören war, gefolgt von einem gellenden Aufschrei. Da Theodore Hobbs über zehn Finger verfügte, der Mann in Schwarz ein geduldiger Pragmatiker war und zudem dringend eine Antwort auf seine Frage benötigte, dauerte das Verhör noch
eine ganze Weile. Schließlich gab sich Mephisto geschlagen. Sein Gefangener hatte anscheinend tatsächlich keine Ahnung.
»Ich werde dich jetzt nach Hause bringen, Theodore.«
»Wirklich?« Obwohl die Stimme schmerzverzerrt klang, lag unverkennbar Hoffnung darin.
Der Mann in Schwarz löste die Fesseln, stützte den schwer verletzten Theodore Hobbs beim Gehen und half ihm draußen beim Einsteigen in die Kutsche.
»Natürlich. Ich werde dich persönlich in deiner Wohnung abliefern. Abbey Road Nummer drei, vierter Stock, nicht wahr?«
1. Mayfair
Der Blick vom Frühstücksraum des Sebas- tian Club ging hinunter auf die Berkeley Square Gardens, ein großzügig angelegtes Rechteck, in dem hochgewachsene Platanen Schatten spendeten. An einem unverhältnis- mäßig heißen Sommertag wie diesem war das ein Segen, eine friedliche Oase im rast- losen Treiben Londons. Freddie zählte minde-
stens acht Kinderwagen, die von adrett gekleideten Nannys durch die Anlage geschoben wurden. Üppig bepflanzte Blumenrabatten spiegelten den Reichtum des Stadtviertels wider. Hier, in Londons Herz, hielt sich nur auf, wer es sich leisten konnte. Ausschließlich die Kinder von reichen und hochwohlgeborenen Leuten wurden in dieser Gegend spazierengefahren. Die Eltern sahen ihre Sprösslinge für gewöhnlich etwa eine Stunde täglich, sofern Mutter und Vater sich die Zeit dafür nahmen. Ansonsten befanden sie sich rund um die Uhr in Gesellschaft ihrer Gouvernanten, die für sämtliche Erziehungsfragen verantwortlich waren. Bei den Kindermädchen wiederum herrschte ein eben- so striktes Klassensystem wie bei ihren Arbeitgebern. Eine Nanny in Diensten eines Earls würde sich im Park nur mit einer Kollegin austauschen, die für eine eben- so wichtige Familie tätig war. Daher bildeten sich täglich Grüppchen, gab es Außenseiter und auch Gouvernanten, die von allen misstrauisch beäugt oder gar beneidet wur- den.
Von seinem Platz an einem Fenster im zweiten Stock des Sebastian Club konnte Freddie allerdings nur einen Teil
des Gartens einsehen. Er vermutete, dass sich weitaus mehr Babys dort unten aufhielten als besagte acht.
»Ich hoffe, meine kleine Führung durch unsere Räume hat Ihnen zugesagt«, unterbrach Professor Brown Freddies Gedanken. »Lassen Sie uns nun in mein Büro gehen.«
Von dort hatte man zwar keine freie Sicht mehr auf die Berkeley Square Gardens, dafür aber auf die helle Stein- treppe des Clubeingangs, die zum glänzend pechschwarz lackierten Portal mit seinem Messingtürklopfer in Form einer Löwenkralle hinaufführte. Jeder Neuankömmling ließ die schwere Tatze auf ihr Gegenstück, einen Messingball, krachen, woraufhin der Portier umgehend öffnete, um die Mitglieder einzulassen – und allen anderen den Zutritt zu verwehren.
Auch nicht schlecht, dachte Freddie.
Professor Brown konnte also von seinem Schreibtisch aus genau beobachten, wer den Club betrat oder verließ. Ein Umstand, den sich Freddie merken würde. Überhaupt fand er den Professor sehr aufmerksam, geradezu wissbegierig. Er schien ein interessanter Mann zu sein. Freddie schätzte ihn auf Anfang sechzig. Von seinem Onkel wusste er, dass Brown ein Professor der Anthropologie war. Früher hatte er einen Lehrstuhl an der Universität von Oxford gehabt, mittlerweile galt er offiziell als emeritiert. Inoffiziell freilich war er mit der Leitung des Sebastian Club wahrscheinlich beschäftigter als zu seinen Lehrzeiten. Immerhin musste er nicht nur nach außen hin den Eindruck erwecken, einen distinguierten Gentlemen’s Club zu verwalten, es gab intern auch noch die »Unterabteilung«, wie Onkel Philip es gerne bezeichnete.
Neben den normalen Mitgliedern beschäftigte der Club eine kleine Anzahl an Detektiven – diskret natürlich –, von denen Freddies Onkel einer war. Und heute war der große Tag, an dem auch Freddie Westbrook in den Kreis der Club- mitglieder – besser noch, der Ermittler – aufgenommen wurde. Ein Schauer wohliger Aufregung lief über seinen Rücken. Er
genoss ihn, gab sich einen Moment lang dem triumphierenden Gefühl hin, etwas Großes erreicht zu haben.
Nachdem er sein glückseliges Grinsen wieder unter Kon- trolle hatte, wandte er sich vom Fenster ab und nahm in einem Ledersessel Platz. Er ließ die Einrichtung des Büros auf sich wirken.
Geschmackvoll, repräsentativ, aber nicht protzig. Dunk- les Holz, dunkles Leder und ein wenig gedecktes Grün in den Gardinen sowie im Teppich. Professor Brown goss einen Fingerbreit Whisky in drei Gläser, reichte Freddie eines davon, das zweite Lord Philip, das dritte behielt er für sich.
»Lassen Sie uns anstoßen. Auf Ihren Clubbeitritt. Als Herrenclub mit strengem Codex und einer hohen Messlatte, was potenzielle Bewerber betrifft, haben wir nur wenige Gentlemen in Ihrem Alter. Diejenigen, die es in den Sebas- tian Club geschafft haben, sind daher etwas Besonderes. So wie Sie. Es ist uns eine große Freude, Sie als Mitglied ge- wonnen zu haben. Besonders nach dem, was uns Ihr Onkel über Ihre herausragenden Fähigkeiten erzählte.«
Freddie nippte an seinem Glas, warf einen kurzen Blick auf Lord Philip, der ihm mit seinen tiefblauen, ein wenig eng beieinanderstehenden Augen aufmunternd zuzwinkerte. Um seinen scharf geschnittenen Mund lag ein feines Lächeln.
»Ich nehme an, Sie sprechen vom Greenwood-Fall«, sagte Freddie an Professor Brown gewandt. »Mein Onkel nahm ein hohes Risiko auf sich, mich an den Ermittlungen mitwirken zu lassen. Dafür bin ich ihm dankbar. Er und ich haben uns sehr gut ergänzt. Sein Verdienst war genauso groß wie der meine.«
Professor Brown lächelte. »Bescheidenheit ist die Zier eines wahren Gentleman.«
Lord Philip zog eine Taschenuhr aus der dafür vorgesehe- nen Tasche seiner Anzugweste, klappte sie auf und studierte sie eingehend. Nachdem er sie wieder geschlossen und ver- staut hatte, leerte er sein Glas in einem Zug und sagte: »Ich will nicht unhöflich erscheinen, Professor, aber lassen Sie
uns zur Sache kommen. Die Formalitäten sind erledigt und uns allen ist bekannt, weshalb die Aufnahme meines Neffen so rasch abgewickelt wurde. Am besten, Sie schildern Fred- die die Fakten, dann können wir uns direkt an die Arbeit machen.«
»Gewiss, gewiss.« Professor Brown schien sich nicht an der direkten Art von Lord Philip Dabinott zu stören.
»Wie Sie bereits wissen, Mister Westbrook«, begann er seine Ausführungen, »handelt es sich bei unserem Club nicht einfach um einen gewöhnlichen Gentlemen’s Club. Wir haben es uns vielmehr zur Aufgabe gemacht, unserem Namensgeber gerecht zu werden. Der heilige Sebastian gilt unter anderem als Schutzpatron der Sterbenden. Und einige unserer Mitglieder sorgen dafür, dass den Toten Gerech- tigkeit widerfährt. Das bedeutet, wir klären Mordfälle auf, deren erfolgreiche Bearbeitung die Fähigkeiten von Scot- land Yard übersteigen.«
»Und was hält unsere Exekutive davon?«, konnte sich Freddie nicht verkneifen zu fragen.
Professor Brown strich mit einer Hand über seinen kurz gestutzten weißen Bart und überlegte. Dabei zog er seine buschigen schwarzen Augenbrauen, in denen sich, im Unter- schied zu Bart und üppigem Haupthaar, kein einziges wei- ßes Härchen befand, zusammen. »Das ist uns, ehrlich gesagt, ziemlich einerlei. Zumal unsere Clubmitglieder so einfluss- reiche Personen der Gesellschaft sind, dass wir unsere Ermitt- lungen mit und ohne Zustimmung der Beamten durchführen können. Gerade bei unserem aktuellen Fall ist es zum Beispiel so, dass der zuständige Kommissar völlig im Dunklen tappt. Er geht von mehreren Tätern aus, behandelt die Fälle als nicht zusammenhängend. Dabei steckt hinter allen eindeutig ein und derselbe Mörder. Aber machen Sie sich selbst ein Bild, Mister Westbrook:
In den letzten Wochen wurden drei Männer ermordet. Einer davon ist ein Lehrer aus Croydon, der zweite ein stadt- bekannter Zuhälter aus Whitechapel und der dritte Lord
Reginald Pierce, der ein Stadthaus hier in Mayfair besaß. Bei den Getöteten fanden sich Spuren von, sagen wir, intensiven Verhörtechniken.«
»Sie wurden gefoltert?«
»Nun ja, zumindest wurden ihnen vor ihrem Tod Verlet- zungen zugefügt, die das nahelegen.«
»Wie wurden sie getötet?«
»Den Lehrer hat man aus dem Fenster seiner Wohnung hinunter auf die Straße gestoßen. Der Zuhälter wurde er- stochen. Und Lord Pierce erschlagen. Er wurde übel zuge- richtet.«
»Die Gewalt steigerte sich von Mord zu Mord«, konsta- tierte Lord Philip. Er schlug die langen Beine übereinander und zupfte das Hosenbein seines Maßanzugs zurecht. »Aber warum gehen Sie davon aus, dass ein und derselbe Täter am Werk war?«
»Wegen der Verhörtechnik. Allen drei Opfern wurden vor ihrem Tod dieselben, sehr speziellen Verletzungen zugefügt. Sie alle tragen die Handschrift eines einzigen Mörders. Somit hätten wir eine Serie.«
»Vermutlich steht zu befürchten, dass diese fortgesetzt wird«, meinte Freddie. »Es sei denn, der Täter hat bereits bekommen, wonach er suchte.«
Professor Brown schüttelte den Kopf. »Dagegen sprechen die schrecklichen Verletzungen, die Lord Pierce zugefügt wurden. Das zeugt von Frustration. Unser Täter wird immer aggressiver. Deshalb müssen wir ihn schnellstmöglich ding- fest machen.«
»Und mein Onkel und ich sollen das für Sie erledigen.
Deshalb wurde ich in den Sebastian Club aufgenommen.« Professor Brown öffnete eine Schublade seines Schreib-
tisches und nahm einen Stapel Akten heraus, die er Lord Philip reichte. »So ist es. Dies sind Kopien der entsprechen- den Fallakten von Scotland Yard.«
Freddies fragendem Blick begegnete er mit einem Schul- terzucken. »Der Sebastian Club hat weitreichende Beziehun-
gen, wie ich schon sagte. Studieren Sie diese Unterlagen in Ruhe, und anschließend treffen wir uns wieder hier. Sagen wir morgen Abend zum Dinner? Dann werde ich Ihnen die beiden anderen Mitglieder unseres Ermittlerkreises vorstel- len.« Professor Browns Stimme hatte einen warmen, tiefen Klang und den Akzent eines gebildeten Akademikers. Es war angenehm, ihm zu lauschen. Beinahe bedauerte Freddie es, dass er nach seiner kurzen Skizzierung der Fakten nun am Ende seiner Ausführungen angelangt war.
2. Belgravia
Nachdem sie sich verabschiedet hatten, ver- ließen Freddie und sein Onkel den Sebastian Club und hielten eine Droschke an. Der Kutscher musste wenden, um den Weg nach Belgravia einzuschlagen, wo das Stadthaus der Dabinotts stand. Dabei passierten sie den Parkeingang aus nächster Nähe.
»Diese Nanny«, bemerkte Freddie, »auf der ersten Bank links, gleich neben dem Weg, saß schon vor zwei Stunden dort, als wir ankamen. Sie scheint den Club- eingang gut im Blick zu haben. Falls wirklich ein Baby in ihrem Kinderwagen liegt, was ich bezweifle, da er in der prallen Sonne steht, dürfte es mittlerweile gegrillt sein. Oder zumindest lautstark brüllen. Ich höre aber nichts. Darüber hinaus würde es mich wundern, wenn sich ein Kindermäd- chen einen derartig exklusiven Hut leisten könnte. Die junge Dame trägt nämlich ein Modell von Aldous Kingsley, und das ist der teuerste Hutmacher in Piccadilly. Wenn du mich fragst, beobachtet sie das Kommen und Gehen auf der ande- ren Straßenseite.«
Zweifelsohne war es ein Geniestreich von Lord Philip gewesen, Freddie als Ermittler zu gewinnen. Seinen wachen Augen entging nichts. Und seine Fähigkeit, Zusammen- hänge zu erkennen und richtig zu kombinieren, war überra- gend. Während die Kutsche sie zum Wilton Crescent brachte, musterte Lord Philip seinen Neffen. Der Tagesanzug, den er für Freddie hatte anfertigen lassen, stand diesem gut zu Gesicht. Das leichte Tuch war ideal für Freddies lange, schmale Figur. Und das gedeckte Grau schmeichelte seinem
Teint und den familientypischen taubenblauen Augen. Für seine zwanzig Jahre wirkte er noch reichlich jungenhaft, das wusste er selbst. Kein Bartwuchs, nicht einmal Flaum bedeckte seine Wangen, dafür waren die Wimpern erstaun- lich lang.
Ein schelmisches Lächeln glitt über Lord Philips Züge.
»Was ist?«, fragte Freddie ihn argwöhnisch. »Sehe ich so lächerlich aus in diesem Aufzug?«
»Mitnichten! Du siehst aus wie ein hochwohlgeborener junger Herr. Genauso, wie wir es beabsichtigten. Aber ich wette, du kannst es kaum erwarten, dich zu Hause umzuzie- hen, nicht wahr?«
»Falsch. Ich liebe meinen neuen Anzug und hoffe, ihn noch viele Male tragen zu dürfen. Wahrscheinlich werde ich noch einen zweiten und dritten brauchen. Mindestens. Das Einzige, was mich bei der Hitze wahnsinnig macht, ist dieser Kopfputz.«
Deshalb lief Freddie daheim sofort nach oben und riss sich die Kurzhaarperücke herunter. Nur mühsam gebändigte weizenblonde Locken quollen hervor, sprangen über Fred- dies Schultern und machten aus dem jungen Gentleman eine junge Lady.
Mit Bedauern schlüpfte diese aus dem Anzug und ergab sich widerstrebend den Zwängen ihres Korsetts. Es war bitter, den Genuss des freien Atmens wieder aufgeben zu müssen.
Nachdem sie sich umgezogen hatte, ging sie in Rock und Bluse nach unten, wo ihr Onkel schon in seinem Büro auf sie wartete. Vor sich hatte er die Fallakten liegen. Er nahm die oberste und reichte sie Freddie, zusammen mit einem Apfel aus der Obstschale, die immer auf seinem Schreibtisch stand. Freddie zog sich damit in einen Sessel vor dem Bücherregal zurück, während Lord Philip damit begann, die zweite Akte zu lesen. Sie liebte das Büro ihres Onkels und genoss es jedes Mal, sich darin aufhalten zu dürfen. Es war kein übermäßig großer Raum, gerade richtig, um einen eleganten Regency- Schreibtisch aus Mahagoniholz, zahlreiche Bücherregale und
eine Sitzgruppe vor dem Kamin zu beherbergen. Zwei Flügel- türen gingen hinaus auf den Garten. Nun standen sie offen, um ein wenig Luft hereinzulassen.
Eine Weile war nur das Rascheln, erzeugt durch das Umblättern der Seiten, zu hören sowie das Geräusch, das auch die wohlerzogenste Dame macht, wenn sie in einen Apfel beißt.
»Glaubst du, er hat etwas gemerkt?«, fragte Freddie schließ- lich.
»Wen meinst du? Professor Brown? Auf keinen Fall! Er ist immerhin nicht der Jüngste und seine Augengläser sind reichlich dick. Bestimmt sieht er nicht mehr allzu gut. Außer- dem war deine Verkleidung perfekt. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich dich selbst für einen jungen Mann gehal- ten. Wir haben alles bestens vorbereitet, inszeniert und zur Genüge hier in unseren vier Wänden geübt. Immerhin wis- sen wir beide, was vom Gelingen dieser Scharade abhängt. Wir müssen einem Mörder das Handwerk legen, Frederique, so schnell es geht! Wie gut, dass du schon immer eine über- raschend tiefe Stimme hattest. Klingt zwar wenig damenhaft, kommt uns aber jetzt sehr gelegen.«
»Es gibt Personen, die finden meine Stimme angenehm!«, protestierte sie.
»Gewiss, gewiss.«
»Sollte jemals herauskommen, dass Lord Philip Dabinott eine Frau in den hochehrenwerten Sebastian Club einge- schleust hat, wäre das ein handfester Skandal«, gab Fred- die zu bedenken. »Aber ich vermute, der Zweck heiligt die Mittel.«
Lord Philip nickte. »Genau. Deshalb machen wir uns nun ans Werk, damit wir wenigstens Erfolge vorweisen können, sollte deine Tarnung auffliegen …«
3. Im Club
»Ich wusste nicht, dass Sie einen erwach- senen Neffen haben«, sagte Doktor Wallace Pebsworth zu Lord Philip, ohne von seinem Steak aufzusehen, das er mit dem Messer malträtierte. Es war bereits seine zweite Portion.
Freddie bezweifelte, dass das in Braten- soße ertränkte, blutige Stück Fleisch nebst
gebuttertem Trüffelpüree und glasierten Karotten irgend- etwas Positives für Pebsworths ausladende Mitte tun würde. Aber das müsste der gute Doktor selbst am besten wissen. Zugegebenermaßen war das Essen im Sebastian Club vor- züglich. Freddie selbst hatte Wachteln an Rotweinsud ge- nossen und freute sich nun auf das Dessert – welches sie ohne Reue schlemmen konnte, schließlich quetschte kein Korsett ihre Körpermitte.
»Freddie ist der Sohn meiner verstorbenen Schwester«, hörte sie Lord Philip erklären. »Und er ist nur zwei Jahre jünger als ich.«
»Zwölf Jahre, Onkel Pip«, warf Freddie automatisch ein, wie immer. Lord Philip liebte es, bei seinem Alter zu schwin- deln.
»Dann eben zwölf«, gab der widerstrebend zu. »Und du sollst mich nicht ›Onkel Pip‹ nennen, das weißt du doch. Das klingt, als wäre ich ein Tattergreis mit Puschen und Schlaf- mütze.«
Der junge Herr, der neben Doktor Pebsworth saß und die Runde mit aufmerksamen, hellen Augen betrachtete, konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Er schien selbst
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info





