
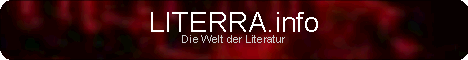
|
|
Startseite > Bücher > Social Fiction-Storys > Fabylon > Thomas Wawerka > WIE DAS UNIVERSUM UND ICH FREUNDE WURDEN > Leseproben > Die Göttin des Überflusses |
Die Göttin des Überflusses
| WIE DAS UNIVERSUM UND ICH FREUNDE WURDEN
Thomas Wawerka Broschiert, 264 Seiten Mar. 2011, 13.50 EUR |
Beim Frühstück zitterte Christinas Hand so sehr, dass sie den Kaffee verschüttete. Braune Flecken breiteten sich auf dem makellos weißen Tischtuch aus.
»O Gott«, sagte sie und versuchte, die Tasse halbwegs gesittet auf die Untertasse zurückzustellen. Das Porzellan klirrte. Sie griff mit beiden Händen nach dem Geschirr und schob es zur Seite. Dann tupfte sie mit der Serviette hektisch auf den Kaffeeflecken herum. Dabei stieß sie die Silbergabel vom Tisch, die scheppernd auf den Marmorboden fiel.
Die Gespräche der anderen erstarben. Manche drehten sich zu ihr um.
Christinas Gesicht war weiß geworden. Ihre Augen glänzten wie im Fieber. Sie starrte auf die Kaffeeflecken. Schließlich schob sie den Stuhl zurück, stützte die Ellbogen auf die Oberschenkel, verbarg ihr Gesicht in den Händen und blieb still wie eine Statue sitzen.
Wie ›Der Schmerz‹, dachte Leander. Francois Milhomme, 1816, Marmor.
Er bewunderte sie zum hundertsten Mal. Ihr Kopf neigte sich im perfekten Winkel. Die Linie der Schultern und Arme flossen wie Wasser über einen glatten Stein. Ihr Bauch lag unter dem dünnen Kleid wie eine Ebene. Der leicht gebeugte Oberkörper sprach ruhig und klar von ihrem Kummer. Bildschön, selbst in ihrer Verzweiflung. Egal, was Christina tat, noch in ihrer lässigsten Pose bildete sie für Leander den Inbegriff eines Ideals. Er nahm die Serviette von der Hose und ging zu ihr.
»Christina!«
Er legte ihr die Hand auf die Schulter. Als ob diese Berührung die Statue zum Leben erweckte, schluchzte Christina. Ihr Rücken zitterte.
»Stehen Sie auf!«
Er nahm ihren Unterarm und zog sie hoch. Sie wollte die Hände nicht vom Gesicht nehmen.
»Kommen Sie!«
Er führte sie zur Tür. Dort drehte er sich um und schenkte den vierzig starrenden Personen ein Lächeln.
»Sie entschuldigen sicher. Wir alle wissen, wie schwer es manchmal ist, nicht wahr?«
Die Anwesenden murmelten pflichtschuldig ihre Zustimmung und wandten sich wieder ihrem Essen zu.
Leander zog sie zum Fahrstuhl, dann über den Teppichboden der Gänge zu ihrem Zimmer.
»Ich will nicht zurück!«, flüsterte Christina immer wieder unter ihren feuchten Handflächen hervor. »Ich will nicht zurück!«
»Schon gut. Beruhigen Sie sich!«
Die Tür stand einen Spalt offen. Jemand lief geschäftig durchs Zimmer. Er führte Christina hinein und setzte sie auf die Polsterbank. Dann schickte er die Putzfrau fort.
»Nehmen Sie die Hände vom Gesicht!«
»Meine Schminke ist verlaufen. Ich habe mir das Gesicht ruiniert.«
»Das macht nichts. Nehmen Sie endlich die Hände herunter und sagen Sie, was los ist!«
Sie ließ die Hände sinken und sah ihn an. Ihre Augen blickten aus der dunklen Umrandung wie aus einer Höhle. Die Farbe war mit ihren Tränen die Wangen hinabgelaufen; ihre Handballen hatten sie verschmiert. Es sieht aus wie schwarzes Blut, dachte er. Und wie sie dasaß und zu ihm aufsah! Wieder eine dieser Positionen, in der man sie direkt auf der Agora des antiken Athen aufstellen könnte. Die Schutzflehende Barberini, 430 vor Christus, Marmor, ausgestellt im Louvre.
»Glotz mich nicht so an!«, sagte sie mit plötzlichem Trotz. »Ich hab dir gesagt, dass ich scheiße ausseh.«
Immer wenn Christina starke Emotionen zu verarbeiten hatte, fiel sie in die Gossensprache zurück.
»Verzeihen Sie bitte!«
»Ach verdammt!«
Christina sprang auf, ging zum Fenster, verschränkte die Arme vor der Brust und schwieg. Leander ertrug es eine Weile, dann stellte er sich hinter sie und blickte über ihre Schulter. Die Blätter der Bäume loderten in einem Gemisch aus Rot, Gelb und Grün. Zwischen den Stämmen lugte hier und da ein Backstein der inneren Mauer hervor.
»Wie kommen Sie so plötzlich darauf?«
Sie drehte sich um, ging zum Tisch, hob ein Papier auf und gab es ihm. Leander zog die Brille mit Goldrand aus der Tasche seines Jacketts und überflog es.
»Ahh ...«, machte er dann. »Das ist ernst. Das Guthaben, das Ihr Vater eingezahlt hat, läuft mit diesem Monat aus. Wussten Sie das nicht?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Warum denn nicht?«
»Ich hatte zu tun, verdammt nochmal!«
Leander nickte. Christina hatte gegessen und getrunken, sich geschminkt und schick gekleidet, in einem Bett geschlafen, Filme angesehen, Tanzveranstaltungen besucht. Sie hatte gelernt, sich unter einer Elite zu bewegen. Vor allem hatte sie gelernt, die Welt jenseits Mauern zu vergessen. Sie war nur fünfhundert Meter entfernt, aber für das Gefühl trennte ein Ozean die Residenz vom Rest der Welt – ein Ozean, der in Wahrheit aus Mauern und elektrischen Zäunen und bewaffneten Wächtern bestand. Sie hatte zu tun gehabt; tatsächlich. Sie war im Rausch gewesen. Jetzt folgte die Ernüchterung.
»Aber Sie wussten, dass es einmal soweit kommen würde? Das hat man Ihnen und Ihrem Vater doch gesagt, oder?«
»Klar und deutlich, aber es war die Rede von mindestens drei Jahren! Bleib so lange hier, hat mein Vater gesagt. Wenn die Zeit um ist, sieht es bestimmt besser aus. Dann hole ich dich wieder ab. Jetzt bin ich noch nicht mal ein Jahr hier, und auf einmal ist das Geld alle und ich soll wieder gehen!«
»Sie haben versäumt, die Nachrichten zu verfolgen. Hätten Sie das getan, wüssten Sie, dass die Lebensmittelversorgung für den kommenden Winter nicht gesichert ist. Daraus resultiert eine Inflation. Die Residenz kann nichts dagegen tun. Weder die Leitung noch irgendjemand sonst meint es böse mit Ihnen. Keiner kann etwas dafür.«
»Sobald ich durchs Tor gehe, werde ich wieder ein Tier sein. Kälte, Hunger, Durst.« Sie hob Daumen, Zeige- und Mittelfinger. »Am schlimmsten ist es, wenn es regnet.« Der Ringfinger. »Und vergewaltigt zu werden.« Der kleine Finger. »Ich bin Freiwild.« Sie krümmte die Finger, ballte die Hand und ließ sie sinken.
Leander nickte. Er erinnerte sich genau an den Tag, als sie die Residenz betreten hatte. Der Körper mager, aber trotzdem formvollendet. Die Haare pink gefärbt, das Gesicht gepierct. Ein Punk von der Straße, wo sie sich für eine Tasse Kaffee und eine Zigarette prostituiert hatte oder einfach verprügelt worden war. Ihr Vater ein dünner Mann mit fahrigen Bewegungen, ein Wrack. Fraglich, woher er das Geld hatte, um Christina hier für drei Jahre unterzubringen. Aber solche Fragen stellte hier niemand. Wer es in die Residenz schaffte, ließ seine Vergangenheit zurück. Wer wieder weggehen musste, seine Zukunft.
»Ihr Ende wäre dann nur noch eine Frage der Zeit, Christina.«
»Das weiß ich selber, Mann.«
»Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit.«
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Sie sah ihn fragend an.
»Für ein paar Tage im Herbst herrscht das perfekte Gleichgewicht«, sagte er. »In dieser kurzen Zeit schwelgt er im Überfluss, offenbart er alle Pracht. Danach, wenn die Blätter braun werden und abfallen, lohnt es nicht mehr, hinauszusehen.«
»Tolle Sache«, antwortete sie. »Ich glaub kaum, dass die paar Dutzend Leute, die gerade verhungern, und die paar Dutzend, die heut Nacht erschlagen werden, oder die Übrigen, die sonst noch ihr Leben ausröcheln, sehr viel drauf geben.«
»Nein, das glaube ich auch nicht«, sagte Leander und lächelte. »Ich hielt es allerdings für eine geeignete Metapher, Christina. Für den, der im Überfluss leben durfte, der die Pracht gesehen hat, und sei es nur in kurzer Zeit, hat das Leben nichts mehr zu bieten.«
»Wie meinen Sie das?«
»Draußen wäre Ihr Ende nur eine Frage der Zeit. Deshalb hat Ihr Vater Sie doch hergebracht, nicht wahr? Bei uns ist es ebenso. Hier wie dort dasselbe, nur eine Frage der Zeit. Der Unterschied besteht darin, wie wertvoll diese Zeit war. Darauf kommt es an.«
»Jetzt reden Sie doch endlich mal Klartext!«
»Jedes Ding hat seine Zeit, und für jedes Ding kommt ein Ende. Auch für mich. Ein äußerst humanes Ende, wie ich betonen möchte.«
»Warum? Sind Sie krank? Krebs oder was?«
»Für ein geringes Entgelt kommt, wann immer Sie es wünschen, eine Schwester zu Ihnen. Sie wird Ihnen etwas geben, das Ihnen hilft, einzuschlafen. Das Ihnen hilft, nicht wieder aufzuwachen.«
Sie sah ihn verwirrt an.
»Es ist nur eine Möglichkeit, aber ich bevorzuge sie. Wie alle anderen, die Sie hier kennengelernt haben.«
»Ihr lasst euch umbringen?«
»Sehen Sie, meine Liebe, umgebracht wird man von einem Straßenräuber, einem Serienmörder oder sonst einem Verrückten. Sie könnten umgebracht werden, wenn Sie in dieses Chaos da draußen zurückkehren. Hier jedoch werden wir auf gar keinen Fall umgebracht. Wir verabschieden uns. Das ist doch etwas ganz anderes. Viel freundlicher, finden Sie nicht auch?«
»Aber ... warum tut ihr das?«
»Warum? Welchen Grund außer einem könnte es wohl geben – irgendwann ist das Geld alle. Mit der jetzigen Inflation schneller als geplant. Sie sehen, es trifft jeden. Aber wie schon gesagt, keiner kann etwas dafür, deshalb wollen wir uns auch nicht beschweren, sondern die Pracht auskosten.«
Christina schüttelte den Kopf, als müsse sie die Benommenheit loswerden.
»Ich dachte, ihr seid reich.«
»Nicht unbedingt. Das Geld, das wir hatten, haben wir hier eingezahlt und uns dafür entschieden, reich zu sein. Eine kurze Zeit im Überfluss oder eine lange Zeit ärmlich leben – jeder kann es sich aussuchen. In beiden Fällen ist die Zeit irgendwann um; in beiden Fällen kommt das Ende. Aber hält etwa der Herbst seinen Reichtum zurück, nur um mehr Zeit zu gewinnen? Nein, er verschwendet sich.« Er wandte sich wieder zum Fenster. »Sehen Sie nur, wie schön er ist!«
»Aber Fräulein Adele ist nach Amerika geflogen ...«
Mutter, Großmutter, Freundin, all das war Adele für sie gewesen, dachte Leander. Christina-Kind, so hatte Adele sie gerufen. Er schüttelte den Kopf mit der nachsichtigen Miene eines Vaters, der seinem Kind die Wahrheit über den Weihnachtsmann offenbaren muss.
»Sie wissen vielleicht nicht viel darüber, aber die gesamte westliche Zivilisation ist zusammengebrochen. Es ist aus und vorbei. Glauben Sie, dass es irgendwo in Amerika anders zugeht als bei uns? Was sollte Fräulein Adele also dort?«
Sie ließ den Kopf hängen. Auf ihren Wangen blitzten Glasperlen. Leander bewunderte ihre Schultern. Christina sah auf, flehte ihn stumm an, ihr das Gegenteil zu erzählen. Er lächelte.
»Es ist wichtig, für einige Zeit an bestimmte Dinge zu glauben. Fräulein Adele wusste das. Aber es ist auch wichtig, die Wahrheit zu akzeptieren. Fräulein Adele hat sich verabschiedet. Das ist die Wahrheit, Christina. Und wenn ich etwas mal vorsichtig sagen darf: Sie hätte Ihnen auch dazu geraten.«
»Ich kann nicht«, flüsterte sie. »Ich muss auf meinen Vater warten. Er hat versprochen, zurückzukommen.«
»Ja. Wenn sich die Lage bessert. Aber die Lage wird sich nicht bessern. Ich fürchte, das wusste er, Christina.«
Christina sank auf die Knie. Sie setzte sich auf ihre Fersen und legte die Hände auf die Schenkel. Ihre Augen schienen durch die Wand in eine weite Ferne zu sehen.
Die Venus aus Chalandry, dachte Leander. Bronze, im Musée Archéologique Municipal in Laon. Wundervoll.
»Ich kann nicht«, wiederholte sie. »Ich will nicht sterben.«
Beide schwiegen. Leander konnte nicht sagen, ob es zehn Minuten oder zwanzig waren oder vielleicht sogar eine halbe Stunde. Christina starrte an die gegenüberliegende Wand, er starrte auf Christina. Ihre Formen erfüllten ihn mit solchem Glück, dass er keine Worte brauchte.
»Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit«, räumte er schließlich ein. Er bemühte sich, seine Aufregung zu verbergen.
»Dann kann sie nur besser sein.«
»Legen Sie sich hin, ruhen Sie sich aus. Ich gehe inzwischen recherchieren.«
Er verließ ihr Zimmer. Er war in Hochform wie lange nicht mehr, weil ihm diese Idee gekommen war. Er setzte sich an den Rechner und legte eine CD-Rom ein: Skulptur. Von der Antike bis zur Gegenwart. Er verbrachte den Rest des Tages damit, seine Favoriten herauszusuchen, auszudrucken, zu ordnen.
Am nächsten Tag kam Christina nach dem Mittagessen zu ihm. Dann stand sie nackt und still vor dem geöffneten Fenster. Draußen wogte das Farbenmeer der Herbstblätter. Die Luft war wie ein Spiegel, in dem sich das Licht golden brach.
Er nickte ihr zu. Sie entließ ihren Körper aus der Spannung, sah auf das nächste Blatt. Dann winkelte sie das linke Bein an und nahm ihre Brüste mit festem Griff: Ops, die Göttin des Überflusses, Symbol der sich hingebenden Erde. Bartolomeo Ammannati, 1572, Bronze, im Studierzimmer des Herzogs Francesco I. de Medici im Palazzo Vecchio in Florenz.
Die Residenz hatte ihm alles bis zum Überdruss geboten: kunstsinnige Gesprächsfreunde, erlesene Speisen und Weine, Sex mit wem und soviel er wollte. Sie war das Letzte, das er für Geld haben konnte; das Einzige, das er noch wollte. Einst, vor dem Zusammenbruch, hatte er Skulpturen restauriert. Die menschlichen Plastiken hatte er besonders geliebt; Körper voller Spannung und Leben, die nur darauf warteten, auferweckt zu werden. Er hatte sich gewünscht, ihnen ein magisches Wort zusprechen zu können, doch alles, was er tat, konnte ihren Verfall nur für einige Zeit verzögern.
Dann hatte er sie kennengelernt, die Göttin des Überflusses.
Dieser Überfluss, dachte er. Die Krankenschwester drückte ihm ein mit Desinfektionsmittel getränktes Zellstoffstück auf die Einstichstelle und sagte ihm, er solle es festhalten.
Diese Verschwendung in einem einzigen Körper, dachte er und lächelte.
Diese Pracht.
Weitere Leseproben
| Der alte Mann und das Glück |
| Der alte Mann und das Glück |
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info




