
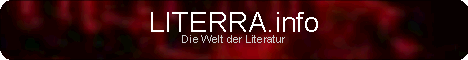
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Tanya Carpenter > Phantastik > Die Suche |
Die Suche
von Tanya Carpenter
Diese Kurzgeschichte ist Teil der Kolumne:
|
|
TRIADEM
A. Bionda, T. Carpenter | |
Dem renommierten Pharma-Unternehmen Mitchum-Pharmaceuticals ist ein Durchbruch auf dem Gebiet der Aids-Forschung gelungen. Erstmals kann ein Mittel vorgewiesen werden, das alle bisherigen Viren-Stämme effektiv bekämpft. Bei allen 3.500 Probanten, die an der Testreihe teilnahmen, wurden die Viren im Blut vollständig zerstört und es gab keinerlei Mutationen des Erregers. Das Medikament mit dem Namen Lyventrin wird Ende des Jahres auf dem Weltmarkt verfügbar sein. Nach einem Impfstoff gegen die Immunschwächekrankheit wird weiter geforscht ...
Abwartend schaute Harkon Mitchum zu seinem Freund und Vertrauten, während dieser den Zeitungsartikel zu Ende las, ihn wieder sorgfältig zusammenfaltete und ihm zurückgab.
„Du hast es wirklich geschafft, mein Junge. Ein Segen bist du für diese Welt. Du und dein Imperium. Ihr werdet auch den Impfstoff finden, das weiß ich.“
„Bist du stolz auf mich, Bernhardt?“, fragte Harkon schüchtern und fühlte sich dabei so unsicher wie ein Schuljunge. Bernhardt war mehr für ihn als nur der derzeitige Hüter der Lade, jener sagenumwobenen Schatulle, in der die Geschichte der Diljaner-Familie von den Anfängen bis in die heutige Zeit verwahrt wurde. Die Diljaner, denen Harkon angehörte, waren keine gewöhnlichen Menschen, sondern Bluttrinker. Doch sie stellten ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in den Dienst der gewöhnlichen Sterblichen, um zurückzugeben, was sie sich mit dem Blut von den Menschen nahmen.
Pater Bernhardt hingegen war ein Mensch. Er hatte Harkon vor vielen Jahren das Leben gerettet. Seitdem hielten sie engsten Kontakt.
„Ich bin immer stolz auf dich, mein Junge“, antwortete Bernhardt und klopfte ihm auf die Schulter. „Das weißt du doch.“
Vor über zwanzig Jahren hatte sich Harkon im Auftrag des obersten diljanischen Heerführers Archimedes auf den Weg zu Pater Bernhardt in seiner Eigenschaft als Bewahrer gemacht. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte allein Archimedes Kenntnis von Aufenthaltsort und Identität des Bewahrers, jedoch hielt er die Zeit für gekommen, Harkon einzuweihen, damit er das Amt des Heerführers irgendwann übernehmen konnte. In der Nähe der kleinen Kirchengemeinde, weit außerhalb der Spielerstadt Las Vegas war Harkon durch eigene Unaufmerksamkeit in einen Hinterhalt der feindlichen Ascon geraten. Bluttrinker ähnlich den Diljanern, jedoch von einer weitaus dunkleren Sorte. Sie raubten ihren Opfern nicht nur das Blut, sondern vorrangig deren Lebensenergie. Blut nährte sie im Gegensatz zu den Diljanern nicht mehr, sie tranken es aus reiner Gier.
Harkon war bei dem Überfall schwer verwundet worden. Seine Peiniger hatten ihn halbtot liegen lassen, mit einer großen Menge Borca im Blut von ihren giftigen Schwertklingen, das sich langsam durch seinen Körper und seine Nervenbahnen fraß, ihn lähmte und ihm grausame, dunkle Illusionen bescherte. Ehe sie ihn zurückließen, hatten sie ihm noch eine Kugel in den Kopf gejagt, um sicher zu gehen. Pater Bernhardt hatte ihn so gefunden, als er vom Besuch bei einem seiner Schäfchen mit dem Fahrrad zurück zur Kirche fuhr. Er hatte Harkon mit in seine Kirche genommen, die Wunden gereinigt und mit einer besonderen Heilsalbe bestrichen. Danach hatte Harkon von diesem merkwürdigen Gebräu trinken müssen, das von Bewahrer zu Bewahrer weitergeben wurde. Ein Tee aus verschiedenen Wurzeln und Pflanzen. Das Rezept stammte noch aus Zeiten der schamanischen Ureinwohner und es war gar nicht einfach, heutzutage noch an alle Bestandteile zu kommen. Nachdem das Fieber gesunken war und das Borca in seinem Blut an Kraft verloren hatte, ließ Bernhardt einen befreundeten Arzt kommen, der die Kugel aus Harkons Schädel entfernte. Zum Glück hatte er einen Dickkopf, wie der Pater seitdem immer wieder gern betonte. Das Projektil war an seiner Schädeldecke abgeprallt statt sie zu durchschlagen und unter der Haut parallel zum Knochen Richtung Hinterkopf gewandert. Lediglich zwei kleine Narben kennzeichneten heute noch die Eintrittswunde sowie den Einschnitt, wo sie die Kugel herausgeholt hatten. Wer es nicht wusste, würde es nicht mal bemerken. Was man jedoch bemerkte, waren die vielen Narben auf Harkons Rücken, seiner Brust, an seinen Armen und Beinen. Feine weiße Linien, wie ein hauchdünnes Spinnennetz überzogen seinen Körper. Zuviel Borca. Sonst hätten seine Selbstheilungskräfte ausgereicht, die Wunden spurlos zu heilen. So aber war Harkon für immer gezeichnet. Ihn störte es nicht, auch das machte den Krieger in ihm aus.
„Lass uns einen Tee trinken, mein Junge“, schlug Pater Bernhardt vor und ging Harkon voraus in sein kleines Privatrefugium. Auf einem alten Gasherd machte er einen Kessel mit Wasser heiß.
„Und nach dem Heilmittel für die Droge suchst du ebenfalls noch?“, fragte Bernhardt und schaute Harkon aufmerksam an, während er Zucker in seine Teetasse rührte. Harkon lächelte wehmütig über diese bislang so aussichtslose Passion, seine Besessenheit. Seit sein Freund Martin von den Ascon gefangen genommen und mit der Flash-Droge gefügig gemacht worden war, suchte er nach einem Weg, ihm und allen anderen Süchtigen zu helfen.
Verdammtes Borca! Zusammen mit Heroin ergab es diese schreckliche Droge mit der die Ascon versuchten, Menschen wie Diljaner unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie hatten zunehmend mehr Erfolg. Harkon hatte etwas von dem Tee mitgenommen, mit dem Bernhardt das Gift aus seinem Körper entfernt hatte. Bislang waren jedoch alle Tests im Labor mit der Flash-Droge selbst erfolglos geblieben.
„Ich bräuchte mehr von dem Pulver“, sagte Harkon seufzend. „Es ist einfach zuwenig für die Tests.“
„Ich kann dir nicht mehr geben, Harkon, das weißt du. Es ist schwer genug, diese Dinge zu beschaffen.“
Harkon war nicht in der Lage, seine Enttäuschung zu verbergen. Pater Bernhardt legte ihm die Hand auf den Arm.
„Vielleicht“, begann der Pater, „solltest du Urlaub in der Wildnis machen.“
Als Harkon ihn verständnislos ansah, lächelte er. „Folge dem Lauf des Rapid Creek bis zu seiner Quelle. Du wirst finden, wonach zu suchst, wenn du den alten Pfaden in den Black Hills mit offenen Augen folgst.“
Harkon Mitchum stützte sich auf den Ast, den er unterwegs aufgelesen hatte und der ihm als Spazierstock diente. Er löste die Wasserflasche von seinem Gürtel und nahm einen kräftigen Schluck. Die Sonne brannte vom Himmel, doch der Rapid Creek, der direkt neben ihm floss, sorgte für eine angenehme Frische. Seit drei Tagen folgte er dem Lauf des Flusses. So wie Pater Bernhardt es ihm aufgetragen hatte. Er sollte ihm bis ins Herz der Black Hills folgen, dort würde er finden, was er suchte: Die Zutaten für das Heilmittel gegen Borca, dem einzigen Gift, das in der Lage war, Angehörige seiner Gattung zu töten, oder – vermischt mit Heroin und Blutplasma – in Form der gefürchteten Flash-Droge zu einem psychischen Wrack zu machen. Harkon war ein Bluttrinker, aber weit entfernt von der sagenumwobenen Gestalt eines Grafen Dracula. Seine Art war den Menschen wesentlich ähnlicher als den mystischen Vampiren. Im Grunde waren sie verwundbar und sterblich wie jeder Mensch, wenn auch ihre Selbstheilung und Körperkraft deutlich größer waren. Außerdem besaßen sie eine enormer Langlebigkeit und eine natürliche Immunität gegen fast alle Krankheiten und Gifte dieser Welt.
Doch ihre Gattung hatte sich in zwei Lager gespalten. Die Anhänger der Diljaner-Familie wollten eine Co-Existenz mit den Menschen und griffen in der Regel auf Blutkonserven zurück, um sich zu nähren. Zu ihnen gehörte Harkon. Mit seinem Pharmakonzern Mitchum Pharmaceuticals arbeitete er permanent an Heilmitteln und Impfstoffen gegen Krankheiten wie Aids, Krebs oder Ebola, und als Krieger für die Königsfamilie Diljan bekämpfte er darüber hinaus deren Feinde: die Ascon und ihre Söldner. Ihr Bestreben war es, sich die Menschen als Sklaven zu unterwerfen und sie töteten ihre Opfer. Seit Jahrhunderten herrschte deshalb Krieg zwischen den beiden Familien, denn die Diljaner setzten alles daran, die Menschen vor diesem Schicksal zu bewahren.
In den letzten Monaten war die Zahl der Flash-Abhängigen unter den Bluttrinkern extrem gestiegen. Es gab ein Gegenmittel gegen das reine Borca, aber nicht gegen die mit Heroin vermischte Droge. Harkon hoffte, aus den Bestandteilen des Borca-Gegengiftes auch ein Heilmittel für die Droge entwickeln zu können. Pater Bernhardt war im Besitz dieses Gegenmittels. Er war der derzeitige Bewahrer, entstammte einer langen Ahnenreihe von Medizinmännern, Schamanen und Priestern, die um die Geheimnisse der Bluttrinker wussten und „die Lade“ hüteten. Jene sagenumwobene Schatulle, die alle Heimlichkeiten der Diljaner-Familie in sich barg. Die Bewahrer waren diesem Königsgeschlecht seit jeher treu ergeben und unterstützten sie in ihren Bemühungen um ein friedliches Miteinander zwischen Bluttrinkern und Nichtbluttrinkern. Sie kannten das Borca und auch das Gegenmittel dazu. Das Wissen um die Bestandteile und ihre Zusammensetzung wurde von einem zum nächsten weitergegeben. Aber Pater Bernhardt hatte nicht mehr viel davon. Nicht genug, um Harkons Forschungen weiter zu unterstützen. Also hatte der Geistliche ihn in die Black Hills geschickt, um dort nach den Zutaten zu suchen, die man brauchte, um den Tee herzustellen, der das Borca im Körper neutralisieren konnte.
Außer ein paar Bären, Rehen, einem einsamen Wolf und jeder Menge Grünzeugs hatte Harkon bislang allerdings nichts gesehen. Der Wolf begleitete ihn, seit er dem Lauf des Rapid Creek folgte. Harkon wusste es, er spürte die Augen des Tieres, wie sie aus den Schatten des Waldes auf ihm ruhten. Aber das Tier näherte sich ihm nicht und griff auch nicht an. Also akzeptierte er seinen stummen Begleiter, gewöhnte sich sogar daran und fand es ganz angenehm, nicht allein zu sein.
Als es dunkel wurde, entschied er sich, sein Lager aufzuschlagen und die Suche am nächsten Tag fortzuführen. Hinter der nächsten Biegung fand er einen geeigneten Platz. Eine kleine Senke, von niedrigen Büschen umgeben. Schnell war das Zelt aufgeschlagen, das Lagerfeuer entzündet und der Schlafsack ausgerollt. Ebenso schnell kam auch die Dunkelheit und tauchte die Landschaft mit ihrer üppigen Vegetation und dem beständigen Rauschen des Flusses in geheimnisvolles Zwielicht. Harkon schaute zu den Bäumen. Da blitzten sie wieder auf, die Wolfsaugen. Er lächelte und wünschte dem Grauen eine gute Nacht. Die natürliche Scheu des Wolfes hatte ihn bisher davon abgehalten, näher an das Lagerfeuer zu kommen, aber heute hatte er sich zum ersten Mal aus seinem sicheren Versteck gewagt und war ein paar Schritte aus dem Wald herausgetrottet.
Schmunzelnd schaute Harkon zu dem Tier hinüber. Es hob witternd die Nase in seine Richtung.
„Tut mir leid, mein Freund“, meinte Harkon. „Aber ich schätze, mein Kaffee wird dir nicht schmecken.“
Der Wolf schnaubte, es sah fast so aus, als äußere er damit seinen Unmut darüber, dass es kein Abendessen gab. Aber dann drehte er sich um und verschwand wieder im Schutz des Waldes.
Harkon leerte seinen Becher, legte sich dann auf den Rücken, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und schaute in den Himmel. Der Mond war beinahe voll, die Sterne glitzerten wie ein ganzes Meer aus Diamanten. Heute Nacht hatte die Kraft des silbernen Erdtrabanten eine merkwürdige Wirkung auf ihn. Er konnte den Blick nicht von ihm wenden. Der Wolf war immer noch da, er spürte es. Ein langgezogenes, einsames Heulen durchschnitt die Nacht. Regungslos lauschte Harkon dem Lied und fixierte weiter die silberne Scheibe. Nach einer Weile hatte er das Gefühl, dass sich der Mond bewegte. Sicher war das nur eine optische Täuschung, weil er so lange einen einzelnen Punkt fixiert hatte. Plötzlich zog eine Sternschnuppe über das schwarze Firmament und schnitt die silberne Scheibe mitten entzwei. Verblüfft hielt Harkon den Atem an. Die beiden Hälften des Mondes rutschten langsam auseinander, dabei bogen sie sich an den Enden leicht aufeinander zu, so dass das Ganze schließlich einem geöffneten Mund glich. Das Prasseln des Feuers verwandelte sich in die Schläge einer Trommel, unter die sich nach und nach uralte Lakota-Gesänge mischten, immer noch begleitet vom melodischen Geheul des Wolfes. Harkon war wie gelähmt. War das real oder träumte er? Zwischen den Mondhälften quoll ein silbrigklarer Fluss hervor, der als Wasserfall vom Himmel fiel und sein helles Wasser in die Fluten des Rapid Creek ergoss. Ein Kanu erschien in der Öffnung des Mondmauls. Zwei schwarzhaarige Krieger, in weißem Hirschleder gekleidet, ruderten mit gleichmäßigen Schlägen langsam den Wasserfall hinunter, als folgten sie einem ruhigen, geraden Flusslauf. Zwischen ihnen stand ein Mann mit einem Lendenschurz, die Hörner eines Hirsches auf seinem Haupt wie eine Krone. Über seiner Schulter hing der Kopf eines Wolfes und das graue Fell des Tieres fiel über seinen Rücken. Während er näher kam, erkannte Harkon, dass der Mann Krähenfedern in seinem Haar trug, welches durch ein Stirnband aus Schlangenhaut zusammengehalten wurde.
Als das Kanu in den Rapid Creek eintauchte, geriet es für einen kurzen Moment ins Trudeln, doch die beiden Ruderer richteten es sofort wieder aus. Der Mann in der Mitte schwankte nicht ein einziges Mal. Die Krieger steuerten ihr Boot zum Ufer, direkt an die Stelle, wo Harkon lagerte. Zögernd erhob dieser sich und wagte es, auf diese merkwürdigen Besucher zuzugehen. Während die Ruderer in ihrer Bewegung erstarrten, stieg der Mann mit dem Hirschgeweih aus und kam Harkon entgegen. Zwischen den Krähenfedern lugten silberne Haarsträhnen hervor. Das Gesicht, das nun vom Lagerfeuer erhellt wurde, zeigte tiefe Altersfurchen. Die Haut war fest und dunkel wie gegerbtes Leder.
„Harkân Thorwald“, sprach er Harkon mit seinem Geburtsnamen an, den dieser seit vielen Hunderten von Jahren nicht mehr gehört hatte.
„Wer bist du?“
„Ich habe viele Namen. Doch die Lakota nennen mich Wakan Tanka. Du würdest Odin sagen. Doch Namen sind ohne Belang.“ Harkon erbleichte. Der Große Geist, der Gott aller Götter, und er stand ihm direkt gegenüber. „Eine Reise hast du angetreten, großer Krieger. Betrittst den heiligen Boden der Geister, das Paha Sapa. Doch deine Beweggründe sind ehrenvoll.“
Der Indianer machte ein Geste Richtung Wald, Harkon drehte sich um. Das Wolfsheulen war verstummt. Der Graue, der ihm seit Tagen folgte, trabte jetzt heran. Sein Blick war noch unsicher, seine Haltung geduckt. Aber er lief ohne Zögern auf Wakan Tanka zu und leckte ihm winselnd die Hand. Der Alte streichelte dem Tier beruhigend über den Kopf. „Folge ihm. Er wird dich leiten. Aber verlier nicht seine Spur, sonst findest du nie zurück.“
Wie auf ein Stichwort drehte sich der Wolf um und verschwand in den dunklen Schatten des Waldes. Unschlüssig starrte Harkon ihm nach.
„Worauf wartest du, Krieger. Fürchtest du dich in der Nacht? Oder fürchtest du, nicht würdig zu sein?“ Zweifel nagten an Harkon. Das war doch sicher nur ein Traum: ein Boot, das aus dem Mond kam; ein Wolf, der ihn führen sollte. In diesem Moment kam der graue Rüde zurück, blieb am Waldrand stehen und stieß ein langgezogenes Heulen aus, das wie eine Aufforderung klang. Harkon zuckte die Achseln. Was hatte er schon zu verlieren? Und wenn es sowieso nur ein Traum war ...? Er lief los. Als der Wolf sah, dass ihm der Krieger folgte, verschwand er wieder im Wald und blickte nicht zurück. Es lag an Harkon, ihn nicht aus den Augen zu verlieren und seiner Spur zu folgen.
Das Tier war verdammt schnell. Harkon hatte Mühe, Schritt zu halten. Das Gelände war unwegsam. Überall feuchtes Laub und Moos, aus der Erde herausragende Baumwurzeln, tief hängende Äste und Dornengestrüpp. Er kannte sich hier nicht aus und seltsamerweise lieferten selbst seine nachtsichtfähigen Augen kein klares Bild seiner Umgebung. Beinah blind wie ein Maulwurf folgte er dem Geruch des nassen Hundefells, in der Hoffnung, dem richtigen Ziel nachzueilen. Gerade als er befürchtete, seinen Führer aus den Augen verloren zu haben, stolperte er über den Rüden und fiel Wakan Tanka direkt in die Arme.
„Immer langsam, mein junger, ungestümer Freund.“ Wakan Tanka lächelte milde. Wie war der Alte so schnell hierher gekommen?, fragte sich Harkon. Aber für Fragen ließ der Indianer ihm keine Zeit. Er deutete auf eine Stelle zwischen den Felsen. Als Harkon zögerte, nickte er ihm aufmunternd zu, seine Hand in den schmalen Zwischenraum zu stecken. Der Wolf beobachtete hechelnd, wie Harkon der Aufforderung nachkam und vorsichtig in dem Spalt tastete. Harkon fühlte samtige Blütenblätter und feuchtes Moos, das wie ein Schwamm unter seinen Fingern nachgab. Er löste das Gebilde mit seinen Fingern und holte es hervor. Der Indianer hielt ihm einen ledernen Beutel hin.
„Es ist die erste der Pflanzen, die du brauchst. Senkt das Fieber. Kühlt das Blut.“ Dann schnürte er den Beutel sorgsam wieder zu und gab ihn dem Wolf ins Maul, der seinen Weg augenblicklich fortsetzte. Harkon blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen, bis er an einem kleinen Bachlauf den zweiten Halt einlegte. Wakan Tanka war auch hier bereits zur Stelle und wies ins Wasser, wo der graue Rüde schon bis zum Bauch im Nass stand und nach etwas grub. „Dort auf dem Grund, tief im Lehmboden, findest du eine schwarze Wurzel. Gib Acht, sie hat Stacheln wie ein Igel. Doch ihr Fleisch ist gut gegen einen trüben Geist und böse Bilder.“
Harkon zögerte diesmal nicht, sondern zog seine Stiefel aus und watete ins eiskalte Wasser, das ihm bis knapp über die Knie reichte. Fragend schaute er den Wolf an, der seinen Blick erwiderte und dann mit schräg geneigtem Kopf und gespitzten Ohren auf die Stelle schaute, wo er gegraben hatte. „Wenn du meinst, dass wir hier richtig sind“, sagte Harkon zu dem Tier. Der Rüde kippte lediglich den Kopf zur anderen Seite und knurrte auffordernd. Harkons Finger gruben sich tief in den Lehmboden, das Wasser brach sich an seinen Schultern und strömte ihm eiskalt in den Hemdkragen. Glitschiges, nasses Erdreich flutschte durch seine Hände. Plötzlich stach ihn etwas in den Finger. Überrascht schrie er auf, was Wakan Tanka mit einem Lachen kommentierte. „Hat der Igel dich gebissen, ja? Sei nett zu ihm und streichle sein Stachelkleid. Dann beißt er nicht mehr.“
Harkon wühlte vorsichtiger an der Stelle weiter, ertastete das harte Wurzelgebilde und grub es behutsam frei. Er war nass bis auf die Haut, als er wieder an Land kam, den Wolf an seiner Seite. Das Tier schüttelte sich das Wasser aus dem Fell, nahm dann den Lederbeutel auf, den es am Ufer abgelegt hatte und brachte ihn zu Wakan Tanka. Abermals hielt der Alte Harkon den Beutel hin, der die Wurzel hineinfallen ließ.
Der Wolf knurrte ungehalten, während Harkon seine Stiefel schnürte, und war dann auch schon wieder auf dem Weg. Harkon musste sich beeilen, um hinterherzukommen. Der nächste Halt war vor einer großen Höhle, die wenig einladend wirkte und einen starken Geruch nach Fäulnis und Exkrementen verströmte.
„Keine Angst, mein Krieger. Der Bär ist nicht zu Hause“, beruhigte ihn der Indianer. „Aber er wacht über einen Pilz, der schwarz wie ein Rabe ist. Den musst du holen. Er frisst das Gift.“
„Wie soll ich den denn finden, da drin ist es stockfinster!“
„Oh, ich weiß, du hast gute Augen, Harkân. Tief in der Höhle musst du suchen. Und dann komm zurück zu deinem Lager.“
Der Indianer war so schnell in der Dunkelheit verschwunden, dass Harkon nicht einmal mehr dazu kam zu antworten. Der Wolf schaute ebenso angewidert in den Höhleneingang, wie Harkon. „Es scheint, wir zwei sind uns ziemlich einig, wie?“, fragte der Krieger den Rüden. Der antwortete mit einem knappen Wuff, lief dann aber in die Höhle hinein. Mit einem Anflug von Unwohlsein folgte Harkon ihm nach. Dabei ärgerte er sich über sich selbst. Er war ein Krieger, keine Memme. Hatte in Schlachten gekämpft und dem Tod auf vielerlei Weise ins Gesicht geblickt. Seine Unruhe angesichts einer so simplen Angelegenheit wie Pilze sammeln war lächerlich.
Energischen Schrittes ging er voran. Kein Funken Licht drang hier hinein. Er tastete sich vorwärts, stieß sich mehrmals den Fuß an kleinen Felsbrocken, trat ein paar Mal in etwas Weiches und wollte gar nicht wissen, was es war. Vielleicht Überreste eines Beutekadavers oder Bärenkot. Bei der Vorstellung, gleich mit seinen Händen am Boden nach diesen schwarzen Pilzen suchen zu müssen, wurde ihm übel. Plötzlich sah er einen schwachen Schimmer einige Schritte vor sich, den er zunächst für reflektierte Mondstrahlen hielt, die durch eine Öffnung in der Decke oder den Wänden der Höhle fielen. Er ging darauf zu. Doch das Licht bewegte sich. Viele winzig kleine Punkte tanzten einen munteren Reigen.
Sein haariger Freund stand daneben und beobachtete das Spiel verwundert und neugierig. Dabei ging sein Kopf ständig hoch und runter und hin und wieder versuchte er, nach einem der leuchtenden Punkte zu schnappen, was aber erfolglos blieb. Harkon beugte sich zu der Lichtwolke hinunter. Direkt darunter wuchsen in einem Kreis groß und prall die schwarzen Pilze. Drei einzelne, kleinere standen außerdem in der Kreismitte. „Die sind zu klein“, entschied er. Harkon streckte die Hand nach dem größten Pilz aus, aber blitzschnell löste sich eines der Lichter aus der Wolke und traf ihn schmerzhaft an der Hand.
„Autsch!“ entfuhr es ihm. Der Wolf winselte und trat zwei Schritte zurück. Der kleine Punkt hatte eine Form bekommen, ein winziges Gesichtchen blinzelte Harkon entgegen. Er fühlte sich an die Geschichten über Elfen und Feen aus seiner Kindheit in Skandinavien erinnert. Dieses Geschöpf hätte sehr gut so ein Wesen sein können. Aber das waren doch Kindermärchen, oder etwa nicht?
„Niemals den Kreis zerstören. Nimm aus der Mitte, du Narr.“
Das zarte Stimmchen passte nicht zu dem strengen Ausdruck im Gesicht der Lichtelfe, die sofort wieder als kleiner Feuerschweif in die Lichtwolke zurückschoss. Gehorsam nahm Harkon nur die drei Pilze, die in der Mitte des Ringes wuchsen, verstaute sie in der Brusttasche seines Hemdes und machte sich gemeinsam mit seinem neuen Freund auf den Rückweg zu seinem Lagerplatz.
Dort wartete Wakan Tanka bereits. Harkon gab ihm die Pilze, die der Indianer mit einem zufriedenen Nicken wiederum in den Lederbeutel fallen ließ, den er anschließend Harkon überreichte. „Du hast sie dir verdient. Nimm dies nun als ein Geschenk von mir und nutze es weise. Das Licht sei mit dir.“
Wakan Tanka kehrte zu seinen Ruderern zurück. Am Kanu angekommen, drehte er sich noch einmal zu Harkon um. „Ich will dir noch etwas geben, mein Krieger. Drei Bilder, die du in deinem Herzen verwahren sollst, bis der Tag für sie gekommen ist. Schließe deine Augen, öffne deinen Geist und sieh.“
Harkon gehorchte und schloss seine Augen. Er spürte den Wind auf seinem Gesicht, den Atem der Nacht. Plötzlich tauchte das Bild von Martin vor ihm auf, seinem Freund, den die Ascon flashsüchtig gemacht hatten, um ihn zu brechen. Das war für Harkon der stärkste Antrieb gewesen, das Gegenmittel zu finden. Mit tränenüberströmtem Gesicht drehte er sich um und ging. Wohin? Harkon streckte seine Hand nach dem Freund aus, doch das Bild verschwand. Das nächste zeigte Pater Bernhardt. Er lag friedlich schlafend auf seinem Altar, doch Blut tropfte in eine Schale am Boden. Harkon begann zu zittern. Sollte das etwa wirklich geschehen? Sein Freund, der Bewahrer, würde sterben? Das letzte Bild zeigte eine dunkle Straße in Las Vegas. Ein Schuss fiel, dann das Bild einer Frau, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Sie hatte kastanienbraunes Haar und blaue Augen, die starr vor Angst waren. Aus einer Wunde an ihrem Kopf sickerte Blut. „Sie musst du retten, denn sie ist dein Schicksal“, hörte er Wakan Tanka raunen. „Die anderen beiden kannst du nicht schützen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Sie sind bereits verloren.“
In diesem Moment krachte es laut und Harkon schoss wie von der Tarantel gestochen hoch. Ein großer Ast war im Feuer in zwei Stücke zersprungen, Funken stoben in den Nachthimmel. Aus dem nahen Wald erklang das Heulen eines Wolfes. Vor Erleichterung hätte Harkon beinahe angefangen zu weinen. Es war doch nur ein Traum. Kein Martin, der fortging, kein toter Pater Bernhardt. Aber dann gab es leider auch keine Heilmittel. Und wer war diese unbekannte Frau?
Die Luft war kälter geworden, seit er eingenickt war. Fröstelnd zog er die dünne Decke fester um seine Schultern und ging zu seinem Zelt hinüber, wo er tief in seinen Schlafsack hineinkroch und in einen unruhigen, aber traumlosen Dämmerschlaf fiel, der bis zum Morgengrauen anhielt. Ein Hecheln weckte ihn. Ein feuchtwarmer Atem, der nach nassem Hund roch und viel zu dicht vor seiner Nase war. Harkon öffnete träge die Lider und blickte in ein Paar dunkelgelber Augen, die zu dem jungen schlaksigen Wolfsrüden gehörten, der ihn durch die Black Hills begleitet hatte. Im ersten Moment leicht erschrocken, zuckte Harkon zurück. Das wiederum erschreckte das ängstliche Tier und mit einem Winseln stob es Richtung Wald davon.
„Gott, was für eine irre Nacht“, sagte Harkon. Gähnend kroch er aus dem Zelt. Das Feuer war niedergebrannt. Als er hinüberging, um es wieder anzuzünden, damit er sich zumindest einen Kaffee machen konnte, fand er einen ledernen Beutel neben der Feuerstelle, ganz ähnlich dem von Wakan Tanka, in den er letzte Nacht die drei Pflanzen gelegt hatte. Das Leder war feucht und wies Spuren von Reißzähnen auf. Harkon schaute zum Wald hinüber, wo der junge Wolfsrüde im Unterholz verschwunden war. Hatte er an diesem Beutel genagt, auf der Suche nach Futter? Und woher kam das Ding überhaupt? Vorsichtig öffnete er den Knoten und spähte hinein. Er goss etwas von dem Inhalt in seine Handfläche, verrieb es mit den Fingerkuppen und roch daran. Kein Zweifel, es war das gleiche Gemisch, das ihm auch Pater Bernhardt gegeben hatte. Das Gegenmittel gegen Borca, in einer ausreichenden Menge, um die Forschungen in seinem Institut fortzusetzen. Und obendrauf lagen die Pflanzen, die er selbst gesammelt hatte. Er hatte das Rohmaterial und das Gemisch. Schnell füllte er das kostbare Gut in den Beutel zurück und verknotete ihn sorgfältig. Er betrachtete ihn lange. Konnte das, was ihm passiert war, Wirklichkeit gewesen sein? Es grenzte an Zauberei, und an so etwas glaubte er nicht. Dafür war er schon zu lange auf Erden und hatte zu viel gesehen. Doch schließlich waren die Götterkulte ihm nicht fremd. Er wusste, was Schamanen, Hexen und Druiden mit ihren Gesängen und Kräuterzaubern bewirken konnten. Unschlüssig stand er eine Weile da, packte dann entschlossen seine Sachen zusammen und machte sich auf den Heimweg, den Schlüssel zum Heilmittel gegen die Flash-Droge in seinen Händen. Wie er dazu gekommen war, spielte keine Rolle mehr.
Aus dem Schatten des Waldes sah Kangee Maska – starker Rabe –, einer der letzten echten Schamanen der Lakota, dem jungen Mann nach, der an seinem Kraftort genächtigt hatte. Er war ein Suchender. Und die Vision war eindeutig gewesen. „Hast deine Sache gut gemacht, Loupe“, sprach er zu dem Wolf und kraulte dessen Kopf. Das Tier schloss die Augen und genoss die Zuwendung. „Den Rest können nur die Götter geben.“
„Die Suche“ ist in gekürzter Form im Herbst 2010 in der Anthologie „Wölfen auf der Spur“ unter der Herausgabe von Elli Radinger im Mariposa-Verlag enthalten. Ebenso wie viele andere Kurzgeschichten und Gedichte über diese faszinierenden Tiere.
04. Nov. 2009 - Tanya Carpenter
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



