
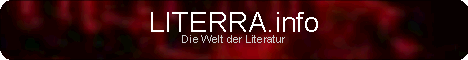
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Robin Gates > Phantastik > Der die Toten jagt |
Der die Toten jagt
von Robin Gates
Wenn jemand von Berenda hätte wissen wollen, ob dieser in seinem langen Leben vom Erfolg verwöhnt gewesen sei, hätte er vermutlich über eine so dumme Frage dröhnend gelacht. Er hatte drei Ehefrauen überlebt, doppelt so viele Kinder gezeugt – die erblosen Bastarde mit Mädchen aus dem Gesinde nicht gerechnet – und dank seines Geschicks als Kriegsherr seinem Clan die Vorherrschaft über die Provinz Norad in Runlands Norden gesichert. Kein schlechtes Leben für den Sohn bettelarmer Bauern, der sich rücksichtslos bis auf den Thron gekämpft hatte. Aber war er in all den knapp sechzig Jahren glücklich gewesen? Diese Frage hatte ihm nie jemand gestellt, am allerwenigsten er sich selbst. Mit gefurchter Stirn starrte er vom Fenster seines Schlafgemachs zum Mond hinauf, dessen dünne Klinge die Nacht durchschnitt. Eigenartig. Er hätte schwören können, dass erst vor zwei Tagen der helle Schein des Vollmonds auf die hölzernen Palisaden seiner Burg herabgeschienen hatte. Aber was da oben am Spätherbsthimmel hing, deutete auf einen baldigen Neumond hin.
Berenda kratzte sich nachdenklich seinen grauen Stoppelbart, schlüpfte in seine Tunika und zog die schweren Stiefel an. Beinahe hätte er dabei den Nachttopf neben dem Bett umgestoßen, den er eben, als er vom Drang zum Wasserlassen aufgeweckt worden war, zur Hälfte gefüllt hatte. Er war es leid, dass seine Familie und die verdammten Quacksalber, die sie ihm seit Monaten auf den Hals hetzten, ihn wie einen Schwerkranken behandelten. Hier stimmte etwas nicht, und er würde dem auf den Grund gehen! Entschlossen öffnete er die Tür zu Corvins Zimmer. Sein Sohn würde ihm die Wahrheit sagen.
Doch der Raum war leer.
Berendas Unruhe wuchs, während er durch die Burg schritt und in ein Zimmer nach dem anderen spähte. Was bei allen Geistern war hier los? Carn Sedal war völlig verlassen! Wohin waren alle verschwunden?
Er stolperte in den Hof der Burg. Auch hier war niemand zu sehen. Das Tor stand weit offen. Die Mägde, seine Wachen, alle waren fort. Sogar die Ställe hatten sich gänzlich geleert. – Nein, nicht gänzlich. In der hintersten Box hörte er ein Stampfen. Er blickte hinein, und ein erleichtertes Lächeln erhellte sein Gesicht. Arsan war immer noch hier. Treuer alter Gaul! Er streichelte ihn, während der Kopf des Pferdes freudig gegen seine Schulter stieß. Wenigstens ein lebendes Wesen war noch in der Burg verblieben.
Berenda sattelte Arsan und führte ihn in den nächtlichen Hof. Er legte seine Lederrüstung an, die er schon seit über drei Jahren nicht mehr getragen hatte und inzwischen gehörig in der Bauchgegend spannte, und gürtete sein Schwert. Mühsam erklomm er sein geduldig stillstehendes Reittier. Er mochte vielleicht ein kranker alter Mann sein, der kaum noch allein in den Sattel steigen konnte, aber er würde herausfinden, was hier gespielt wurde! Wenn Carn Sedal völlig verlassen war, dann musste er eben zur nächsten Siedlung reiten. Irgendein Bauer hatte bestimmt gesehen, wohin sich seine Familie und die Besatzung der Burg aufgemacht hatte.
Er nahm die Zügel in die Hand, als er das Geräusch von Schwingen vernahm. Etwas Dunkles schälte sich aus der Finsternis der Nacht heraus ins Licht der brennenden Feuerstelle im Hof. Berenda erblickte einen pechschwarzen Vogel, groß wie ein Bussard, der auf dem festgestampften Lehmboden landete. Es war ein ausgewachsener Rabe. Furchtlos hüpfte das Tier bis dicht vor Arsans Hufe. Ein tiefes Krächzen hallte über den stillen Hof. Die Flammen des Feuers duckten sich wie unter einem Schlag und sprühten Funken. Berenda lief es kalt über den Rücken. Er erinnerte sich daran, wie seine Amme ihm als Kind gesagt hatte, wenn einer so ein Gefühl habe, dann sei gerade jemand über dessen Grab gelaufen. Unwillig schüttelte er den Kopf, um den Gedanken zu vertreiben. Aus einer Laune heraus beugte er sich zu dem Raben hinab, der ihn mit schiefgelegtem Kopf musterte, ohne zurückzuweichen.
„Na, welche Nachricht bringst du mir, schwarzer Geselle?“ Ihm fiel auf, wie heiser sich seine Stimme auf dem verlassenen Hof anhörte. „Kannst du mir verraten, wohin alle verschwunden sind?“
Der Vogel riss seinen dicken Schnabel auf. Die Federn an seiner Kehle spreizten sich. Er stieß ein hartes KRAA hervor, das sich wie eine tatsächliche Antwort auf die Frage des grauhaarigen Alten auf dem Pferd über ihm anhörte. Gleichzeitig sprang er ein wenig zurück und ließ ein weiteres tiefes Schnarren vernehmen. Berenda blinzelte überrascht. Hatte das Tier ihn am Ende verstanden? Wollte es ihm etwas zeigen?
Er lenkte Arsan auf den Raben zu, der sofort aufflog, nur um sich auf den Palisaden über dem offenen Tor niederzulassen und dem verwunderten Clansherrn erneut zuzukrächzen.
„Also gut“, murmelte Berenda, als spräche er mit sich selbst. „Dir zu folgen ist auch nicht weniger unsinnig als einfach aufs Geradewohl in die Nacht hinaus zu reiten. Weise mir den Weg!“
Der Rabe auf der Palisade beäugte ihn aufmerksam, stieß wieder einen Schrei aus und erhob sich in die Luft. Außerhalb der Burg landete er auf dem Feldweg, der aus der Anlage hinausführte. Berenda hielt mit seinem Pferd auf ihn zu, doch kurz bevor Arsan ihn erreichte, flog der Vogel auf, um gerade so weit zu flattern, dass er nicht völlig ins nächtliche Dunkel eintauchte. Auf diese Weise führte er den Reiter Stück für Stück den Feldweg entlang. Dieser verlief eine Weile über offenes Gelände, bis er sich einem bewaldeten Hügel näherte, der wie der Schädel eines glatzköpfigen Riesen mit dichtem Haarkranz aussah. Berenda kannte die Gegend gut. Der Hügel wurde von alters her die Totenhöhe genannt. Es ging die Sage, dass vor langer Zeit die Dunkelelfen, die in den Alten Tagen die Herrschaft über Runlands Norden besaßen, hoch auf dem Kamm des Hügels eine Schlacht gefochten hatten, wenn auch niemand mehr genau zu sagen wusste, gegen wen. Manche meinten, es seien Ungeheuer gewesen, die aus den Weiten des Weltenraums gekommen seien. Andere behaupteten, die Dunkelelfen hätten gegen ihre eigenen Schwestern und Brüder die Waffen erhoben. Die Leichen der Elfenkrieger und ihrer Gegner waren auf dem Schlachtfeld begraben worden. Nichts wuchs seitdem mehr dort oben.
Berendas geflügelter Führer verschwand zwischen den ersten Buchen im Unterholz. Misstrauisch um sich blickend, eine Hand fest um den Schwertknauf gelegt, die andere die Zügel haltend, tauchte der alte Krieger mit Arsan in die Schwärze des Waldes ein. Hier war es noch dunkler als auf dem freien Feld, und gleichzeitig auch lauter. Der Herbstwind fuhr durch die Kronen der Bäume, brachte die trockenen Blätter zum Flüstern und ließ selbst die dickeren Äste vernehmlich ächzen. Von dem Raben war nichts mehr zu hören und zu sehen.
Berenda fühlte sich mit jedem weiteren Schritt seines Pferdes hinauf zum Kamm der Totenhöhe unbehaglicher. Er war nie ein furchtsamer Mann gewesen. Angst hätte ihn nicht an die Spitze seines Clans gebracht. Aber noch niemals hatte er so deutlich das Gefühl empfunden, sich an einem Ort zu befinden, der ihn nicht willkommen hieß. Dennoch lenkte er sein Pferd weiter voran. Er wollte Antworten, und kein Ungeheuer oder Geist würde ihn davon abhalten, sie zu bekommen.
Er hatte gehofft, das bedrückende Gefühl einer unsichtbaren Bedrohung würde enden, sobald er nur aus dem Wald heraus war, wo die Äste mit knotigen Fingern nach ihm zu greifen schienen. Doch das Gegenteil war der Fall. Berenda hatte kaum den Wald verlassen, als der Wind frei von jeglichem Hindernis in heftigen Böen über die kahle Hügelkuppe fegte und ihm laut aufheulend in den Ohren gellte. Weiter unten auf den Feldern war er nichts weiter als ein unvermeidlicher Teil des Herbstwetters gewesen, aber hier oben auf dem Gipfel der Totenhöhe lieh er einem Chor von verlorenen Seelen seine Stimme. Wie in tiefster Verzweiflung heulte er laut auf, dann fiel er plötzlich zu dem heiserem Flüstern von Fieberkranken ab, um unvermittelt wieder mit dem wilden Kreischen gestaltloser Wahnsinniger aufzulachen, die das Leben dafür anklagten, dass sie keine Ruhe finden konnten.
Dem alten Clansherrn lief es bei dem Gedanken, dass unter ihm die Gebeine der toten Antara in der feuchten Erde lagen, kalt über den Rücken. Plötzlich mischte sich ein weiteres Geräusch unter das Heulen des Windes – das dumpfe Trommeln von Pfoten im schnellen Lauf. Er fuhr herum. Hinter ihm schoss ein riesiges schattenhaftes Etwas auf vier Pfoten aus dem Dickicht des Waldes heraus ins niedrige Gras der Hügelkuppe und genau auf ihn zu. Aus den Augenwinkeln bemerkte Berenda noch weitere Bewegungen. Da hatte ihn der erste Schatten schon erreicht und sprang knurrend an Arsan empor, der sich schrill wiehernd auf die Hinterläufe stellte, so dass er seinen Herrn beinahe abgeworfen hätte. Jetzt erkannte Berenda, was er vor sich hatte. Bei seinem Anblick traf ihn unvermittelt eisige Angst mit der Wucht eines Faustschlags. Er verstand nicht, was es war, das ihn so lähmte. In der Vergangenheit hatte er gegen furchteinflößendere Gegner als einen riesigen struppigen Hund gekämpft. Nur mit äußerster Mühe rang er seine Panik nieder. Sein Schwert fuhr aus der Scheide. Ein tiefes Knurren entkam dem Rachen des Hundes, der Berenda aus rot glühenden Augen anstarrte und nach ihm schnappte. Die Klinge des alten Kriegers pfiff herab, doch sie verfehlte den angreifenden Hund, der sich zurückfallen ließ, um Haaresbreite. Berenda holte zu einem weiteren Schlag aus, als ihn etwas hart zwischen die Schulterblätter stieß und aus dem Sattel riss. Heißer Schmerz fuhr ihm durch die linke Seite, mit der er am Boden aufkam. Seine Hand tastete vergebens nach seinem Schwert. Hinter sich vernahm er, wie Arsan in heller Angst wiehernd in den Wald davongaloppierte, verfolgt von den schwarzen Hunden. Derjenige, der ihn vom Rücken seines Pferdes geholt hatte, war mit vollem Gewicht auf ihn gesprungen. Sein hässlicher Schädel hing dicht über Berendas Gesicht. Geifer tropfte auf dessen Wangen herab. Die rollenden Augen des gewaltigen Viehs glühten in ihren Höhlen wie vom Wind angefachte Kohlen. Das Fell des Hundes stank übelerregend nach Verwesung und faulem, nassen Laub, als hätte sich der struppige Köter aus den Tiefen des Erdreichs an die Oberfläche gegraben. Doch das Schlimmste war die eisige Angst, die das unheimliche Tier gleich einem beißenden Raubtiergeruch verbreitete. Berenda fühlte sich von dieser Angst in einen unsichtbaren Schraubstock gezwängt, der ihm die Luft aus den Lungen presste und ihn seiner Kraft beraubte. Verzweifelt biss der grauhaarige alte Krieger die Zähne zusammen. Noch nie zuvor hatte er sich im Griff einer so entsetzlichen Panik befunden. Doch er hatte niemals seiner Furcht nachgegeben. Er würde es auch diesmal nicht tun. Seine Hände legten sich um den Hals des Hundes, der vorwärts stieß, um ihn mit seinen Zähnen zu erreichen, und stemmten sich gegen dessen Gewicht. Die Muskeln seiner sehnigen Arme, alt, aber noch immer kräftig, spannten sich an. Ein hässliches, dumpfes Knacken ertönte, und das grollende Geräusch tief in der Kehle des schwarzen Hundes verstummte. Berenda wälzte das Tier von sich herunter, wo es mit verdrehtem Genick liegenblieb. Keuchend atmete der alte Kriegsherr auf dem Rücken ausgestreckt ein und aus. Atemwölkchen stiegen von seinem weit offenen Mund auf.
Da spürte er, wie der Boden, auf dem er lag, unter dem Donner einer Vielzahl sich rasch nahender Hufe zu beben begann. Berenda fühlte sich so erschöpft, dass er kurz mit dem Gedanken spielte, einfach liegenzubleiben, egal, was nun als Nächstes auf dem Kamm der Totenhöhe erscheinen mochte. Doch wieder trieb ihn der alte Kampfgeist an, der ihn ein Leben lang vorangetrieben hatte. Mühsam stand er auf und ergriff sein Schwert, das sich inzwischen doppelt so schwer anfühlte.
Als er aufblickte, stockte ihm der Atem. Eine Gruppe von etwa dreißig, vierzig Reitern schälte sich aus dem Wald heraus und preschte genau auf ihn zu. Doch das war nicht das Furchterregendste an ihnen. Reiter wie Pferde schienen aus Mondlicht geformt zu sein, silbrig leuchtende Schemen, hinter deren halb durchsichtigen Umrissen der den Hügelgipfel umgebende Wald zu erkennen war. Das donnernde Schlachtengebrüll, mit dem sie auf ihn zustürmten, war allerdings alles andere als schemenhaft.
Es war ihm unmöglich, dieser wilden Schar auszuweichen oder ihr noch rechtzeitig ins Dickicht zu entkommen. Berenda wusste, dass er diesmal geschlagen war. Nun, wenigstens starb er so, wie er es sich immer gewünscht hatte, aufrecht und mit seinem Schwert in der Hand. Er blieb stehen, wo er sich aus dem Gras aufgerichtet hatte, und erwartete die geisterhaften Reiter. Der Vorderste von ihnen hielt direkt auf ihn zu, ohne sein Pferd zu zügeln. Ein markerschütternder Schrei entfloh seiner Kehle.
Doch er kam nicht dazu, Berenda niederzureiten. Pfeilgeschwind tauchte ein großer schwarzer Vogel aus der Nacht über ihnen herab und segelte dem Herrn des Geisterpferds dicht an seinem silbrig durchscheinenden Gesicht vorbei. Wieder und wieder flatterte er krächzend um dessen behelmten Kopf, so dass dieser sein Reittier im vollen Galopp dicht vor dem alten Krieger zügeln musste. Hinter ihm schrien seine Kameraden ihren Pferden Befehle zu und hielten ebenfalls mühevoll an, um nicht miteinander zusammenzustoßen.
Berenda erkannte den Vogel, der den Vordersten der Reiter angehalten hatte, sofort wieder. Es war der Rabe, der ihn an diesen Ort geleitet hatte. Das Tier hatte inzwischen auf der Schulter des Reiters Platz genommen und hielt seinen Schnabel dicht an dessen Ohr. Der schemenhafte Krieger lauschte dem tiefen, volltönenden Krächzen des Vogels so aufmerksam, als höre er sich den Bericht eines Untergebenen an. Berenda musterte die beiden angespannt. Sein Blick glitt von der uralten, kunstvoll verzierten Rüstung der Erscheinung über deren glattes, pechschwarzes Haar unter dem Helm mit dem Nasenschutz und ihre fremdartigen Gesichtszüge. Mit einem Mal dämmerte ihm, wen er da vor sich hatte.
„Fenwyrn“, flüsterte er.
Der Krieger stieg in einer fließenden Bewegung von seinem Pferd, während der Rabe, der ein wenig mit den Schwingen flatterte, auf dessen Schulter sitzen blieb. Dicht vor Berenda blieb er stehen, ein Hüne, der den alten Clansherrn um mehr als einen Kopf überragte. Die anderen Reiter lenkten ihre Pferde um die beiden Männer herum und umringten sie mit gezogenen Waffen.
„Du kennst meinen Namen“, sagte der geisterhafte Krieger. Er klang nicht im Mindesten menschlich, auch wenn Berenda seine Worte verstehen konnte. Der Hüne hörte sich an, als ob das Brausen des Windes eine Stimme erhalten hätte.
„Jedes Kind in Runlands Norden kennt die Geschichten vom Grauen Widder und der Anusiya, seiner Leibgarde“, murmelte Berenda dumpf, als spräche er mit sich selbst. Es fiel ihm noch immer schwer, zu glauben, dass ihn die Geister der mächtigsten Krieger der Dunkelelfen aus den Alten Tagen umringten. Nicht alle waren Antara. Hinter Fenwyrn erkannte er unter den Reitern auch eine barhäuptige Frau, der ihr helles Haar tief in den Rücken fiel. Stumm betrachtete sie ihn, ihr Schwert in der Hand.
„Dann weißt du, dass sich die Anusiya nicht aufhalten lässt“, klang die brausende Stimme des Geisterkriegers in seinen Ohren. „Wenn sich das Jahr seinem Ende zuneigt, verfolgen wir für alle Zeiten durch Wald und Feld das, was sich überlebt hat. Wir reißen es mit uns in die nächste Welt. Das ist unsere Bestimmung, die uns jener mit dem Hirschgeweih auferlegt hat, Er, der die Toten jagt.“
„Ich ... ich bin nicht tot“, entgegnete ihm Berenda heiser.
Fenwyrn stieß ein grässliches Lachen aus, in das nach und nach alle seine Krieger einstimmten. Sie hörten sich an wie ein Rudel Wölfe, das den Mond anheulte.
„Du bist im Schlaf gestorben, alter Mann“, sagte der Anführer der Anusiya, als das Lachen allmählich verklang. „Du wurdest ehrenvoll zusammen mit deinem Pferd auf einem Scheiterhaufen verbrannt, und deine Asche vermischt sich mit der schwarzen Erde dieses Landes, während wir hier miteinander sprechen.“
Er beugte sich zu Berenda hinab, und im Sternenfeuer seiner Augen lag die kalte Notwendigkeit allen Lebens, seiner Bestimmung zu folgen. „Du bist unsere Beute, wie alles, was tot und vergangen ist.“
Seltsamerweise verspürte Berenda kaum Überraschung oder Trauer, als er Fenwyrns Worte vernahm. Endlich ergab alles, was er zuletzt erlebt hatte, einen Sinn. Es war gut so. Er war bereit, diese Welt zu verlassen.
Der Rabe auf der Schulter des Antara machte sich mit einem vernehmlichen Schnarren bemerkbar. Fenwyrn straffte sich. „Aber jemand hat zu deinem Gunsten gesprochen. Mir wurde berichtet, dass es im Leben dein Wunsch war, mit dem Sturm zu reiten. Ist dies so?“
Berenda blickte in die schwarz glänzenden Kieselsteinaugen des Raben, die ihn aufmerksam betrachteten. Und mit einem Mal dämmerte ihm, wer sich hinter dieser Tiergestalt verbarg. Langsam nickte er. Tatsächlich hatte er seinem Sohn mehrmals scherzhaft gesagt, dass ihm im Nachleben der sturmumtoste Herbstwald lieber wäre als die sonnigen Wiesen des Sommerlandes.
Der Anführer der Geisterschar deutete auf den toten Hund im Gras. „Seit mehr als hundert Jahren ist es keinem mehr gelungen, einen meiner Hunde zu überwinden, deren Name Furcht ist.“ Bei seinen Worten begannen die Beine des Tieres zu zucken. Der Hund erhob sich unverletzt vom Boden und schüttelte sein struppiges Fell, bevor er zu Fenwyrn trottete und ihm die Hand leckte.
„Wir können einen Krieger wie dich in unseren Reihen gebrauchen. Willst du dich uns anschließen?“
Berenda warf dem Raben einen Blick zu, der mehr an tiefer Dankbarkeit enthielt, als es jeder wortreiche Abschied vermocht hätte. Dann sah er Fenwyrn fest in die Augen.
„Das ist mein Wunsch.“
Wie auf einen unhörbaren Befehl hin begannen die Reiter mit den Schwertern auf ihre Rundschilde zu schmettern. Die Stimme ihres Anführers übertönte den Lärm.
„Dann soll es so sein, Berenda! Jage mit uns zwischen den Sternen, von Ewigkeit zu Ewigkeit!“
Laut krächzend flog der Rabe von Fenwyrns Schulter auf und begann die Reiterschar zu umkreisen. Der Anführer der Anusiya hob die Hand, und seine Krieger wichen zurück, um einem reiterlosen Pferd Platz zu machen, das aus dem Wald herausgelaufen kam. Wie die übrigen Pferde schimmerten die Umrisse seiner durchscheinenden Gestalt silbern in der Nacht. Freudig wiehernd rannte Arsan auf seinen Herrn zu, dessen Gestalt inzwischen selbst durchsichtig zu werden begann. Der Alte bestieg ihn, und lenkte ihn unter die geisterhafte Schar. Augenblicke später erfüllte der donnernde Hufschlag der Anusiya die Nacht und vermischte sich mit dem tiefen Bellen der Hunde und dem Heulen des Sturms.
Corvins Hand tauchte in die warme Asche ein. Eine noch müde Sonne blickte durch Nebelschleier auf die Überreste des Scheiterhaufens herab. Der junge Mann mit dem schulterlangen, braunen Haar richtete sich auf dem steineren Thron auf. Nachdenklich spielten seine rußigen Finger mit dem bleichen Rabenschädel, der an einem Lederband auf seiner nackten Brust hing, und schwärzten ihn dabei.
Es war ein gefährliches Unterfangen gewesen, seinem Vater dabei zu helfen, sich dessen Herzenswunsch zu erfüllen. Lebende Wesen stellten sich dem Geisterheer besser nicht in den Weg, wenn sie ihre Gesundheit oder ihren Verstand behalten wollten. Doch es war ihm geglückt, dem Sturm davonzufliegen, der Berenda sich gerissen hatte. Corvin hatte nicht umsonst zu den besten Schülern seines Perhannan-Lehrers gezählt. Nun war ein Schamane der Herr von Norad, der einzige Sohn des alten Kriegsherrn, der ihn überlebt hatte.
Was hatte ihm sein Vater einmal erzählt? In der Welt der Menschen, bevor diese nach Runland gekommen waren, hatte es einen einäugigen Gott gegeben, auf dessen Schultern zwei Raben saßen. Der Name des Einen der beiden Raben war „Erinnerung“ gewesen.
„Ich werde mich immer an dich erinnern“, sagte er leise. Hoch über ihm durchschnitt das Krächzen von Krähen die Morgenluft, eine Antwort auf den Schwingen des kalten Herbstwinds. Wo auch immer sein Vater sein mochte, Corvin war überzeugt: Er war glücklich.
21. Jan. 2011 - Robin Gates
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



