
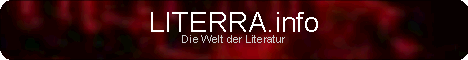
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Achim Stößer > Belletristik > Die Erdbeerdiebin |
Die Erdbeerdiebin
von Achim Stößer
Die Regenwand raste vorwärts, jagte die Straße entlang, peitschte flechtenbewachsene Dachziegel und staubbedeckten Asphalt. Schwere Wassertropfen prasselte auf die Dächer der radlosen Autowracks, die an den Bordsteinkanten kauerten. Als wären die Wolken mittendurchgeschnitten, kam der Regen auf Jasmina zu, klatschte auf ihren Kopf, ihre Schultern, ihre Brust, ihren Rücken, ihre Beine, durchnäßte ihre Haare und Kleider von einem Augenblick zum anderen. Hier und da huschten Menschen vorbei, suchten Schutz in Torwegen, Resten überdachter Hinterhöfe, Kellerräumen, und schon fielen die ersten Graupeln. Jasmina lief auf die Überbleibsel eines zahnsteingelben Mercedes zu. Rost fraß am Lack der Türunterseiten; die Tür ließ sich nicht öffnen. Schloßen, groß wie Kirschkerne, beschossen Jasminas Beine, als sie sich durch die leere Fensterhöhle der hinteren Wagentür wand. Obwohl es Mitte März war, hatte es lange keine Wolken und erst recht keinen Niederschlag mehr gegeben. Geschneit hatte es seit Jahren nicht mehr; Sturm und Hagel waren die einzige Abwechslung von dumpfer, erstickender Hitze.
Die Hagelkörner waren inzwischen taubeneigroß. Jasmina lehnte sich gegen den nach vorn geklappten Fahrersitz, möglichst weit entfernt vom Heckscheibenrahmen, durch den Eiskugeln fielen, die auf dem Rücksitz hüpften oder klackend mit anderen Eisbrocken zusammenstießen. Wie auf eine Blechtrommel hämmerte der Hagel aufs Dach. Obwohl die Luft warm war, klebten Jasminas Haare und ihr Hemd klamm an Schultern und Rücken. Sie wrang ihre Haare aus, dann riß sie die oberen Hemdknöpfe auf und zog den Kragen vor und zurück, um ein wärmeisolierendes Luftpolster zwischen Stoff und Haut einzuschließen. An ihrem Hals baumelte im Rhythmus der Bewegung an einer Kette, eingefaßt in billiges Holzimitat, das Bildnis der Heiligen Maria Magdalena.
Draußen schmolzen die Hagelkörner augenblicklich, sobald sie mit der heißen Makadamdecke in Berührung kamen. An den Sohlen von Jasminas bloßen Füßen klebte der in eine Schlammkruste verwandelte Straßenstaub. Der Schlamm und ihre Haut begannen zu trocknen; als sie über ihre Arme strich, rieselten epidermale Hornschuppen wie Kunststoffflöckchen in einem Schneegestöberbriefbeschwerer auf ihre Shorts.
Betonbrocken, aus denen rostige Stahlstäbe ragten, lagen draußen, Überreste der Berliner Mauer vielleicht, oder aber nur Trümmer eines Gebäudes. Die Berliner Mauer war eine Sehenswürdigkeit wie die Chinesische, wenn auch als Sparversion, vom Weltraum aus nicht so leicht zu erkennen. Ein großer Teil, rund dreißig Kilometer lang, war nachgebildet oder wiederaufgebaut, ein lächerlich winziges Stück, verglichen mit dem über hundert Mal so langen, bis zu zehn Meter hohen und acht Meter breiten Schutzwall, der zweitausenddreihundert Jahre zuvor während der Chou-Dynastie zur Abwehr von Überraschungsangriffen der Reiternomaden der Steppe und zum Schutz vor chinesischen Nachbarstaaten errichtet worden und der seit der Ming-Dynastie, seit dem 15. Jahrhundert also, nahezu unverändert geblieben war. Berlin war ein riesiger Leib, ein Leichnam, zum großen Teil verwest, nur hier und da noch ein zuckendes Augenlid, eine sinnentleert funktionierende Milz.
Im Süden, wie ein erdbeerrot elektrolytlackierter Finger, das alles überragende Connex, dessen neo-barocker Stil dem neuen Schloß auf dem ehemaligen Marx-Engels-Platz und den anderen umgebenden Gebäuden angepaßt war; und nicht nur sein Äußeres war barock wie Marmorattrappen aus bemaltem Gips: Kinos und Simulacra, Bars mit Designerdrogen und Alkohol fanden sich darin - die unmittelbar sinnlich erlebte und zugleich idealisierte Wirklichkeit, Illusionen, vorgetäuschte Wahrnehmung aus zweiter Hand.
Langsam rollte mit rasselnden Ketten ein Lastpanzer vorbei. Noch immer hingen an den Litfaßsäulen und Plakatwänden Fetzen monatealter Wahlplakate. Einige der Weißlichthologramme waren überklebt mit Spruchbändern aus einfarbigem, schwarzem Papier mit weißen Druckbuchstaben, zwei Zeilen, gezeichnet mit einem eingekreisten A, die üblichen, nutzlosen Parolen: Wenn wir wirklich die Wahl hätten, gäbe es ein Bundesgesetz dagegen. Für etwas anderes als für Parteien und Politiker zu werben, lohnte sich in dieser Gegend nicht, denn die wenigen Leute, die noch nicht aus den abbruchreifen Häusern vertrieben worden waren, besaßen nichts als die Kleider auf ihrer dermatösen Haut und ihre Wählerstimme. Die Gebäude hier waren verfallen, Spekulanten ließen große Stadtgebiete bewußt verkommen, während sich in anderen Vierteln die Menschen auf die Zehen und wohl auch auf die Finger traten. Jasmina waren die Plakate gleichgültig. Erst in vier Jahren, mit zwanzig, würde sie wählen dürfen. Falls sie noch so lange lebte.
Beim Anblick des signalfarbenen Turms kam Jasmina eine Idee. Nicht weit von hier, in der Jungfernheide, befanden sich Erdbeerfelder ... und morgen würde Ferdinand zehn Jahre alt.
Das Trommeln auf dem Wagendach war weicher geworden, der Hagel leichtem Nieseln gewichen. Jasmina stieg aus dem Wrack, patschte durch schlammige Pfützen, stieg über Exkremente, leere, plattgedrückte Wasserdosen, Trümmer eingestürzter Häuser, schmutzige Plastiktüten, umrundete einen halb skelettierten Pukokadaver mit räudigem, schwarzem Fell, lief die Bernauer Straße entlang, Richtung Wedding.
H1Am Rand der Müllhalde Spandau stand das Haus, in dem Jasmina wohnte. Oder es stand vielmehr auf der Halde, dem alten Teil, dem Gebiet, das über das Ufer hinausragte, dort, wo die Menschen, die Bewohner der Halde, aus Müll ihre Heimat aufgebaut, wo sie dem nagenden Meer wieder Quadratmeter um Quadratmeter abgetrotzt hatten. Das Berliner Binnenmeer, das dicht an der Stadt lag, führte wie ein einhundertdreißig Kilometer langer Kratzer von Neubrandenburg bis zu einem Punkt westlich von Potsdam. An der breitesten Stelle maß es fünfundzwanzig Kilometer und war bis zu zwanzig Meter tief. Achtzehn Milliarden Kubikmeter Erde waren verdampft, die geschmolzenen und gesinterten Reste bildeten ein wasserundurchlässiges Bassin. Ein Untersuchungsausschuß hatte allerdings festgestellt, daß nicht ein technischer Fehler, sondern menschliches Versagen die Ursache gewesen war.
Fünf Tangfischerboote dümpelten an einem Kai; gewöhnlich liefen sie nachts aus, denn tagsüber war es für die Ernte zu heiß. Ein paar hundert Meter weiter draußen, unter Wasser, lagen die Überbleibsel von Falkensee. Ein, zwei Dutzend Kinder waren zu sehen, die über die Müllberge stapften, darin herumstocherten, sich nach dem einen oder anderen Brocken bückten und ihn in eine Tasche oder den Mund steckten. Verwertbare Gegenstände, Obst- und Gemüsereste und eßbare Verpackungen wurden aufgelesen; übrig blieben neuzeitliche Kjökkenmöddinger, die statt Austernschalen und Tierknochen Konservendosen und ausrangierte Elektronikteile enthielten. In sicherer Entfernung hüpfte gurrend, scharrend und pickend, wie um sie nachzuahmen, eine Schar stummelflügliger Tauben durch den Abfall. Tauben, Zwergmöwen und Ratten waren eher Nahrungskonkurrenten als jagbares Wild für die Bewohner der Müllkippe, zumindest für die menschlichen. Ganz in der Nähe keckerte einer jener einzelgängerischen, sonst eher scheuen Puschas, Kreuzung aus Pudel und Goldschakal. Das Tier mit füchsischem Gesichtsausdruck war jung, sein Fell schwarz und glatt, wies kaum die unregelmäßigen, andersfarbigen Flecken älterer Puschas auf. Gerade hatte es einen Rattenkönig ausgegraben, warf die hilflosen Nager mit unentwirrbar verwickelten und verklebten Schwänzen mit Schnauze und Pfoten herum, ehe es sich anschickte, sie aufzufressen. Ein süßlicher Geruch lag über der Halde, so allgegenwärtig, daß die Menschen, die hier lebten, ihn nicht mehr wahrnahmen; auch wenn sie den Müll verließen, haftete er noch lange in ihren Kleidern und Haaren, schien sich selbst in der Lunge eingenistet zu haben.
Das Haus - die Hütte - bestand aus Abfall. Die abblätternden Totenkopfsymbole an den Wänden ließen ihren Ursprung erkennen: aufgeschnittene und flachgewalzte Fässer aus Blech. Ihr Inhalt war schon lange je nach Konsistenz im Boden versickert oder mit anderem Abfall zusammengebacken und zu Wegen zwischen den Müllbergen festgetreten. Auf einer Seite der Hütte waren die Tonnen wabenartig aufgeschichtet, nach innen geöffnet und mit Zwischenböden versehen, als Schrank oder Regalwand. Die Zwischenräume waren mit geschmolzenem Plastikabfall ausgefugt. Billige Hologramme von HiPop-Stars und einigen Heiligen hingen an den anderen Innenwände. Das größte Bild zeigte einen schafsäugigen Jesus, eine Hand erhoben, die andere am strahlengespickten Herzmuskel in der offenen Brust. Das Herz zuckte rhythmisch, schien zu pochen. Es war durchbohrt, und eine Flamme züngelte heraus.
Weiße Polymerfolie bedeckte das flache Dach, um die brütende Tageshitze abzuhalten. Es war leicht geneigt, um das Wasser der seltenen Niederschläge, gefiltert durch eine Sandschicht, die radioaktiven Staub zurückhalten sollte, in ein Wasserfaß oder über ein Rohrgittersystem zu leiten, das gleichzeitig als Hagelschutz diente. So wurden die kümmerlichen Tomaten- und Tomoffelpflanzen und die beiden bonsaihaft verkrüppelten, kaum meterhohen Apfelbäume hinter dem Haus bewässert.
Hier, im Schatten, saß Jasminas Bruder, Ferdinand. Das Binnenmeer war lange vor seiner Geburt entstanden; so war es hier für ihn selbstverständlich, wie es eiszeitliche Endmoränen irgendwo in Norddeutschland gewesen wären, Bimsstein in Pompeji, graugrüne, gischtumspülte Betonklötze in San Francisco. Vor ihm auf dem Tisch aus einer über zwei Tonnen gelegten Aminoplastbohle standen mehrere säuberlich beschriftete Glasschalen aus den abgeschnittenen Böden zerbrochener Geschirrspülmittelpfandflaschen. NaClO3 stand auf einer; eine andere enthielt gewöhnlichen Zucker. Das Natriumchlorat stammte aus den Resten verschiedener Unkrautvernichtungsmittel; mit einem Löffel füllte Ferdinand davon in eine dritte Schale, in der sich bereits Zucker befand. Roten Phosphor hätte er dem Zucker vorgezogen, aber selbst Zucker war schon schwer genug zu bekommen. Wer benutzte heute noch Streichhölzer? Und wenn sie dann auf dem Müll landeten, waren die Köpfe natürlich abgebrannt. So kratzte er jetzt von sechs einzelnen Zündhölzern die Köpfe ab, zerstieß sie in einem Mörser und gab das Pulver zum Zucker. Daß die Zündholzköpfe keinen Phosphor enthielten, wußte er nicht. Die Stiele der Streichhölzer, die aus quadratischen Stückchen wachspapierähnlichen Materials zusammengerollt waren, bog er hin und her, um das Wachs zu lösen, und faltete sie auseinander. Sie würden ausgezeichnete Hüllen für Knallerbsen abgeben.
Die Zwillinge, Violetta und Vérénice, saßen in der Hütte auf einem Kunststoffcontainer, den sie nachts als Bett benutzten, und sahen fern. Der Fernsehschirm hing an der gegenüberliegenden Wand; das Bild war rotstichig, das Seitenverhältnis nicht verstellbar, und der Apparat war trotz einer Diagonalen von nur knapp dreißig Zoll fast fünf Zoll tief, aber immerhin noch voll funktionsfähig - mit das Beste, was sich im Sperrmüll finden ließ.
Im spärlichen Schatten eines der Apfelbäume lag in einer Wiege aus einer längshalbierten Tonne röchelnd Jasminas Baby; schleimige Blasen platzten mit jedem Atemzug in dem Loch in seinem Hals, durch das es atmete. Es war ein Mädchen, drei Monate alt und ohne Namen; ohnehin ein Wunder, daß es noch am Leben war, sinnlos, sich einen Namen auszudenken. Von Zeit zu Zeit verscheuchte Ferdinand die in metallischem Blau schimmernden Fliegen mit orangeroten Augen, die um Atemloch, Mund und Nase des Babys und die schwärende Wunde an seiner Schläfe krochen, indem er auf den Rand der Wiege trat, die zwei-, dreimal hin- und herschaukelte, während der Fliegenschwarm aufstob, verstört kreiste und beharrlich wieder landete.
Auf dem Bildschirm fuhren zehn oder zwölf meist schwarze Autos eine Straße entlang; ein beigefarbenes hielt mit quietschenden Bremsen vor einem Treppenaufgang. Der Beifahrer sprang heraus und rief dem Fahrer zu: „Laß' den Motor laufen, ich bin in einer viertel Stunde zurück.“ Dann lief er die Treppe hinauf. Es war ein alter Film, vermutlich sogar ohne Farbe aufgenommen.
Ferdinand warf durch die Türöffnung einen Blick auf den Schirm und fuhr auf, als er das wappenförmige Warner-Logo in der Ecke entdeckte. Vorsichtig setzte er die Schale, die er in der Hand hielt, ab, hastete ins Haus, öffnete eine Klappe am Apparat und dejustierte den Empfänger. Knirschend drehte sich die Parabolantenne auf dem Dach in eine andere Richtung. Das Bild wechselte, ein neues Signet erschien, ein Doppel-B oder eine stilistierte 33 - Ferdinand kannte das Zeichen nicht. Vom Teufel geritten, las er im Titelfenster des Bildschirms. Eine Stimme drang aus den Lautsprechern: „Sagen Sie Ihrem Bruder, wenn er nochmal jemanden erschießt, soll er sich in unserem Tal nicht mehr blicken lassen!“
„Ihr sollt doch nicht immer Warner einschalten“, wandte sich Ferdinand wütend an seine Schwestern, „sonst holt euch die Post!“ Es war zwar unwahrscheinlich, daß ein Interferenzmeßwagen der Post in der Nähe der Müllkolonie auftauchte, aber wenn, dann würden nur die Geräte der Schwarzseher beschlagnahmt; Warner empfangen aber hieß Lagerhaft. Gütersloh ließ nicht mit sich spaßen. Natürlich hatte jeder das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen frei zu informieren - nur galten die Sender der Administration nicht als allgemein zugänglich.
Violetta und Vérénice antworteten nicht, hatten es nie getan. Sie waren nicht stumm, manchmal sangen sie leise vor sich hin oder plapperten scheinbar ohne erkennbaren Zusammenhang Satzbruchstücke oder Sätze, meist in einer Sprache, die nur sie allein verstanden, doch ihre einzigen Lautäußerungen bestanden aus Echo- und Idiolalie.
Beide Zwillinge hielten eine Fernbedienung in der Hand, die zum Empfänger an der Wand paßte. Die Batterien waren schwach, aber es lagen ein paar Dutzend andere in einem der Wandfässer - der Müll war voll davon. Jetzt spielten die beiden ihr Lieblingsspiel: Sie drückten irgendwelche Tasten der Fernbedienung, um auf ein anderes Programm umzuschalten. Wegen der beiden sich widersprechenden Signale und der ausgelaugten Batterien dauerte es oft mehrere Sekunden, bis der Kanal umsprang, was jedesmal von einem freudigen Jauchzen Vérénices oder Violettas begleitet wurde.
Bilder und Töne, Sprecher und Stimmen wechselten: „- die Hälfte der Milch im Schokoladenüberzug der Lebkuchen durch Rinderblut ersetzt haben. Dies ist zwar gesetzlich erlaubt, aber kennzeichnungspflichtig -“, „- Verwendung von Blut kennzeichnungspflichtig, wenn auch ein durchaus gängiges -“, „- kuschlig weich und erfrischend kühl -“, „- Blut von Rindern fünfzig Prozent der Milch -“; nahezu wörtliche Übereinstimmungen, von Werbung abgesehen die gleichen Meldungen in allen Kanälen, natürlich, wozu sich die Mühe machen, die Texte der Nachrichtenagenturen mehr als nur umzuformulieren.
„Sie ist ein Mensch, der Schatten auf die Sonne wirft“, sage Vérénice unvermittelt, während Violetta den Mund öffnete und schloß, wie ein Goldfisch im Glas.
Obwohl es zahlreiche spezielle Sportkanäle und Sportsendungen in fast allen anderen Kanälen gab, waren die Sportmeldungen ein unverzichtbarer Teil der Nachrichten. Pelota oder Ringtennis, Biathlon oder Sumoringen waren interessanter als das Erdbeben in Datong, die Überschwemmung in Fujian, der Flugzeugabsturz über Biarritz, die Waldbrände in Kanada, selbst wenn diese noch einen gewissen Sensationswert hatten, im Gegensatz zu politischen Meldungen wie dem Umweltskandal und der Bestechungsaffäre in den Bundesländern Böhmen und Walachei oder der alte Krieg in einem Land, von dem viele nur wußten, daß sein Name mit einem I begann, manche nicht einmal das oder daß überhaupt irgendwo Krieg geführt wurde. Von größerer Bedeutung als die Sportergebnisse waren nur noch die Gewinnzahlen der staatlichen Lotterien, die Bargeld verlosten und Reisen, zusätzliche Wahlstimmen und Ankaufrechte für Wohnungen, um so allen, die mitspielten, vorzugaukeln, sie könnten irgendwann einmal das sorgenlose Leben führen, das sie aus Fernsehserien kannten, wenn das Glück nur mit ihnen wäre - und wenn sie Pech hatten, war die bestehende Verteilung von Reichtum und Armut ganz offensichtlich gottgewollt oder stand in den Sternen.
„Nun hört schon auf!“ sagte Ferdinand undeutlich, während er ein Vitamin-C-Bonbon in den Mund steckte. „Was soll denn das?“
„- nach einer langen Nacht, und freust dich -“ „- Auch einer der Bankräuber erlitt in dem gestohlenen Wagen, der förmlich in eine Anregungsflutwelle geraten war, schwere Verbrennungen -“, „- ein Auge und wird vermutlich sein Leben lang gelähmt -“.
Wortlos nahm Ferdinand seinen Schwestern die Fernbedienungen ab und legte sie demonstrativ neben sie.
„Die Menschen sind so notgedrungen wahnsinnig, daß nicht wahnsinnig zu sein eine andere Form des Wahnsinns bedeuten würde. Pascal“, sagte Vérénice.
„In deinen Adern fließt Milch“, behauptete Violetta. Ihre Lider flatterten.
„... blutige Geiseldrama von Alsdorf-Höngen, bei dem am 29. September 2087 zwei unschuldige Menschen, die von Bankräubern als Geiseln genommen worden waren, durch zahlreiche Schüsse aus Anregern der Polizei den Tod gefunden hatten, beschäftigt erneut die Justiz. Ab morgen müssen sich drei Polizisten wegen fahrlässiger Tötung vor dem Aachener Schwurgericht verantworten.“
„Andere Sender melden Verkehrsstaus“, warf Vérénice dazwischen, „bei uns heißt es: freie Fahrt auf allen Strecken. Rosat - der wirklich optimistische Kanal.“ Ihre Augen sprachen der Botschaft hohn, waren wie vor Entsetzen weit geöffnet.
„Den Polizisten wirft die Staatsanwaltschaft vor, sie hätten erkennen müssen, Zitat, daß der Einsatz von Anregungswaffen in der konkreten Situation unzulässig war, Ende des Zitats. Einem siebenundzwanzigjährigen Polizeiobermeister wird weiterhin zur Last gelegt, daß er über die Flucht der Räuber im Bild war, seine Kollegen aber weder davon unterrichtet, noch sie vor dem Schußwaffengebrauch gewarnt hatte ...“
Ferdinand trat zum Herd, auf dem in einem Dampfdrucktopf eine Suppe aus Zwiebeln und Kartoffelschalen kochte. Er schob ihn von der Kochplatte auf den Magnetrührer; der glasumhüllte Stabmagnet im Topfinneren scharrte am Boden. Ohne den Deckel geöffnet und somit dem kostbaren Wasser Gelegenheit zum Verdampfen gegeben zu haben, stellte er den Topf auf die heiße Platte zurück. Das Brot, das er am Morgen gestohlen hatte, würde, in die Suppe gebrockt, zwei Tage reichen.
Er nahm eine Flasche aus einem Wandgefäß, öffnete sie, bildete mit der hohlen Hand einen Flansch um Flaschenhals und Nase und atmete tief ein. Lösungsmittelschnüffeln war weit verbreitet, jedes Kind konnte geeignete Lösungsmittel beschaffen. Ferdinand verschraubte die Flasche und stellte sie zurück.
Ein bewegungsunscharfes Standbild aus einem von einer automatischen Kamera aufgenommenen Video hinter dem ausgestanzten Sprecher auf dem Fernsehschirm, weißbehelmte Polizisten vor einem Wagen mit teils geschwärzten, am Rand orangeglühenden Seitentüren, Blasen werfendem Lack, geschmolzenen Glasscheiben wie erstarrtes Wasser: „... Polizeibeamten aus ihren Anregungswaffen insgesamt über vierzig Schuß abgefeuert. Sie hatten offenbar geglaubt, alle vier Insassen des Wagens seien Bankräuber ...“ Es folgte ein entrüsteter Kommentar, der die Handlungsweise der Polizisten verurteilte, zugleich aber ausdrücklich die Verantwortung der Bankräuber betonte. Der Tenor verschiedener Zeitungsmeldungen wurde vorgebracht, die den Tod der Geiseln bedauerten. Ein Passant in einer Straßenumfrage sagte: „Wer ist denn Schuld daran? Diese Gangster! Die müßten für den Schaden aufkommen. Die Polizei hat doch nur ihre Pflicht getan. Sklavendienst leisten müßten diese Verbrecher, ihr Leben lang; das verdienen sie doch nicht anders“, „An die Wand stellen! Wer sich an fremdem Eigentum vergreift: zack! Rübe ab. Das ist meine Meinung“, ein zweiter und ein dritter: „Zwölftausend, soviel bekomme ich in drei Monaten nicht, und die wollen sie in ein paar Minuten zusammenraffen? So etwas müßte verboten werden.“
Zwölftausend Ecu. Ferdinand betrachtete den Brotlaib, der auf dem Tisch lag - und das Preisschild neben dem Barcode auf der Frischhaltefolie: €11,98.
Dann stellte er sich zehn solcher Laibe nebeneinander vor, zehn Reihen hinter- und zehn Schichten übereinander: Dafür waren die Polizisten bereit gewesen, vier Menschen zu töten, aber die Öffentlichkeit kümmerten natürlich nur die beiden Geiseln. Schließlich waren die anderen Entführer gewesen, Verbrecher. Ja, das waren sie, aber die Polizisten hatten nichts davon gewußt, versuchte Geiselbefreiung konnten sie nicht als Motiv vorschützen, sie hatten alle vier für Räuber gehalten. Vier Menschen, von denen jetzt zwei nicht mehr am Leben waren, wegen des Gegenwertes von zwei Kubikmetern Brot. Wenngleich da unbestreitbar eine Verbesserung war gegenüber einer Zeit, in der Kinder hingerichtet worden waren, weil sie einen Bissen Brot gestohlenen hatten.
Die Mädchen wiegten ihren Körper rhythmisch vor und zurück. Vérénice sagte: „Zwei Schilder am Weg der Menschheit: Einbahnstraße - und Sackgasse.“
„Wir müssen dem Verbraucher die blumenkohlartigen Gewächse an den Fischen eben schmackhaft machen“, erwiderte Violetta.
Ferdinand leckte über seine Unterlippe, die eitrig und geschwollen war; vor ein paar Tagen war sie aufgeplatzt, als der Stiefel eines Polizisten sie getroffen hatte.
Mit Ausnahme der blaßrosa Lippen wies die Latexhaut, mit der das Gesicht des Zimmerkellners verkleidet war, eine dunkelbraune Färbung auf. Überhaupt verlieh ihm die Maske mit zahlreichen Ziernarben, wie sie bei Tutsie der Oberschicht in Mode waren, und das künstliche schwarzgekräuselte Haar das Aussehen eines Afrikaners. Das Aussehen, wie der Durchschnittsaltweltler es erwartete; Dr. h. c. Franz X. Krautheim, bayerischer NSU-Subsidiaritätsminister, glaubte es besser zu wissen. Sein Ehrendoktor war ihm unter anderem für die wirtschaftlichen Kontakte, die er mit verschiedenen afrikanischen Stadtstaaten geknüpft hatte, verliehen worden. In der rwandischen Republika y'u Kigali beispielsweise hatte er vor allem die Milchwirtschaft gefördert, Rinder-, Schaf- und Ziegenzucht, aber auch die Fabrikation von Pyrethrum, einem „natürlichen“ Insektizid aus Wucherblumen, den Export von Kalktuffen aus Cyangugu, die für die Zementherstellung verwendet wurden, sowie K2O-haltiger Laven für die Düngemittelproduktion; und das wäre ihm unmöglich gewesen, ohne hin und wieder mit wirklichen Afrikanern zusammenzutreffen oder zumindest mit ihnen am Bildschirm zu konferieren; den Mwami des Royaume du Burundi, König Ntare, hatte er sogar mehrmals in der Hauptstadt Bujumbura getroffen, und so bildete er sich ein, feine Unterschiede zwischen den echten Tutsie und der Nachbildung zu erkennen, wenn er auch nicht den Finger darauf legen konnte, was es war. Doch dieser kleine Fehler störte ihn nicht, er verlieh ihm vielmehr ein Gefühl der Überlegenheit, ja der Allwissenheit, und er genoß es, dem Neurobot bei der Zubereitung der Garnelen zuzusehen. Mit einem Werkzeug, das an eine Zuckerzange erinnerte, nahm der Neuro die sich krümmenden Krustentiere vorsichtig aus der Soliportransportbox, um sie in einer bereitstehenden flachen Schüssel, die mit Weißwein gefüllt war, zu ertränken. Wie Zirkusakrobaten schnellten die Krebse hoch, schlugen einen Salto - weniger pietätvoll ausgedrückt: Salto mortale - und landeten wieder in ihrem Weinbad. Meist. Bei einigen drohte die Flugparabel neben der Schale, auf dem Tisch oder Boden zu enden, doch mit einer Schnelligkeit und Präzision, wie sie nur einer Maschine möglich ist, schnappte der Neuronale Roboter danach, pflückte sie mit der Zange aus der Luft und legte sie behutsam in die Weinschale zurück.
„Zimmerservice“, sagte Krautheim, ohne trotz aller Mühe, die er sich gab, seinen bairischen Akzent unterdrücken zu können, und seine Stimme wurde von dezent verborgenen Mikrophonen aufgefangen. „Ich möchte ein Bad nehmen.“
In jedem gewöhnlichen Hotel hätte der Appartementrechner das Bad eingelassen, doch nicht hier, wo Laserdrucke Katterli Frauenfelders an den Wänden hingen: Augenblicke später klopfte es an die Tür, und auf Krautheims Herein! betrat ein Zimmermädchenneurobot den Raum, dessen Latexhaut nur um eine Nuance heller war als die des anderen Neuros, glitt ins angrenzende Badezimmer und öffnete den Warmwasserhahn der Wanne von Hand.
Krautheim entnahm einer Schatulle, die auf dem Tisch stand, ein kreisrundes, rot-weiß rautiertes Pflaster, zog die Folie von der Klebefläche ab und setzte es sich in den Nacken, dann wandte er sich wieder den ertrinkenden Garnelen zu. Automatische Armaturen hätten nur ein paar Ecu gekostet, der Preis für diese beiden Neuronalen Roboter war dagegen durchaus mit dem eines Hove'Rolls zu vergleichen. Es war zudem reines Trinkwasser, das in die Wanne floß. Was Krautheim nicht verschwendete, war ein Gedanke daran.
Sein birnenförmiger Körper füllte die Höhlung des Sessels nahtlos aus. Die kurzen, dicken Beine wirkten geradezu winzig dagegen, staken wie vergessen und nachträglich hinzugefügt im Rumpf. Die Wirkstoffe im Pflaster durchdrangen die Haut, seine Pupillen begannen sich zu weiten. Er trug einen Kimono, zusammengehalten von einem Obi. Der kostbare Gürtel war nur lose vor seinem Bauch verschlungen.
Während Krautheim fasziniert die Garnelen beobachtet hatte, war die Pfeife, die in seinem Mundwinkel hing, erloschen. Der Kopf aus Bruyèreholz, dessen rot-orange Maserung an züngelnde Flammen erinnerte, wärmte kaum noch die Handfläche, an die er sich schmiegte. Das Holz stammte von den kopfgroßen Wurzelknollen eines dem Heidekraut verwandten, strauchähnlichen Gewächses; die Pfeife war eine echte Sixten Ivarsson.
Überrascht bemerkte Krautheim, als er wieder am Mundstück sog, daß kein Rauch mehr aus der Öffnung drang. Er nahm das Pfeifenfeuerzeug vom Tisch und entzündete den Tabak erneut. Die Gravur im Gold des Feuerzeugs zeigte das Wappen der Elfenbeinküste, dessen Schöpfer das längst ausgestorbene Wappentier, nach den zusammengekniffenen Augen zu schließen, nach einem toten Modell porträtiert haben mußte, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch lebende Exemplare gegeben hatte. Krautheim legte das Feuerzeug zurück auf den Tisch, sog an der Pfeife und nippte dann an seinem Apéritif, einem Gin Tonic.
Durch die Wand aus phototropem Glas, die jetzt wegen der Bewölkung kaum abgedunkelt war, sah er den roten Turm, der wie es schien die Wolken anzukratzen versuchte. Warner Bothers hatte bereits im vergangenen Jahrhundert damit begonnen, solche „Begegnungszentren“ zu errichten. Die Kinos und Bars in den Warner-Multiplexen waren bald zweitrangig geworden - Nebenprodukte machten das Hauptgeschäft aus. Wenig später hatte Bertelsmann nachgezogen, und inzwischen bildeten diese beiden Konzerne die wichtigsten Regierungstrusts: Warner-Time nannte sich Administration West; die Regierung Altwelt hatte ihren Sitz in Gütersloh. Die meisten ehemaligen sowjetischen Splitterrepubliken spielten wirtschaftlich und damit politisch ebensowenig eine Rolle wie Australien, das ein bißchen unabhängig und, wenn auch nicht de jure, so doch de facto ein bißchen britische Kronkolonie war, oder die wie Algen wuchernden Stadtstaaten in Afrika und Südamerika. Neben dem neusozialistischen Sibirien, der Kornkammer Asiens, übte lediglich Kaiser Yataro von Mitsubishi und damit Japan noch einen gewissen Einfluß aus, wenn dort auch die Weiterentwicklungen von Teehäusern, in denen Neuronale Geishas auch ohne Schminke perfekt das traditionelle Schönheitsideal verkörperten, stärkere Bedeutung hatten als vordergründig medienbezogene Multiplexe oder Connexe, die durch psychedelische Technik bukolische Kunstwelten schufen, exakt definierte Gehirnbereiche direkt stimulierten und mit menschlicher Biochemie spielten, indem sie Wirkstoffmoleküle zusammensetzten wie Kinder Legosteine. Doch der Sinn stand Krautheim nicht nach solchen Vergnügungen, die einen Nachgeschmack hinterließen wie die künstlichen Aromastoffe in billiger Waldmeisterlimonade. Er wollte keine makellosen Barbie-Puppen für Erwachsene. Was er brauchte, war kein lebloses, unwirkliches Simulacron, kein teures Psychotonikum; es war etwas ganz anderes ... Er schob sein Notizbuch ins Telefon; der Bildschirm wurde hell, und Krautheim stieß seinen Zeigefinger auf einen der Namen, die dort angezeigt wurden.
Die Lebenskräfte der Garnelen lösten sich langsam im Wein auf wie Kandiszucker in heißem Tee.
Durch verstaubte Pflanzen, widerstandsfähige Kamillemutanten, stapfte Jasmina die Böschung eines ausgetrockneten Kanals entlang, die ihr Deckung bot. Von Zeit zu Zeit warf sie einen Blick über den Rand. Einmal bemerkte sie in einiger Entfernung ein Rudel Puwos. Sie mußten mindestens der zweiten Kreuzungsgeneration entstammen, denn die unterschiedlichsten Spielarten waren vertreten: Da gab es aschfahl gelockte Tiere mit spitzen Ohren ebenso wie langbeinige mit glattem, schwarzem Fell; einige waren kaum von Wölfen zu unterscheiden, andere erinnerten an Dobermänner. Auch zwei oder drei kleine Pukos hatten sich dem Rudel angeschlossen, und es mochte Mischlinge geben, die neben den Pudeln sowohl Wölfe als auch Kojoten unter ihren Vorfahren hatten.
Du mußt dich beeilen, dachte sie. Baby ist sicher schon hungrig.
Nur in der Mitte des Kanalbetts floß ein dünnes Rinnsal, eine schlammige, stinkende Brühe. Hin und wieder mußte Jasmina über die Ausflußöffnungen von Abwasserrohren klettern; die meisten waren alt und geborsten, aus nur wenigen rann ein stetiger Strom bunter, übelriechender Flüssigkeiten, oft nicht einmal von Armesstärke, manchmal nur fingerdick. Braungrau bepelzte Wanderratten nagten an den Kadavern von Artgenossen, deren grauweißes Bauchfell blut- und schmutzverkrustet war; sie ließen sich nicht stören, wenn Jasmina über sie hinwegstieg. Einige der Toten rührten sie merkwürdigerweise nicht an. Obwohl sie ausgezeichnete Schwimmer waren, vermieden sie es, mit dem Wasser in Berührung zu kommen, sprangen stattdessen mit gewaltigen Sätzen darüber hinweg.
Von der leichten Abkühlung, die der Hagelschauer mit sich gebracht hatte, war nichts mehr zu spüren. Die Sonne hatte selbst hier in Ufernähe bereits den letzten Feuchtigkeitsrest weggebrannt, und bei jedem Schritt, den Jasmina tat, wurden unter ihren bloßen Sohlen Staubwölkchen aufgewirbelt.
In einer Lache vor einem Abflußrohr, die nach fauligen Eiern stank, lag bäuchlings, umgeben von grünlichen Schaumbergen, ein drei oder vier Jahre altes Kind. Jasmina trat darauf zu, drehte den kleinen Körper vorsichtig auf den Rücken. Das aufgedunsene Gesicht war hochrot, bläuliche Adern schimmerten durch die Haut, die Augen zwischen verklebten Lidern wirkten trüb. Ein widerwärtiger Gestank stieg Jasmina in die Nase. Das Kind mußte seit Tagen tot sein, dennoch hatten die Ratten die Leiche verschont.
Jasminas Füße, die im Abwasser gestanden hatten, und die Finger, mit denen sie die Leiche berührt hatte, juckten wie von Salz aus verdunstetem Wasser nach einem Bad im Meer. Sie nahm eine handvoll Sand und rieb die brennende Haut damit ab, lief dann weiter in Richtung Jungfernheide.
Schließlich erreichte sie den ehemaligen Flugplatz Tegel, der jetzt mit Plastikgewächshausplanen bedeckt war, unter denen Erdbeeren wuchsen. Die Planen verhinderten hier wie anderswo die Wasserverdunstung und dadurch die Bildung von Wolken, trugen also wesentlich zur Klimaänderung bei, zur Erwärmung der Erde, die einen gesteigerten Energieverbrauch und damit eine erhöhte CO2-Emission zur Folge hatte, was wiederum die Erwärmung der Atmosphäre steigerte, aber ohne sie war der Anbau von Erdbeeren nicht rentabel. Selbst die wenigen Sonnenenergieanlagen, wie die Solartrichter, konnten daran nicht viel ändern. Auch hier in Tegel standen sechs dieser hohlen Kegelstümpfe aus weißem Styrol, die sich wie riesenhafte Blütenkelche der Sonne zuwandten und deren Licht auf photovoltaische Elemente bündelten.
Ein Zaun umgab im Karree die Felder, eigentlich nur zwei Leinen in ein und zwei Metern Höhe, von denen, um Tiere abzuhalten, flatternd wie Muletas rote und weiße Plastikstreifen hingen. Sie halfen nicht immer. Dicht neben der Stelle, an der Jasmina den Kanal verließ, lag unter dem Zaun der Kadaver eines Puwos, der durch die Lappen gegangen war - die Überwachungsanlage, die den Zaun schützte, hatte ihn entdeckt, eine der Selbstschußanlagen, die auf zwei gegenüberliegenden Eckpfählen standen, hatte ihn niedergestreckt. Wie bei allen Puwos der ersten Generation hatte er von seiner Mutter, einer Wölfin, das glatthaarige, von seinem Vater, einem Königspudel, das schwarze Fell geerbt, doch jetzt war es stumpf und vom Staub grau verfärbt.
Dennoch würde es einfach sein, die Umzäunung zu überwinden. Die Überwachung bestand lediglich aus einer Reihe von Lichtschranken, die einen zweiten, unsichtbaren Zaun bildeten, und einem Chip, der die flatternden Bänder ausfilterte. Jasmina lebte in einer Welt der Mauern und Zäune, und sie hatte gelernt, diese zu überwinden, um zu überleben.
Sie trat bis auf fünfzehn Schritte an den Zaun heran, nahm Anlauf, sprang; sie überschlug sich in der Luft, war am höchsten Punkt ihrer Flugbahn gut zwei handbreit von der Leine und damit der obersten Lichtschranke entfernt, landete auf weichem Ackerboden. Die Landung war nicht sehr elegant, sie stolperte, machte einen Ausfallschritt vorwärts, mußte sich sogar mit den Fingerspitzen der linken Hand abstützen, doch den Zaun hatte sie hinter sich gebracht.
Sie schritt die Planen ab, bis sie Beeren fand, die reif waren, kniete nieder und machte sich daran, sie zu pflücken, in eine Tüte zu füllen und zu essen. Als sie genug hatte, stand sie auf. Erde haftete an ihren Knien.
Es herrschte Stille in der Mittagshitze. Kein Vogel zwitscherte, kein Hund schlug an, nicht einmal der Lärm eines Flugzeugs war zu hören - als wäre die ganze Welt in einen Dornröschenschlaf versunken. Das gelegentliche Flügelsummen eines vorbeischwirrenden Insekts verstärkte nur noch den Eindruck der fast vollkommenen Ruhe. Jasmina trat zum Zaun, übersprang ihn und landete ungeschickt auf allen Vieren. Die Tüte war zu Boden gefallen. Unwillig verzog Jasmina das Gesicht und begann, die verstreuten Erdbeeren einzusammeln.
Ein Knall zerschlug die Stille, neben Jasmina spritzte eine Erdfontäne auf. Der Zaun? Unmöglich, sie hatte die Lichtschranke nicht gekreuzt. Sie warf sich herum. Da standen sie, keine zweihundert Meter entfernt: silbrig glänzende Wächter. Jasmina sprang auf und rannte los. Die Umzäunung genügte den Plantagenbesitzern nicht, sie schickten Wächter auf Kontrollgang, Silberne Engel in aluminiumbedampften, hitzeabweisenden Uniformen. Warum hatte sie sie nicht kommen sehen? Ein weiterer Schuß fiel, ein dritter. Jasmina lief auf den Kanal zu, um sich in Deckung zu bringen. Viel zu lang die Abstände zwischen den Schüssen, als spielten die Wächter ein heimtückisches Spiel mit ihr. Sie hechtete, als sie die Böschung erreicht hatte, spürte im Flug plötzlich einen scharfen Schmerz in der Leiste, verlor die Besinnung.
Als sie wieder zu sich kam, hörte sie nicht das leiseste Geräusch. Wie lange war sie bewußtlos gewesen? Sekundenbruchteile? Minuten? Sie konnte es nicht sagen. Nichts rührte sich. Ihr Blickfeld schien merkwürdig eingeschränkt, wie durch Scheuklappen. Verständnislos starrte sie auf ihre blutbeschmierte Hand. Dann erst spürte sie den Schmerz und begriff. Langsam schob sie sich, ohne das linke Bein zu gebrauchen, die Böschung hoch; vorsichtig hob sie den Kopf über den Rand: Die Engel waren verschwunden. Ihre Aufgabe war es, Eindringlinge von den Feldern fernzuhalten; diese hatten sie erfüllt, alles weitere kümmerte sie nicht.
Erschöpft rollte Jasmina sich auf den Rücken. Sie umfaßte ihr Medaillon mit der Rechten.
„Heilige Maria Magdalena, hilf!“ formten stumm ihre Lippen. Siebenmal bat sie darum, einmal für jeden der Dämonen, die aus der Schutzpatronin der Huren ausgefahren waren. Die Sonne brannte auf der bloßen Haut ihres Gesichts, ihrer Hände, Arme und Füße fast ebenso wie der Schmerz in ihrer Seite.
Als sie wieder etwas Kraft gesammelt hatte, untersuchte sie vorsichtig die Wunde. Das Geschoß war in ihren Körper eingedrungen, hatte ihn jedoch nicht wieder verlassen. Obwohl es noch wie ein Pfropfen im Schußkanal steckte, blutete die Wunde stark. Unmittelbar nach dem Einschlag war das Projektil aufgeklappt wie ein winziger unbespannter Regenschirm, um die Effektivität zu erhöhen, starke innere Verletzungen zu verursachen.
Es war Montag, der vierzehnte März 2089. Genau einhundert Jahre nach Abschaffung der Todesstrafe in West-Berlin.
Jasmina richtete sich auf und fiel wieder hin. Dabei drang die scharfe Kante des Bruchstücks einer Hartplastikkonservenbüchse in ihren rechten Handballen ein.
Ferdinand saß wieder im Freien und füllte den Sprengstoff vorsichtig in eine Blechdose. Seine Hände zitterten ein wenig. Nervös schielte er nach seinem primitiven Fischer-Technik-Gehirnstimulator, der in einem der Wandfässer lag.
Die Mädchen spielten mit den Fernbedienungen, wechselten ab und zu ein paar eigentümliche Worte. Die typische, nervtötende Sprechweise eines Sportreporters ertönte, lange gedehnte Belanglosigkeiten, abwechselnd mit hektisch ausgestoßenen Passagen: „- Ponnesmake führt den Ball. Abgefangen. Ein mißglücktes Zuspiel. Zu weit dieser Paß. Keine Schwierigkeit für Preud'homme. Ja, Mechelen war immerhin der Altweltmeister der Pokalsieger 2088. Sicherlich kein leichter Brocken für den PSV Eindhoven.“ Die untere Hälfte des Bildschirms zeigte einen Blick auf das Spiel, rechts oben war eine schematische Graphik der aktuellen Spielpositionen zu sehen, links oben weitere Informationen: Spielzeit, Spielstand, Spieler, dazwischen Werbeeinblendungen. „Das ist Linßen aus Rio de Janeiro. Setzt sich durch. Und scheitert in dieser aussichtsreichen Position noch an Preud'homme, der geschickt den Winkel verkürzen kann ... Und ihr habt es am Protokollfenster gesehen, unsere Übertragung hat begonnen mit dem Anstoß zum zweiten Durchgang. In der ersten Halbzeit ist überhaupt nichts passiert.“ Ganz sicher nicht, doch das galt wohl für jede Halbzeit solcher Veranstaltungen. Auch für andere Sportarten war es zutreffend, der nächste Sprecher war jedenfalls gezwungen, mehrere Sekunden lange Pausen zwischen den einzelnen Wörtern einzufügen, um nicht in peinliches Schweigen verfallen zu müssen: „Ein starkes ... Feld ... Kalitzka ... zählt ... zu den ... Favoriten ... ohne Frage -“.
Unterschiedlich rasch wechselten die Sender. Tanzende Paare, wirbelnde schwarze Frackschöße und Marabufederboas: „- auch hier wieder der weiche Beinansatz. Nummer 13, Rosalba und Ivica Krmpotik, siebte der letzten Altweltmeisterschaften; Nummer 6, Kathi Freeman und Stuart Ziff aus Kanada; Nummer 9, Ruriko Asaoka und Kioshi -“, „- nicht vierzig, nicht zwanzig, nein, die Zweihundertfünfziggrammdose für nur zwölfneunundneunzig -“, „- Eykelkamp, der seinen ersten Marathonschritt als Soldat -“, „- galante, hüpfende Schritte, und trotzdem darf diese sprühende Lebendigkeit nicht verloren gehen, es muß immer alles im Fluß sein -“, „-ity Cigarettes: Der Duft der Stadt in deiner Hand. Jetzt mit lustigen Klebeholos zum -“.
Vérénice gab eine unverständliche Lautfolge von sich, wiederholte sie, als Violetta in einer ähnlich klingenden Sprache in fragendem Tonfall antwortete, mehrmals mit unterschiedlicher Betonung und zum Teil deutlich abweichenden Silben.
„- Ossetien kennen wir bereits ... mit der 179 hier im Bild: Johnny Clay, Santa Monica Track Club, ein Name, ein Begriff in der Leichtathletik, mittlerweile Harun Sh'ar Jeshuv ... keiner konnte ihn in der Altwelt bisher ernsthaft gefährden, und keiner kannte ihn in der Altwelt bislang: William Tanni werden wir sehen mit Harun Sh'ar Jeshuv zusammen auf Bahn -“, „- Aerobic-Olympiasieger Alhassan Ahmet Moussa -“, „- hat Pepsi Scheele den Doppelfehler wieder wett gemacht. Eines steht jetzt schon fest: Eine Linkshänderin gewinnt dieses Finale -“, „- acht zu zweiunddreißig, vierundsechzig zu acht, sechzehn zu vier, zwei zu hundertachtundzwanzig, zweiunddreißig zu zweiunddreißigeinhalb -“, „- Juriaan van Wessen mit 7.010 auf hundert Meter den von ihm selbst aufgestellten Altweltrekord nicht erreicht -“, „- euch die Spannung bis zur Übertragung erhalten wollt, drückt bitte jetzt das Nein-Feld eurer Fern-“.
Marktschreierische Kommentare zu merkwürdig geformten Rennwagen, die kaum Platz für einen Fahrer zu bieten schienen und fingerbreit über dem Boden dahinrasten, Skifahrern auf zitronengelbem Kunstschnee, Kamelrennen, Windsurfing, Delphinpolo, Skijak, Hufeisenzielwerfen.
Der Junge füllte die Dose mit Glas- und Metallsplittern auf, umwickelte sie mit reißfester Kunststoffolie und Draht. Mit dieser Bombe würde er ein ganzes Rattennest ausheben, Hunderte von Ratten gleichzeitig auslöschen.
„Wenn ihr jetzt nicht aufhört“, rief er, „stelle ich den Strom ab.“ Es war nicht viel mehr als eine leere Drohung, das wußte er ebensogut wie Vérénice und Violetta, denn er würde dazu aufs Dach und den Strommast hinauf klettern müssen, wo sie der Überlandleitung Schwarzstrom entnahmen, und das Abziehen der Krokodilklemmen war nicht ungefährlich, schon mancher in der Müllkolonie war dabei gestorben. Der Stromdiebstahl wurde von offizieller Seite geduldet, es gab ohnehin einen Energieüberschuß; die Solaranlagen in der Sahara waren prinzipiell in der Lage, den gesamten Weltenergiebedarf zu decken - nur juristische Fragen und die Gebietsansprüche einiger nordafrikanischen Stadtstaaten, allen voran Tschad und Großkhartum, sprachen dagegen. Jedenfalls schien die Verringerung der Überproduktion durch die verbreitete illegale Stromentnahme den Betrieb von Kernkraftwerken zu rechtfertigen, wenn die natürlichen Resourcen an Kernbrennstoffen auch schon lange aufgebraucht waren und Kernreaktoren weniger der Energiegewinnung als der sogenannten Verteidigungsforschung dienten. Durch die verschiedensten Arten der Energieumwandlung entstanden Wärmeverluste, und diese Abwärme heizte den Planeten auf. Die gelegentlichen Hagelschauer waren kein positives Zeichen, im Gegenteil, wie Springfluten, Orkane und Wirbelstürme waren sie lediglich Revers einer Medaille mit zwei Kehrseiten, deren Avers aus sengender Bruthitze, verdorrter Vegetation und verbrannter Erde bestand.
„Er zündet einen Grünspan an“, sagte Violetta, „die Sonne zu suchen.“
„Es ist, als galoppierte ich auf einem einbeinigen Pferd“, fiel Vérénice ein und legte den Kopf schief. Ihr Ohr berührte fast die Schulter.
Sie waren Unpersonen, Jasmina, Ferdinand, Violetta und Vérénice, ebenso wie Jasminas Kind: illegal, ohne Zulassung geboren. Ihre Mutter war fünf Jahre zuvor, bei der Geburt der Zwillinge, gestorben. Ihre Väter kannten sie nicht. Sie hatten nicht einmal einen Anspruch auf Lebensmittelkarten oder eine Sozialwohnung, eine jener ein mal ein mal drei Meter großen Wohnsarkophage, wie sie ursprünglich ein Jahrhundert zuvor, ausgestattet mit Fernsehgerät und Telefon, in japanischen Hotels eingeführt worden waren.
Ferdinand trat ins Haus, stellte die Bombe in eines der Regalfässer und nahm eine Schachtel mit Ritterspornsamen, die die Aufschrift Rattenpfeffer trug, und eine Büchse Thalliumsulfat heraus. Eine halbvolle Flasche Alphanaphtylthioharnstoff wollte er für Notfälle aufbewahren.
Eine Bewegung an der Tür, aus den Augenwinkeln wahrgenommen, ließ ihn herumfahren.
„Angelo“, sagte er anstelle einer Begrüßung.
Der wirkliche Name des Mannes, der am Eingang lehnte, war Karl-Heinz Mrosko; er war, wenn nicht die rechte Hand seines Onkels, des selbsternannten „Bürgermeisters“ der Müllkolonie, der die Haldennutzungsrechte von der Regierung gepachtet hatte, so doch sein Abzugsfinger. Doch kaum jemand kannte seinen Namen. Angelo paßte viel besser zu ihm, war wie ein Accessoir, das seine Tätigkeit unterstrich, der Selbstkarikatur, die er war, den letzten Schliff gab, wie sein Äußeres - sein schwarzes, geringeltes Haar, sein Moustache, der glänzte wie mit Schuhwichse eingerieben - und seine beiden Schatten, Anton Mili_ und Siggi Laemmle.
Angelo trug eine weiße, ärmellose Jacke, einen weißen Hosenrock und weiße Wildlederstiefel. Der flaschenglasbraune Klarsichteinsatz in seinem Hemd zeigte seine mit Kletterrosen bemalte Brust und das Kruzifix aus Nußbaumholz, das an einer Silberkette um seinen Hals hing.
Weniger geschmack- und wert-, aber keineswegs weniger eindrucksvoll war die Kette aus echten menschlichen Schneidezähnen, die Laemmle trug. Schweiß perlte von seiner fettigen Glatze wie von einer imprägnierten Lederjacke. Seine Haupthaare und seine Augenbrauen waren abrasiert, nur ein weit abstehender Kaiser-Wilhelm-Bart zierte sein Gesicht. Grabsteine waren auf seinen massigen, haarlosen Oberkörper und seine Arme tätowiert. Feuerspeiende Drachen fauchten schuppenschwänzige Seejungfrauen an, schnaubend flohen Rapphengste vor grinsenden Totenschädeln mit durchlöchertem Stirn- oder Scheitelbein.
Eine Zuchtperlenkette führte wie die grob skizzierte Silhouette eines auf dem Rücken fliegenden Vogels über die durchstoßene Nasenscheidewand von einem Ohr zum anderen. Durchsichtige Plastikschläuche standen wie die Henkel einer Amphore auf beiden Seiten von seinem Hals ab. Mit jedem Herzschlag pulsierten sie, während helles, durch den eingefärbten Kunststoff violett schimmerndes Blut sie durchströmte. Sie lenkten einen Teil des Bluts, das durch die Halsschlagadern floß, um. Die künstlichen Adern waren nicht medizinische Notwendigkeit, sondern modisches Beiwerk wie Ringe in durchbohrten Ohren, Frauen durch im Säuglingsalter eingebundene Gliedmaßen zum Trippeln zwingende Lotosfüße, durch um den Hals gelegte Messingringe giraffenartig gedehnte Hälse von Burmesinnen, innere Organe einschnürende Korsetts, spitz- oder zu einem Schachbrettmuster gefeilte Zähne, eingewickelte Kinderköpfe mit deformiertem Schädelknochen. Laemmle mußte sich seiner selbst sehr sicher sein, denn die freiliegenden Schläuche waren wie eine künstliche Achillesferse, aber seine Größe und seine Körpermasse machten das mehr als wett.
Das bemerkenswerteste Schmuckstück, das er trug, war jedoch eine lebende mutierte Fischassel, azurblau, mit weißen Rändern an den Panzerschuppenkanten und Wolkenmustern auf dem Rücken, die sich mit Hakenfüßen in seine Haut klammerte, den Kopf über der Nasenwurzel, den Schwanzfächer auf der Stirn. Sie hieß, wie die meisten Schmuckasseln, Anni, und dieser Name war ebensowenig originell wie der Name Felix für einen Kater, denn er war von der lateinischen Bezeichnung Anilocra abgeleitet. Die Assel war, wie alle ihre Artgenossen, als Männchen geboren, hatte sich aber, als sie an einen unbesetzten Wirt geriet, schnell in ein Weibchen verwandelt. Auf ihrem natürlichen Wirt hätte sie, wenn sie ein Weibchen vorgefunden hätte, sich mit diesem gepaart und erst falls es gestorben wäre langsam das Geschlecht gewechselt, um ihrerseits auf ein Männchen zu warten und ihre Vaterschaft durch Mutterschaft zu ergänzen. Doch hier, unfreiwillig an einen menschlichen Wirt geklammert, wartete sie vergeblich.
Orangerote Patronengurte waren über Laemmles nackter Brust gekreuzt, obwohl keine dazu passende Waffe erkennbar war.
Der zweite Schatten dagegen trug deutlich sichtbar einen Dolch an der Innenseite seines rechten Unterarms. Seine schwarze Mähne mit einigen rotgefärbten Strähnen reichte bis zu den Schulterblättern. Dicke, borstige schwarze Haare drangen aus Kragen, Ärmeln und Knopflöchern seines hellgrauen kunstseidenen Hemdes wie Maden aus Speck, wuchsen auf dem Rücken seiner Hände und Finger und der Zehen und Füße, die in Sandalen steckten. Hautenge, schwarz und gelb gestreifte Vigognestoffhosen umschlossen seine Beine.
„Jasmina ist nicht da“, sagte Ferdinand vorsichtig. Die Assel auf Laemmles Stirn schien ihn anzusehen.
„Wer ist Jasmina?“ zischte Angelo ironisch und zog einen Zerstäuber aus der Tasche. „Sie ist für uns gestorben. Glaubst du, unsere Kunden wollen Pilze sammeln? Nicht einmal ein Blinder bei Nacht würde ...“ Der Rest seiner Worte verlor sich, denn er sprühte aus dem Zerstäuber ein Euphorikum zunächst in sein rechtes, dann in sein linkes Nasenloch und sog schnaubend Luft ein.
„Was wollt ...?“ fragte Ferdinand.
„Der achte Zwerg war groß“, flüsterte Vérénice. „Darum kennt ihn keiner, er wurde verschwiegen.“
Angelo steckte den Zerstäuber weg und deutete mit dem Kinn auf die beiden Mädchen, die mit einer Radnetzspinne mit den schwarz-braun geringelten Beinen und dem gelb-schwarz gestreiftem Hinterleib einer Wespenspinne spielten, indem sie sie von einer Hand auf die andere krabbeln ließen. Dann zischte er: „Sie.“
Ferdinand starrte zuerst Angelo an, dann seine Schwestern, als sähe er sie zum ersten Mal. Ihr gemeinsamer Körper hatte die Form eines Y. Zwei Köpfe, die gerade dicht genug nebeneinander auf zu breiten Schultern saßen, um einander küssen zu können, auf jeder Seite ein gesunder Arm, zwischen den Schulterblättern, wie die Ansätze von Engelsflügeln, zwei verkümmerte; drei Mamillen, ebensoviele Lungenflügel und zwei Herzen; darunter ein gewöhnlicher Verdauungstrakt, überhaupt alle Organe in der üblichen Anzahl; ein Nabel; zwei Beine, die in normalen Jeans steckten; die Bluse besaß jedoch einen zusätzlichen dritten Träger, der in der Mitte zwischen den beiden Hälsen verlief.
„Aber ... sie sind doch erst fünf!“ sagte Ferdinand gepreßt.
Die Tätowierungen auf Laemmles Brust zucken und er grunzte. Angelo warf ihm einen mißbilligenden Blick zu, wandte sich wieder an Ferdinand und sagte: „Sie sind genau das, was wir suchen. Wir brauchen etwas ganz Spezielles. Und fünf ist gerade das richtige Alter.“ Seine Stimme wurde klebrig wie Fliegenleim: „Hör zu, Süßer, wovon wollt ihr denn leben, jetzt, wo Jasmina ihr Hautpilz anzusehen ist?“ Er hatte recht, ihre Haut schuppte, blätterte ab wie alter Lack. Mit ihrer Dermatomykose fand sie keine Kunden mehr, verdiente kein Geld, konnte keine Schutzsteuern bezahlen. Medizinische Versorgung gab es natürlich nicht; nicht für Illegale. Manche Leute warfen zwar tatsächlich Medikamente weg, wenn das Verfallsdatum abgelaufen war, aber das nützte nicht viel. Zudem war Jasmina zu alt; elf-, zwölfjährige Mädchen waren das teuerste Fleisch der Welt, aber wenn sie vierzehn wurden ... Sie würden wohl bald das Holz der Apfelbäumchen, falls es noch etwas taugte, als Schmuckholz verkaufen und dann die Müllkolonie verlassen müssen, in die Elendsviertel ziehen.
„Was ...“ Ferdinand schluckte. „Was ist mit mir?“
Angelo brachte dreimal ein Z hervor, indem er mit der Zunge schnalzte, um eine Art wohlwollend-bedauerndes Mißfallen kundzutun. „Nicht doch“, sagte er. „Nun ja, in anderen Teilen der Altwelt vielleicht.“ In weniger orthodoxen, meinte er, in Amsterdam, der künstlichen Insel, die dort schwamm, wo früher die Niederlande gewesen waren, in Leipzig oder London, Reykjavik oder Rostock, aber nicht hier in Berlin mit über achtzig Prozent katholischen Einwohnern, wo die entsprechenden, reichlich einseitigen, Gesetze rigoros durchgesetzt wurden. Der Anteil an Katholiken war so hoch seit den Religionskonflikten zwischen türkischen Moslems, vor allem in Kreuzberg, und Polen, die, als sie 2022/23, kurz nach der Zerschlagung der Deutschen Bundesrepublik und kurz vor der Gründung der Mitteldeutschen Republik über die TschechoSlowakei, die damals gerade Tschecho-Slowakei geheißen hatte, und den Ostdeutschen Bund nach Berlin gekommen waren, um von hier aus in die Nordstaaten oder die Präunion zu fliehen, und die zum Großteil in der ehemaligen Reichshauptstadt geblieben waren. „Wir wollen doch keinen Ärger bekommen.“
„Misthaufen wachsen, Schlösser fallen“, sagte Vérénice wie zu sich selbst. Violetta sprach flüsternd mit der weiblichen Spinne, die auf ihrem angewinkelten Knie saß, und streichelte sanft den silbrigen Pelz ihrer Kopfbrust.
„Lämmchen!“ Auf einen Wink Angelos drängte sich Laemmle an Ferdinand vorbei und ging auf die beiden Kinder zu. Er packte sie mit einer Hand am hinteren Bund ihrer Hosen und hob sie hoch wie einen Koffer am Griff. Ihr Strampeln war für ihn nicht lästiger als das Krabbeln einer Pferdebremse für einen Haflinger.
„Januskinder sind selten; womöglich sterben die Doppelköpfigen aus“, sagte Angelo und lachte.
„Es gibt keine Menschen mit zwei Köpfen“, stieß Vérénice abgehackt hervor - sie keuchte, weil sie, wie ihre Schwester, noch immer mit den gemeinsamen Beinen strampelte - „nur zwei Menschen mit einem Körper.“
Ferdinand betrachtete sie verwundert, denn zum ersten Mal hatte er einen Zusammenhang zwischen dem, was die beiden von sich gaben, und der Wirklichkeit entdeckt. Die anderen bemerkten natürlich nichts davon.
Das Baby hatte begonnen, ein ersticktes Gurgeln von sich zu geben, das bei ihm einem lauten Schrei entsprach. Vielleicht hatte es Schmerzen; seine rechte Wange, sein Ohr, seine Schläfe waren ein einziger blutiger Klumpen, mit weißem Reis gespickt. Die Reiskörner waren Maden, Larven der Schraubenwurmfliege. Angelockt von frischem Blut oder Lymphflüssigkeit, legten die Weibchen in offene Wunden ihre Eier. Diese entwickelten sich innerhalb weniger Stunden zu schraubenförmig gewundenen Maden, die sich ins Fleisch des Wirts fraßen. Die Wunde weitete sich aus, entzündete sich und lockte andere Fliegenweibchen an. Durch das Aussetzten von Abermillionen männlicher, mit Gammastrahlen sterilisierter Schraubenwurmfliegen war die Plage in ihrer Heimat, Süd- und Mittelamerika, nahezu ausgerottet, doch bereits im vorigen Jahrhundert hatten die Fliegen Afrika, Nord-Libyen und die Mittelmeerinseln heimgesucht. Mit der Veränderung des globalen Klimas waren sie in Spanien, Italien, Griechenland und Südfrankreich eingefallen. Und jetzt quälten sie, die bei Temperaturen von zehn Grad Celsius und darunter nicht überleben konnten, Menschen und Vieh hier in Berlin. Aber vielleicht schrie das Baby einfach nur, weil es hungrig war.
„Wer Perlen mit den Säuen frißt“, sagte Violetta leise, „wird danach stinken.“
„Laßt sie in Ruhe!“ stieß Ferdinand endlich trotzig hervor.
Mili_ ballte die Fäuste. Angelo hob die rechte Augenbraue und trat auf Ferdinand zu. Das erstarrte Gesicht des Jungen wurde von den einseitig verspiegelten Kontaktlinsen reflektiert, die Angelo trug, um seine Augen vor der grellen Sonne, auch wenn sie jetzt hinter Wolken verborgen war, zu schützen. So stellte Ferdinand sich den Tod vor: nicht mit Sense und Stundenglas, sondern mit quecksilbriger Iris, die ihm sein eigenes Leben und seine Angst zeigen würde. Plötzlich schlug Angelo ihn mit dem Handrücken ins Gesicht. Die Thalliumsulfatbüchse fiel scheppernd zu Boden, die Schachtel flog rotierend durch die Luft und verstreute Samen, die gegen die Wände prasselten. Die Mädchen hielten noch immer die Fernbedienungen in der Hand, und so wechselte im Fernsehen HiPop, Re'Pop und Hopscotch sich ab mit Claude Debussys Prélude à l'après-midi d'un faune, Ivan Reitmans Brecht und Sauerkraut, Anton?n Dvo_áks Symphonie Nr. 9 in e-Moll, A Day in the Life von den Beatles, der von Robert Trappl und Georg Dorfner einhundertdreißig Jahre nach der Uraufführung computerergänzten Unvollendeten, einem namenlosen, kakophonen Geräuschsammelsurium Werner Zimmermanns, Pino Selecchias Quartett für Glasflöte und drei verstimmte Klaviere. Ferdinands Lippen waren von dem synthetischen Rubin, den Angelo neben dem Ehering trug, aufgerissen worden. Blut und gelblichweißer Eiter krochen über sein Kinn. Er starrte die auf dem Boden liegenden Ritterspornsamen an. Wenn er den Sprengstoff in der Hand gehalten hätte ...
Das Baby draußen in der Wiege gurgelte noch immer. Ferdinand wünschte, Jasmina würde kommen, um es zu stillen.
Jasmina lag erschöpft an der Kanalböschung und riß fleischige Blätter von dort wucherndem, halbverdorrten Spitzwegerich, um die Blutung zu stillen. Sie zerkaute die Blätter zu einem Brei, den sie auf die Wunde strich. Obwohl es warm war, fröstelte sie. Langsam schwand das Tageslicht. Immer wieder kniff sie ihre tränenverklebten Lider zusammen, um überhaupt etwas sehen zu können.
Wenn sie doch nur ein Pflaster bei sich gehabt hätte! Doch Pflaster, die Wirkstoffe transdermal ins Blut einbrachten, selbst minderwertige, waren zu teuer; seit ihre Krankheit sichtbar geworden war, war Klebstoff das einzige Rauschmittel, das sie sich leisten konnte, wurden lösungsmittelhaltige Klebstoffe doch ausschließlich zu dem Zweck produziert, auf diese Weise konsumiert zu werden - wenn sie auch von einigen naiven Unwissenden tatsächlich zum Kleben verwendet wurden. Speckigglänzende, rosige Haut war bereits an Jasminas Oberarm nachgewachsen, wo sie die billigen Drogenpflaster gewöhnlich angesetzt hatte in der Hoffnung, die widerlichen Berührungen der Männer etwas erträglicher werden zu lassen, ihr zu helfen, die Welt um sie herum zu vergessen, ihre Wahrnehmung durch Surrogate zu verdrängen. Wenn die Rauschträume durch das Gehirn tanzten, gab es keinen Platz mehr für wirbelnde Erinnerungen.
Mit eingekniffenem Schwanz kam ein abgemagerter Schäferhund auf drei Beinen gehinkt und versuchte, an Jasminas Wunde zu schnüffeln. Schwach trat sie ihm mit dem Knie gegen die Schnauze. Winselnd lief er davon.
Jasmina robbte weiter, kroch mit gekrümmtem Rücken wie eine in die Enge getriebene Katze. Nach einiger Zeit bemerkte sie ein Licht und schleppte sich darauf zu. Es war wie ein Zeichen: Hier, am Rand eines ausgetrockneten Kanals, wo sich weit und breit keine Menschenseele fand, stand ein Ziborium, beleuchtet von einem grellen Neonröhrenkreuz. Jasmina lehnte sich dagegen, um auszuruhen; ihre Blutung hatte nachgelassen. Sie nahm ihr Medaillon ab, richtete sich auf und ließ es in den Opferstock fallen. Das darin eingeprägte Negativrelief, das Papst Innozenz zeigte, schien sie mit Blicken, sogar mit dem ganzen Gesicht zu verfolgen, wohin sie sich auch wandte, und diese merkwürdige Eigenschaft solcher Reliefs war natürlich der Grund, weshalb das Abbild vertieft, nicht erhaben dargestellt war. Knirschend untersuchte der Automat die Gabe, doch nach einigen Sekunden spuckte er sie wortlos wieder aus.
Jasmina biß sich auf die Lippen. Dann löste sie ungeschickt die Sicherheitsnadel des Buttons, den sie unter dem Hemdkragen versteckt trug, mit Fingern, die sich hinter der Nadel verhakten. Der Button war antik; sie hatte ihn von ihrer Mutter geerbt. Das einzig Wertvolle, das sie je besessen hatte. Ein letztes Mal las sie die geheimnisvollen, jetzt bedeutungslosen Worte, einst eine Parodie auf ähnlich klingende, blauäugige Slogans: Rettet die Dronten. Sie hielt ihn in der hohlen Hand vor die Öffnung des Opferstocks, hob die Handfläche. Der Button glitt hinein.
Wieder rasselte das Ziborium. „Denn am Abend, an dem Er ausgeliefert ward“, begann der Automat in für andere Maschinen untypischem, monotonem Singsang und mit grotesk altertümlich anmutender Wortwahl, „und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm Er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es Seinen Jüngern und sprach: ‚Nehmet und esset alle davon; dies ist Mein Leib, der für euch hingegeben wird.’“ Im Ziborium leuchtete ein kleines Sichtfenster auf, und eine konsekrierte Hostie schwebte darin, in bläuliches Licht getaucht. „Ebenso nahm Er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn Seinen Jüngern und sprach: ‚Nehmet und trinket alle daraus; dies ist der Kelch des Neuen und Ewigen Bundes, Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu Meinem Gedächtnis.’“ Das Licht im Sichtfenster wurde rot, die Hostie schien in Blut getaucht. Sie begann, schnell um ihren Durchmesser zu rotieren, so daß sie wie eine verschwommene Kugel wirkte, und fiel nach unten. Dann schnappte eine Klappe auf, in der die Hostie - oder eine andere - lag.
„Der Leib Christi“, sagte das Ziborium. Es klang wie eine Feststellung.
„Amen“, hauchte Jasmina. Sie nahm die Hostie heraus und legte sie sich auf die Zunge. Dankbar stellte sie fest, daß die Anzeigetafel des Ziboriums einen hohen Restbetrag auswies, und drückte auf beleuchtete Schalter, die mit Beichte und Letzte Ölung beschriftet waren.
Violetta und Vérénice waren frisch gewaschen, in Eselsmilch gebadet, mit kostbarem parfümiertem Öl gesalbt und in teure Stoffe gehüllt. An Violettas Oberarm klebte wie ein Muttermal ein dunkelrosa Pflaster. Sie kaute auf den Spitzen einer Haarsträhne Vérénices.
Krautheim lag in seinem Sessel und sah die beiden Mädchen an, wie sie ihm gegenüber auf der Couch saßen; seine Mundwinkel stießen die feisten Wangen nach oben. Fettflecke auf seinem Kimono zeugten von den gebutterten Garnelen, die er gegessen hatte, vielleicht auch von den anderen Gerichten, die er in homöopathischen Dosen, wie sie in der traditionellen Küche üblich waren, verspeist hatte, von der Hechtklößchensuppe, der Kalbfleischpastete, den Filet-Medaillons mit Lebermus, dem Kalbsrücken „Paris“ mit Gänseleber, den Kalbfleischröllchen mit frischen Feigen - nach deren Genuß er einen Vomitif zu sich genommen hatte - den gefüllten Hamburger Stubenkücken, den Wachteleiern in Madeira-Gelee, den mit Shrimps-Cocktail gefüllten Tomaten, der getrüffelten Salmtorte „Louis Quatorze“ oder den Räucherlachsröllchen mit Apfelkren. Der überproportionale Anteil an Kalbfleisch in seinem Essen war nur zu verständlich, denn er hatte die Kälber an diesem Morgen bei einer Treibjagd selbst erlegt. Flugpolizisten, die sonst, rucksackähnliche Düsenaggregate auf dem Rücken, Demonstranten jagten, empfanden es als angenehme Abwechslung, hin und wieder einem Industriellen oder Politiker seine Jagdbeute zuzutreiben, kurz zuvor ausgesetzte Kälber gewöhnlich, denn jagbares Wild gab es in der Grassteppe Deutschlands nicht mehr. Krautheim liebte alte Waffen, und mit dem Küchentomographen konnte die Munition in der Beute leicht entfernt werden; daher tat es seinem Jägerstolz keinen Abbruch, daß er ein Maschinengewehr benutzt hatte. Selbstverständlich war ein solches Vergnügen nicht halb so aufregend wie die Eisbärjagd, an der er in der Administration, genauer im Norden Amerikas, teilgenommen hatte. Ein leichter Kitzel der Gefahr hatte diese Jagd begleitet, denn mit dem Rückgang natürlicher Beute hatten die Bären sich als Zivilisationsfolger in den Müllbergen breitgemacht, in denen sie erfolgreich nach Nahrung suchten. Die Gefahr ging nicht so sehr von den Tieren aus, die an Menschen gewöhnt und nicht sehr angriffslustig waren, sondern vielmehr von Rauch und Feuer im sich selbst entzündenden Müll. Krautheim hatte mehrere Bären erlegt, ehe er ein Fell, das nicht versengt war, als Trophäe sein eigen nennen konnte. Es war ein faszinierend widersprüchlicher Anblick gewesen: Eisbären, die durch züngelnde Flammen wanderten.
In der Hand hielt Krautheim einen dreigeteilten Dessertteller. In einem Drittel lagen Kiwischeiben und Erdbeeren, die Häubchen aus geschlagener Sahne trugen, im zweiten Fach zierten Bananenscheibchen braune Mousse au chocolat und Ananasstückchen weiße Mousse à la vanille, und die dritte Vertiefung war gefüllt mit Orangensegmenten, deren Zwischenhaut entfernt war, rosenwasserbeträufelt und zimtbestreut, und entkernten Litschihälften, am Stielansatz zusammengehalten von ihrer rauhen braunen Schale, die innen mit einem hellvioletten, flüssigkeitsundurchlässigen Film überzogen war. Krautheim wußte, wie sehr Litschi und tunesischer Orangensalat harmonieren würden, und nach dem Speichel zu urteilen, der seinen Mund füllte, wußte sein Körper es auch. Doch die Orangenfilets glitten immer wieder von der winzigen zweizinkigen Gabel. So warf er das Eßgerät verärgert über die Schulter, hob den Teller an die Lippen und schob schlürfend, als ob er das Fleisch aus einer Austernschale saugte, das Essen mit der Hand in den Mund. Als der Teller leer war, ließ er ihn auf den Boden fallen, wo er auf eine halbvolle Flasche Spätburgunder Kabinettwein - 83er Sasbachwaldener Alde Gott - fiel und zerbrach, und wischte, nachdem er der Reihe nach an allen fünf Fingern gelutscht hatte, die Hand am Kimono ab.
Er leckte ein paar Reste Mousse, die eine Parodie des Blut- und Eitergemischs an Ferdinands Lippen hätten sein können, vom Kinn, spülte mit seinem Digestif - Cointreau - nach und sah wieder grinsend die Zwillinge an.
„Steh auf!“ befahl er.
Vérénice sagte: „Die Freiheit ist das Recht, alles zu tun, was die Gesetze erlauben. Meint Montesquieu.“
Wie das Gedärm eines Kaninchens, das ausgeweidet wird, fielen Krautheims Mundwinkel herab.
„Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden“, ergänzte Violetta ihre Schwester, „solange er nicht anders handelt.“ Dann sah sie sich suchend nach einer Fernbedienung um, mit der sie den ekelhaften Kerl würde ausschalten und auf ein anderes Programm wechseln können.
Sie fand keine.
Die Fernbedienungen lagen verwaist da, als Jasmina gegen Mitternacht die Hütte erreichte; ein Musiksender übertrug Saint-Saëns Danse macabre zu kaleidoskopartigen Klangbildern und optisch reizvollen, aber nichtssagenden Videorückkopplungen. Die Wiege stand nicht mehr im Freien, sondern neben dem Container der Zwillinge. Wie Irrlichter brannten Feuer in Blechfässern, die auf Flößen durchs Wasser trieben, um den Fischern die Ernte zu erleichtern. Es roch brenzlig, doch der Gestank wie von schwelendem Gummi konnte nicht daher rühren. Irgendwo im Müll mußte durch Selbstentzündung ein Feuer ausgebrochen sein, das so lange brennen würde, bis es sich selbst verzehrt hatte oder zur unmittelbaren Gefahr wurde und jemand lieber versuchen würde, es zu löschen, als vor ihm zusammen mit seinen Habseligkeiten zu fliehen. Ferdinand war nicht da.
Jasmina nahm ihren Regenponcho aus einem der Fässer - einen Plastikmüllsack mit Löchern für Arme und Hals - und breitete ihn über die Pritsche, damit das Blut nicht ihre Bettdecke beflecken konnte. Langsam, wie in Zeitlupe legte sie sich hin, seitlich mit angewinkelten Beinen und an den Bauch gepreßten Armen, zusammengekrümmt wie eine aus der angebissenen Frucht gefallene Made. Ihr war trotz der Hitze kalt; ihr Körper versuchte durch Zittern, durch rasche Muskelkontraktionen, Wärme zu erzeugen - ihre Zähne schlugen aufeinander.
Bunte Lichtsplitter auf dem Bildschirm tauchten den Raum in gespenstische Farben. Ein leises Trommeln von oben mischte sich mit den Xylophonklängen aus den Fernsehlautsprechern. Es hatte wieder zu hageln begonnen.
„Jasmina! Was haben sie mit dir gemacht?“ Ferdinand stand, getrieben von den prasselnden Eisbrocken, an der Tür. Die Lichtkaskaden ließen seine Haut krank erscheinen.
Jasmina hatte sich halb aufgerichtet; sie nahm die Hand von der blutenden Wunde und sank auf die Pritsche zurück. Schmerz verzerrte für Augenblicke ihr Gesicht. „Angeschossen ... hier ...“
„Diese dreckigen Bullen“, stieß Ferdinand hervor.
„Nicht ... Bullen. Private.“
„Private. Ex-Bullen. Dreckskerle!“ Ferdinand lief zu einem der Fässer, nahm eine Tablettenschachtel heraus und brachte sie Jasmina.
„Aspirin?“ gab sie fragend von sich. Ihre Stimme war nur noch schwach, als sie fortfuhr: „Vergiß es!“
„Was dann?“ fragte Ferdinand.
Sie flüsterte: „Bennies. Sandoz'. Barbs.“
Das Gurgeln des Babys war einem rasselnden Atmen gewichen.
Ferdinand stöberte in einem Wandfaß voller Pappschächtelchen, fand schließlich eine angebrochene Packung Polamidon. Er nahm aus einem anderen Faß eine mit zusammengeschütteten Resten gefüllte Rotweinflasche, steckte Jasmina drei der rosaroten Milchzuckerkügelchen in den Mund und flößte ihr einen Schluck Alkohol ein. Ihr Körper verkrampfte sich, die Flüssigkeit lief aus ihrem Mund, sie erbrach sich.
Blut rann aus ihrer Wunde, durchnäßte das Hemd, perlte über den Regenponcho, tropfte auf den Boden. Jasmina starrte das Rot an.
„Es sind nur“, sagte sie, so leise, daß Ferdinand sein Ohr dicht an ihren Mund halten mußte, „Erdbeerflecken.“
Dann verstummte sie.
25. Apr. 2012 - Achim Stößer
Bereits veröffentlicht in:
|
|
VIRULENTE WIRKLICHKEITEN
A. Stößer |
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



