
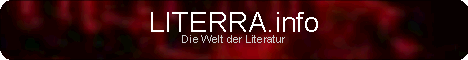
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Ruth M. Fuchs > Phantastik > Am Rande des Blickfelds |
Am Rande des Blickfelds
von Ruth M. Fuchs
Kennen Sie das? Sie sitzen allein im Büro und bemerken aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Aber wenn Sie dann hinschauen, ist niemand da. Sobald Sie sich aber wieder auf Ihre Arbeit konzentrieren wollen, ist da wieder diese Bewegung ...Ich hab mal gelesen, dass das eine Frage der Wellenlänge ist, die zum Beispiel ein Deckenventilator bei seiner Rotation verursachen kann. Eine stehende Welle, oder wie das heißt. Ich hab da mal so was im Fernsehen gesehen. Anders gesagt, dass ist ganz logisch erklärbar und gar nichts Unheimliches dahinter.
Als ich dann zum ersten Mal eine Bewegung am Rand meines Blickfeldes sah und als, wenn ich den Kopf wandte, niemand da war, hab ich mir gesagt, dass das auch so was ist, auch wenn bei mir gar kein Ventilator an der Decke ist. Aber warum sollten das andere Geräte nicht auch können, der Computer zum Beispiel oder vielleicht sogar das Radio, das sendet schließlich auch Wellen. Was weiß denn ich!
Aber dann hatte ich dasselbe Erlebnis auch im Freien, wenn es dämmerte oder dunkel wurde. Und wenn ich nachts im Bett lag und nicht schlafen konnte. Ich meinte auch ein leises Summen zu vernehmen. Manchmal.
Natürlich redete ich mit niemandem darüber. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie ich das einer Freundin erzählte und dann würden erst ihre Augen immer größer werden und sie dann ein bisschen wegrücken, als ob ich eine ansteckende Krankheit hätte. Oder sie würde mir eins dieser mitleidigen Lächeln schenken, die sagen ‚Sie spinnt ein wenig, aber sonst ist sie ganz nett’. Bitte – das hätte ich umgekehrt wahrscheinlich auch so gemacht. Nur dass ich mir ziemlich sicher war, nicht zu spinnen. Zumindest war ich mir meistens sicher. Es war ja nicht so, dass ich diese Bewegung am Rand meines Blickfeldes immer sah. Nur hin und wieder. Und wenn, dann nur bei Dunkelheit und wenn ich allein war.
Ich probierte eine Zeit lang, diese Bewegung einfach zu ignorieren oder mir einzureden, dass sie gar nicht da war. Was aber nicht ging. Sie war da und meine Angst auch. Also hab ich versucht, möglichst wenig allein zu sein. Ich ging auf Partys und hatte sogar einige One-Night-Stands, nur deswegen. Furchtbar. Ich bin ja eigentlich nicht der Typ für so was. Eine Wahrsagerin, die ich mal besuchte – verstohlen und voller Furcht, dass mich jemand dabei sehen könne – hat mir eine Menge von einem dunkelhaarigen Unbekannten, einer Reise übers Wasser und einem unverhofften Geldsegen erzählt, aber von einem Geist, einem Fluch oder irgendwas Körperlosem, das hinter mir her war, konnte sie mir nichts sagen. Rausgeworfenes Geld.
Irgendwann hab ich das Ding oder was das war, das sich da bewegte, angeschrien – zumindest glaube ich, ich habe ungefähr in seine Richtung gebrüllt, denn es ist ja weg, wenn man hinschaut. Ich hab auch gebettelt und gefleht, dass es weg gehen und mich in Ruhe lassen solle. Danach war eine Weile Ruhe. Andererseits ist ja immer wieder mal für eine Weile Ruhe. Ich kann also nicht sagen, ob es am Brüllen oder Bitten lag. Jedenfalls gab ich das auch wieder auf. Letztlich war es doch sinnlos.
Ich nehme ab der Dämmerung immer nur noch das Auto, wenn ich irgendwohin muss. In meinem Pkw bin ich nämlich wirklich allein. Nie auch nur der Anflug einer Bewegung. Und so fuhr ich auch in meinem Wagen zu meiner Schwester, um Babysitter zu spielen, damit sie und ihr Mann endlich mal wieder ausgehen konnten. Und danach fuhr ich wieder heim. Meine Schwester ist aus der Stadt aufs Land gezogen, der Kinder wegen. Aber was soll’s, im Auto war ich ja allein.
Dumm war nur, dass mein Gefährt mitten auf der Landstraße stehen blieb. Ich hatte getankt, daran konnte es nicht liegen. Aber es sprang einfach nicht mehr an. Um mich herum nur Felder und Wiesen, in der Ferne ein paar Bäume und die letzte Ortschaft lag schon einige Kilometer zurück. Leider hatte ich mir nicht gemerkt, wie viele Kilometer zur nächsten auf dem Ortsausfahrtsschild gestanden hatten. Deshalb konnte ich nicht einschätzen, in welcher Richtung ich eher Hilfe finden könnte.
Ich blieb erst einmal im Auto sitzen, alle Türen verriegelt. Da kann dir am wenigsten passieren, sagte ich mir. Am besten rufst du jetzt einfach den ADAC an und wartest. Aber mein Handy teilte mir mit, dass es keinen Empfang hatte. Macht nichts, sagte ich mir, irgendwann wird schon mal ein anderes Fahrzeug kommen, das du anhalten kannst. Der Fahrer wird schon nicht gleich ein Unhold sein.
Das Radio ging auch nicht. Und die Nacht war kühl und bald begann ich zu frieren.
Schließlich stieg ich aus und begann, auf gut Glück in einer Richtung die Straße entlangzulaufen. Die Nacht war klar und der Mond schien. Ich verschränkte die Arme und zog die Schultern hoch, um mich zu wärmen. Dabei wünschte ich mir, meine alte Jeans und die ausgelatschten Turnschuhe anzuhaben, mit denen ich daheim immer herumlief. Leider hatte ich mich stattdessen für einen Rock und Pumps entschieden – ich war ja mit dem Auto unterwegs. Aber der nächste Ort konnte nicht weit sein. Höchstens ein paar Kilometer. Ein Schrei schreckte mich auf! Nur eine Eule oder so was, sagte ich mir. Und das da an den Büschen ist bestimmt nur der Wind.
Ich kam an eine Weggabelung mit Schildern. Beide ausgeschilderten Orte waren mehr als zwanzig Kilometer weg. Da mussten dazwischen doch noch kleinere Ortschaften sein. Willkürlich wählte ich die rechte Straße. Ich lauschte auf das Geräusch meiner Schritte. Klangen die nicht irgendwie doppelt – so, als würde hinter mir noch jemand gehen? Ich blieb stehen. Das Geräusch erstarb. Ich ging weiter – da war es wieder! Nein, Unsinn. Wahrscheinlich nur so ein Echo des Asphalts. Oder doch nicht? Quatsch, ich war bestimmt allein hier, da bewegte sich noch nicht einmal etwas am Rand meiner Wahrnehmung. Diese Tatsache beruhigte mich. Auch ein Summen war nicht zu hören. Ich war wirklich allein. Trotzdem war ich sehr erleichtert, als vor mir die Lichtkegel von zwei Scheinwerfern erkennbar wurden, die beständig wuchsen, als sie sich näherten. Ich stellte mich an den Rand der Straße, um nicht versehentlich überfahren zu werden, wedelte mit den Armen und rief. Tatsächlich blieb der Wagen stehen. Ein Mann saß darin. Ich schätzte ihn auf etwa vierzig, soweit das bei Mondlicht überhaupt möglich war. Er war glatt rasiert mit einem breiten, teigigen Gesicht.
„Na, wo brennt’s denn?“, fragte er fröhlich und seine Augen begannen zu glitzern, als er mich von oben bis unten musterte.
Ich wich zurück. So, wie er mich ansah, hatte ich das Gefühl, nackt dazustehen. Der Fremde leckte sich die Lippen. Sein Blick blieb an meinem Busen hängen.
„Was kann ich für Sie tun, junge Frau?“ Er klang plötzlich heiser.
„Nichts. Es ist nichts“, stammelte ich und machte noch einen Schritt rückwärts. „Ich hab mich geirrt.“
„Aber nicht doch. Steigen Sie doch ein!“, forderte er mich auf und machte eine einladende Geste.
Ich schüttelte den Kopf und wich noch weiter zurück.
Da wurde er unwirsch: „Jetzt hab dich nicht so!“
Panik überfiel mich, ich wandte mich um und rannte davon. Ich lief von der Straße weg einen schmalen Weg zwischen zwei Wiesen entlang, weil ich mir sagte, dass er mir dann mit dem Auto nicht folgen konnte. Leider war der Weg ziemlich uneben und wenig geeignet für Schuhe mit Absätzen. Trotzdem hastete ich weiter. Nach wenigen Schritten durchzuckte meinen linken Knöchel ein stechender Schmerz. Mit einem Aufschrei fiel ich hin.
Hinter mir hörte ich eine Autotür auf und zuklappen. Und dann Schritte. Gemächliche Schritte, als habe der Mann alle Zeit der Welt.
Er lachte. Es war ein dreckiges Lachen, das mir eine Gänsehaut verursachte. Langsam kam er näher. Am Rand meines Blickfelds bemerkte ich eine Bewegung und erschauderte. Das nicht auch noch! Zwei Bedrohungen auf einmal. Dabei wurde ich wahrscheinlich noch nicht einmal mit einer fertig. Ich versuchte aufzustehen, doch der Knöchel gab erneut nach und ich schrie auf, als mir der Schmerz durch das Bein schoss. Der Kerl lachte immer noch, nun schon viel näher. Ich versuchte wegzukriechen, riss mir die Handflächen und die Strümpfe an dem Splitt auf, der den Boden bedeckte, kam aber kaum vorwärts. Jede Bewegung tat weh.
Am Rand meines Blickfeldes nahm ich wieder diese Bewegung wahr. Doch jetzt schien sie mir viel größer. Was auch immer es war, es kam näher.
Ich blickte zurück. Der fremde Autofahrer war nun auch schon ziemlich nahe, lachte immer noch. Und dann stutzte er, blieb stehen, sah über die Schulter zurück. Etwas kroch hinter ihm empor – grau, dunkel, undefinierbar. Eine breiige Masse, aber gleichzeitig auch irgendwie körperlos. Es verharrte kurz auf dem Kopf des Mannes, dann lief es wie Honig über sein Gesicht. Der Fremde schrie auf. Ich drehte den Kopf weg, kniff fest die Augen zu, um nichts mehr sehen zu müssen und wünschte mir, es würde stimmen, was ich als kleines Mädchen geglaubt hatte – dass ich unsichtbar würde, wenn ich die Augen nur fest genug zumachen würde. Nein, ich sah nicht hin. Aber die Ohren konnte ich nicht verschließen. Selbst als ich sie mir zuhielt, hörte ich, wie die Schreie des Mannes in einem Gurgeln untergingen. Nein, eigentlich war es eher, als würde man ihm ein Kissen aufs Gesicht drücken. Schreien, Röcheln, ein verzweifeltes nach Luft schnappen. Dann vernahm ich noch ein Geräusch wie rieselnder Sand. Danach war es still.
Vorsichtig hob ich den Kopf und blickte zu der Stelle, an der der Mann gestanden hatte. Da war keiner. Auch sonst war niemand zu sehen. Nur eine vertraute Bewegung aus dem Augenwinkel – und ein leises Summen. Ein zufriedenes Summen.
Ich kroch zurück zur Straße und redete mir ein, ich hätte nur geträumt. Mein Knöchel schmerzte höllisch. Trotzdem kroch ich an dem leeren, fremden Auto vorbei zurück zu meinem Wagen, bevor ich endgültig zusammenbrach.
Als es hell wurde, kam endlich ein Fahrzeug vorbei, das ich anhalten konnte. Das ältere Ehepaar, das darin saß, war nett und hilfsbereit und brachte mich zum nächsten Arzt, der mir einen Verband um den verstauchten Knöchel legte, dafür sorgte, dass mein Wagen abgeschleppt wurde und mich ein Taxi abholte.
Einige Stunden später war ich wieder zu Hause. Meine Schwester hatte den Anrufbeantworter vollgesprochen, weil ich mich nicht gemeldet hatte. Ich rief sie zurück und berichtete von meinem Missgeschick mit dem Auto und dem Knöchel. Vom Rest erzählte ich nichts.
Zwei Tage später fand ich in der Zeitung unter ‚Regionales’ einen kleinen Absatz, in dem von einem Mann berichtet wurde, der vermisst sei. Nur sein Auto mit allen Papieren und seiner Brieftasche darin hatte man gefunden.
Ich fahre gern nachts Auto. Ich bin dann allein. Aber es macht mir nichts aus, auch mal zu laufen, egal wann. Auch in tiefster Nacht. Ich weiß, dass ich dann nie allein bin. Und dass mir deshalb auch nie etwas geschehen kann. Zumindest nichts wirklich Gefährliches.
08. Jul. 2012 - Ruth M. Fuchs
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



