
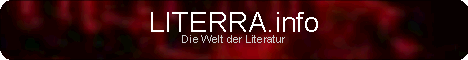
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Nina Horvath > Steampunk > Auf jedem Schiff, das dampft und segelt … |
Auf jedem Schiff, das dampft und segelt …
von Nina Horvath
Ich fuhr aus unruhigem Schlaf hoch. Sie waren zu dritt: ein Mann von der Schweizergarde, ein weiterer in einem feinen Anzug und eine Frau, die sich erst hinter ihnen durch die schmale Türöffnung zwängte. Sie trug eine Art Schweißerbrille, die sie jedoch lediglich dazu benutzte, verirrte Strähnen ähnlich wie mit einem Haarreifen zurückzuhalten. Sie sah streng aus, mit den zurückgekämmten und geflochtenen Haaren und mit ihrer weißen, hochgeschlossenen Bluse, die vorne durch ein breites schwarzes Band geschnürt war. Ihre Beine steckten in halbtransparenten weißen Strümpfen, über denen sie einen kurzen Rock trug.Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich sie in dem Aufzug für ein Dienstmädchen gehalten: Aber den strafte nicht nur die offiziell wirkende Armbinde, sondern vor allem der an der Hüfte befestigte und sehr wohl gefüllte Waffengurt Lügen.
Sie musterte mich forschend und sah sich dann im Zimmer um.
»Kein Wunder, dass dem Kerl die Kreativität flöten geht, wenn er tagein, tagaus in dem Loch sitzt!«, meinte sie an den Anzugträger gewandt.
Der verzog abschätzig die Lippen.
»Ich glaube schlichtweg nicht, dass dieser Heide hier irgendein Talent besitzt. Die bisherigen Erfindungen waren wohl Glückstreffer, wer weiß, wem er die Ideen geklaut hat. Ich meine, sehen Sie sich den doch an!«
Ich wusste genau, was er sehen musste: einen schmächtigen Burschen mit zerzausten Haaren und mit noch verschwollenen Augen. Ich schlief viel in letzter Zeit. So gut wie immer, wenn ich mir selbst überlassen wurde, legte ich mich hin und fiel schon bald in unruhigen Schlummer.
»Wie dem auch sei, ich habe meine Anweisungen!«, sagte die Frau barsch.
»Na, ob das wirklich Sinn hat …?«, gab er zu bedenken.
»Es steht keinem von uns zu, einen Befehl zu hinterfragen!«, gab sie scharf zurück: »Und überhaupt, was machen Sie noch hier? Glauben Sie, es bringt was, wenn wir hier zu viert herumstehen?«
Er öffnete wieder den Mund, schloss ihn aber, ehe ihm ein Laut entfuhr, und meinte dann: »Gut, wie Sie meinen. Die Sache liegt ab sofort in Ihrer alleinigen Verantwortung!«
Damit rauschte er zur Tür heraus, den Gardisten im Schlepptau.
Mein Blick pendelte zwischen der Frau und der immer noch offenen Tür hin und her. Es war verlockend, allerdings wusste ich, dass ich nicht weit kommen würde. Ich konnte ja wohl kaum an dem Gardisten vorbei durch das schmale Treppenhaus entwischen. Dazu war ich noch im Nachtgewand und vor allem barfuß. Nein, so banal das klang, aber Schuhe konnten durchaus entscheidend auf einer Flucht sein.
»Wir gehen sowieso raus«, meinte die Unbekannte, da sie offenbar meinen Blick bemerkt hatte: »Aber nicht in diesem Aufzug!«
Ich erstarrte.
»Na los, was ist, zieh dir was an!«
Ich machte keine Anstalten, der Aufforderung nachzukommen. Die Frau schnaubte und meinte: »Bitte, mein Seelenheil kommt dadurch auch nicht mehr in Gefahr!«
Sie ging jedoch dennoch nach draußen und zog sie Tür hinter sich zu. Nach einer Minute klopfte sie aber bereits und trat dann ohne Vorwarnung ein, ohne sich darum zu scheren, dass ich mein Hemd noch nicht zugeknöpft hatte.
»Und jetzt Abmarsch!«
»Wohin gehen wir?«, fragte ich, während ich ihr den schmalen Gang und die noch schmälere, gewundene Treppe folgte und mich dabei noch mit dem Schließen der Knöpfe abmühte.
»Raus«, sagte sie knapp.
Als wir ins Freie traten, schien mir alles seltsam surreal. Es war ein warmer, geradezu strahlender Tag. Ich schloss geblendet die Augen, aber die Sonnenstrahlen fühlten sich gut auf meiner Haut an.
Sie zog sich ihre seltsame Brille aus dem Haar und gab sie mir.
»Setz die erst mal auf, bis sich deine Augen an das Licht gewöhnt haben. Dann sehen wir uns die Stadt an.«
Natürlich traute ich dem Braten nicht und hätte gerne die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, in einer der Seitengassen zu verschwinden. Doch es waren überall Schweizergardisten und Angehörige des Gendarmeriekorps unterwegs. Nein, wenn ich wirklich eine Chance haben wollte, dann gab es sicher noch bessere Möglichkeiten! Also setzte ich die Brille mit den abgedunkelten Gläsern auf und ging einfach neben der jungen Frau her.
Sie führte mich durch ein Museum und erzählte dann und wann ein bisschen über die Ausstellungsstücke. Trotz der Pracht konnte ich mich nicht so recht darauf einlassen.
»Und hier das berühmte Fresko von Michelangelo. Die allseits bekannte Dampfmaschine ist jedoch nicht original, sondern wurde erst um 2300 …« Sie brach ab, offensichtlich hatte sie meine geistige Abwesenheit bemerkt.
»Was tun wir hier eigentlich?«, murmelte ich.
»Wir sehen uns die Stadt an. Oder wäre es dir lieber, ich bringe dich wieder zurück?«
»Nein«, erwiderte ich schnell, »oder ja, irgendwie … ich meine … da wusste ich wenigstens, woran ich bin!«
»Oh du heilige Einfalt!«, meinte sie. »Und ich dachte, schön, ein technikversierter Mensch schätzt neue Eindrücke.«
»Ja, schon … aber es ist mir irgendwie unheimlich. Haben Sie keine Angst, dass ich verschwinde?«
»Nein, ich weiß, dass es keine Möglichkeit zu fliehen für dich gibt.«
Ich war ehrlich überrascht über diese Selbstsicherheit.
»Es gibt insgesamt nur vier streng bewachte Ein- und Ausgänge durch die Stadtmauer und mit einer Suchmeldung wärst du da schnell gefasst. Zeppeline dürfen nur mit Sondererlaubnis über die Vatikanstadt fliegen, die selten genug ausgestellt wird und sie müssen dabei eine Mindesthöhe einhalten und dürfen nur am streng gesicherten Flugplatz in Sinkhöhe gehen. Man ist da sehr rigoros und durchaus bereit, Fluggeräte, die sich nicht an die Bestimmungen halten, abzuschießen.«
»Ich könnte erst mal in der Stadt untertauchen«, warf ich ein und verfluchte mich selbst im gleichen Augenblick dafür, den Gedanken laut ausgesprochen zu haben.
»Das ist reichlich unwahrscheinlich. Das Leben hier ist streng reglementiert. Du hast kein Geld und niemand gibt dir ohne Papiere Arbeit, denn die Strafen sind sehr hoch. Es gibt auch niemanden hier, der dir Unterschlupf gewähren würde. Betteln ist verboten, ebenso wie Obdachlosigkeit. Sobald du irgendwo auf der Straße schläfst, wird man dich aufgreifen. Es wäre nur etwas unerfreulich für dich und mich persönlich, aber ich bin sicher, dass du nicht mal eine ganze Nacht lang untertauchen könntest.«
Genau in dem unpassenden Moment gab mein Magen ein Geräusch von sich. Sie runzelte die Stirn und meinte: »Gehen wir was essen, da kann ich dir ja dann deine Fragen beantworten.«
Wir verließen das Museum und sie steuerte ohne viel Federlesens auf ein schmales Ladenlokal zu. Drinnen angekommen tratschte die Verkäuferin gerade mit einer Kundin. Ansonsten war nicht viel los.
Fasziniert betrachtete ich eine monströse, dampfende Maschine. Ich nahm an, dass sie zur Zubereitung von Kaffee diente.
Sie stellte sich geduldig an, nach einigen Minuten meldete sie sich aber doch zu Wort.
»Ich habe nichts an dich zu verkaufen«, sagte die Hausherrin schließlich schnippisch.
»So? Dann helfe ich dir suchen!«
Sie trat energisch hinter die Theke, knallte Kleingeld auf die Theke und fasste zwei belegte Brötchen heraus.
»So geht das nicht!«, rief die Verkäuferin.
»Wie geht das nicht? Ich habe Ware genommen und dafür bezahlt. So ist das in Geschäften nun mal üblich. Und wenn es Ihnen nicht passt, räuchern Sie hinter mir Ihre Bude mit Weihrauch aus, aber kommen Sie mir nicht mit Sprüchen wie Dann rufe ich die Gendarmerie! Die kommt wegen so etwas nicht.«
Sie stürmte hinaus und ich tat mein Möglichstes, ihr so schnell wie möglich zu folgen.
Sie hatte sich inzwischen beruhigt, setzte sich gelassen auf eine Bank in die Sonne.
»Fisch oder Fleisch?«, fragte sie. »Ich habe einfach irgendwas genommen.
»Ähm, ich …«, stammelte ich, »ich bin nicht wählerisch.«
»Kann ich mir gut vorstellen, ich glaube nicht, dass sie dir als Gefangenem ein tolles Menü serviert haben.«
Sie drückte mir eines der Brötchen in die Hand, in dem sich mehrere Stücke Presswurst befanden, und begann selbst das andere zu essen.
»Was war das eben im Laden?«, fragte ich.
»Ach das, das passiert mir öfter mit meiner Uniform. Arrogantes Pack, diese Leute!«
Ich biss ebenfalls in meine Semmel. Die Wurst war nicht überragend, vermutlich enthielt sie keinerlei tierische Produkte, sondern irgendein Algenzeug, das sie in Pools auf den Dächern der größeren Gebäude heranzogen, aber das Brot war zumindest frisch und knusprig.
»Ich bin immer noch ratlos, was das alles soll. Offenbar sollen Sie mich ja dazu motivieren, am Projekt weiter zu arbeiten. Aber wie soll das geschehen? – Ein Ausflug wird mich nicht bekehren. Und warum Sie? Sind Sie … von einem der Orden?«
Sie verschluckte sich und begann zu husten.
»Von einem Orden«, presste sie schließlich hervor. Ihr Gesicht war rot angelaufen. »Du weißt ja wirklich gar nichts!«
»Was ist an der Vorstellung so absurd? Es gibt auch Frauenorden.«
»Es gibt auch Frauenorden«, äffte sie mich nach. »Gott im Himmel!«
Sie schlug sich mit der freien Hand gegen die Stirn.
Nun verstand ich gar nichts mehr.
»Das da«, sie zeigte mir ihre Armbinde: »Atheistenkorps, verstehst du das?«
»Was, im Vatikan? Im Vatikan gibt es keine Atheisten.«
»In grauer Vorzeit, guter Mann! Natürlich nehmen sie nicht jeden Dahergelaufenen, aber ich bin sogar Vatikanbürgerin. Irgendwer muss ja die Drecksarbeit machen, mit denen sich das abergläubische Völkchen nicht die Hände schmutzig machen will.«
Nun war es an mir, mich zu setzen. Was sie mir da erzählte, war geradezu ungeheuerlich.
»Pst, leise! Was, wenn Sie jemand hört!«
Angesichts ihrer sicherlich mehr als gotteslästerlichen Worte sah ich sie schon vom nächsten Strick baumeln.
»Reg dich ab«, meinte sie, »ich bin eine registrierte Atheistin, man weiß, wie ich zu dem Thema Religion stehe. Und nein, selbstverständlich hat man mich nicht auf dich angesetzt, um dich zu bekehren. Das haben immerhin schon ganz andere versucht und sind daran offenbar gescheitert.«
Ich wickelte das Brötchen wieder ein und legte es neben mich, während sie noch einmal von ihrem abbiss, ehe sie meinem Beispiel folgte.
»Und hör endlich mit dem Gesieze auf. Ich heiße Sigena. Also, so wie ich das sehe, ist das so: Sie wollen dich, warum auch immer, im Vatikan haben. Am liebsten natürlich als katholischen Bürger, was ihnen aber nicht gelungen ist. Nachdem sie mit ihrer Umpolung kläglich versagt haben, kommt jetzt Plan B. Ich soll dich demnach ganz ohne christliches Gewäsch davon überzeugen, deine Arbeitskraft dem Vatikan zur Verfügung zu stellen.«
»Ich verstehe das trotzdem nicht … der Vatikanstaat beruht auf religiösen Grundsätzen, ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand, der keine oder eine andere Religion hat …«, entgegnete ich.
Sie verzog unwillig das Gesicht.
»Es ist im Laufe der Geschichte noch nie nur um Religion gegangen. In jedem solchen System geht es im Grunde genommen um Macht. Wenn du die Entscheidungen des Papstes nicht anzweifelst, kannst du dich auch, ohne deinen wie auch immer gearteten Überzeugungen untreu zu werden, gut mit dem System arrangieren.«
»Du … du unterstützt den Papst? Als Atheistin?«
Mein Weltbild war erschüttert. Ich hatte genug Geschichten gehört, was im Vatikan mit Ungläubigen geschah. Dagegen mochten die Qualen der Hölle wie ein Sonntagsspaziergang anmuten. Und hier saß diese Frau, die ihre antireligiöse Einstellung offen zur Schau trug und sich freiwillig in den Dienst des Mannes stellte, der für uns Atheisten das war, was für die Christen der Teufel sein musste!
Sigena hingegen zuckte gleichmütig mit den Schultern.
»Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, ist einer, der die Sache regelt.«
Nach diesem Spruch biss sie noch einmal herzhaft von ihrem Brötchen ab.
»Du vergleichst den Papst mit dem Kapitän eines Schiffes?«
»Wieso nicht?«, sagte sie immer noch kauend und schluckte dann energisch hinunter. »Der Papst ist ebenso wie der Kapitän eines Schiffes für seine Besatzung zuständig. Er bestimmt, wer an Bord kommt und sein Wort ist Gesetz. Anders kann es gar nicht funktionieren. Beim Papst ist es eben die Religion, die sein Schiff zusammenhält, und wenn ich mir so ansehe, wie es außerhalb dieser Mauern zugeht, dann bin ich froh, dass es diesen Mann gibt. Sag jetzt nichts mehr dazu, denk drüber nach, wenn du wieder zu Hause bist.«
»Mein Zuhause ist weit weg«, sagte ich.
»Es wird hier sein, in der Heiligen Stadt.«
Wir aßen schweigend zu Ende und machten dann einen langen Spaziergang durch die Stadt. Eines musste man Sigena lassen: Sie verstand es, mich an die schönsten Plätze zu führen. Erst die beeindruckenden Kunstsammlungen, dann ein Gang zu den malerischsten und verstecktesten Winkeln der Stadt. Dennoch sah ich mich immer wieder verstohlen um. Aber es ergab sich keine Möglichkeit, bei der sich die Flucht tatsächlich gelohnt hätte. Die Schweizergarde und das Gendarmeriekorps schienen überall zu sein und wenn Sigena sie zu sich rief, würden sie mich wohl auf der Stelle wieder einfangen. Außerdem wusste ich nun, worauf ich zu achten hatte: ein Versteck, in dem ich die Nacht ausharren konnte. Wenn Obdachlosigkeit unter Strafe stand, brauchte mich schließlich jemand nicht einmal zu erkennen, damit ich wieder in Gewahrsam wanderte! In diesen sauberen Straßen voller Menschen würde mir das nicht gelingen und fast wehmütig dachte ich an Dörfer voller Ruinen und Gerümpel, wie man sie im umliegenden Land zuhauf vorfand. Dort konnte man sich ohne größere Schwierigkeiten wochenlang verstecken, aber hier im Vatikan?
Letztendlich ließ ich es jedoch zu, dass mich Sigena wieder an dem Platz ablieferte, den sie zu meinem Ärger als mein Zuhause bezeichnete.
Ich war nicht lange wach, ganz im Gegenteil war ich trotz meiner unruhigen Gedanken sehr schnell todmüde. Vermutlich war es der inzwischen ungewohnte Spaziergang an der frischen Luft gewesen. Anders als sonst fiel ich auch nicht in diese unangenehme Betäubung, sondern mein Verstand war nahezu augenblicklich ausgeknipst.
Am nächsten Morgen erwachte ich frisch und ausgeruht, aber Sigena tauchte nicht auf. Sie kam den ganzen Tag über nicht, und so ungern ich es mir eingestehen wollte, war ich maßlos enttäuscht. Nachdem ich die Luft scheinbarer Freiheit geatmet hatte, fiel es mir wesentlich schwerer, mich mit der weitgehend dunklen Dachkammer mit ihrer niedrigen Decke abzufinden.
Doch am übernächsten Tag kam Sigena wieder.
So geschah es noch drei Mal hintereinander, wobei unsere Ausflüge immer kürzer wurden. Es war für mich, als würde die Sonne erst scheinen, wenn Sigena mich nach draußen führte. Natürlich sah ich einen gewissen Plan darin: Man zeigte mir, wie es war, wenn ich ihr Gefangener bliebe – und man führte mir vor, wie es sein könnte, wenn ich mich als Bürger in diese Gesellschaft eingliederte.
Als Sigena wiederkam, wirkte sie ernst.
»Was ist?«, fragte ich sie alarmiert.
»Ich habe wieder einen neuen Auftrag bekommen«, sagte Sigena ernst. »Und wie ich gehört habe, konntest du dich immer noch nicht entscheiden, ordentlich zu arbeiten und deinen Treueschwur auf den Staat abzulegen. Ich werde nun aufs Äußerste gehen: Ich zeige dir die dunkle Seite der Stadt!«
Dieses Mal gingen wir nicht, sondern bestiegen die Bahn. Die Gleise führten am Stadtrand entlang, waren teils in luftigen Höhen auf pfeilerbewehrten Gebilden verlegt und führten schließlich durch die Stadtmauer. Während der Fahrt kamen zwei Beamte und ließen sich von Sigena einige Papiere aushändigen, die sie sorgfältig kontrollierten. Wir steigen erst an der Endhaltestelle aus, und als wir hinaustraten, traute ich meinen Augen nicht. Ödes Land, Staub, Wellblechhütten.
»Sind wir hier noch im Vatikan?«, fragte ich.
»Es ist ein Übergangsraum, nenne es ein Niemandsland, in dem Einreisewillige abwarten können, bis ihre Anträge geprüft wurden. Willkommen auf der dunklen Seite, dem Ort, wo man alles bekommt, woran man im restlichen Vatikan nicht rankommt!«
Sie ging mit mir durch die trostlose Gegend. Als ich stehen blieb, um mir ein verrostetes und patronendurchlöchertes Schild anzusehen, gesellte sich eine kleine, schmutzige Gestalt zu mir. Das Kind mochte bestenfalls im Grundschulalter sein und es war schwer zu sagen, ob die magere Gestalt mit den halblangen, strähnigen Haaren ein Bub oder ein Mädchen war. Sie redete mit einigen Wortfetzen verschiedener Sprachen auf mich ein. Der Stimme nach zu urteilen war es ein Mädchen.
»Weg da!«, sagte Sigena grob zu ihm.
Das Kind trollte sich, jedoch nicht, ohne noch im Gehen eine unfeine Geste in Richtung Sigena zu machen.
»Was wollte die Kleine?«, fragte ich sie.
»Wie ich schon sagte: Man bekommt hier alles, das es anderswo nicht gibt. Vorausgesetzt, man hat Geld. Aber man braucht nicht viel, jedenfalls nicht für das hier.«
Sie klang verächtlich.
»Was wollte sie verkaufen?«
Sigena sah mich an, als hätte ich etwas unglaublich Dummes gefragt und als überlegte sie, ob ich überhaupt eine Antwort verdient hatte.
»Sich selbst.«
Ich war bestürzt, fing mich aber wieder: »Und das wolltest du mir zeigen?«
»Nicht nur das, aber auch.«
»Du meinst, wenn ich sehe, was Menschen tun, um Vatikanbürger zu werden, werde ich mich umstimmen lassen?«
»Vielleicht«, meinte sie: »Aber vor allem wollte ich dir den Markt zeigen. Wer Vatikanbürger ist und sich doch nicht ganz an die Gesetze halten kann, bekommt hier alles, was ihm möglicherweise fehlt, wenn er nur ein paar Stationen fährt. Drogen, Waffen, sexuelle Dienstleistungen, was auch immer.«
»Das ist ja krank!«, entfuhr es mir: »Schätzt du mich so ein?«
»Ich schätze dich gar nicht ein, ich kenne dich auch nicht wirklich. Aber die wenigsten Menschen kommen mit arbeiten, beten und Enthaltsamkeit ihr Leben lang aus.«
»Ich habe aber auch Kinder in der Vatikanstadt gesehen, so weit her kann es mit der Enthaltsamkeit nicht sein«, gab ich zurück.
»Nicht-Geistliche dürfen auch heiraten, aber außerehelich ist es verboten. Natürlich wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird; gerade ledige Kinder gibt es auch genug, aber wenn man wem was Böses will, kann man ihn so drankriegen. Und in der Öffentlichkeit darf man sich eben nicht sehen lassen. Viele recht normale, unverheiratete Paare fahren auch hierhin, um sich einfach nur so in trauter Zweisamkeit zu treffen.«
Wir schlenderten weiter und kamen zu dem, das Sigena als Markt bezeichnet hatte. Tatsächlich war der Platz belebt und es wurden nicht nur die Waren angeboten, die mir Sigena angekündigt hatte: Es gab auch noch Stände mit Obst und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, aber auch lebende Hühner, Tauben, Kaninchen und andere Kleintiere.
»Hier sieht es fast aus wie zu Hause am Markt, nur dass die Leute keine Tische haben«, sagte ich überrascht.
»Na, die müssen ja auch mit einem Griff alles packen können und davonlaufen, immerhin ist das hier ein illegaler Markt. Ich habe das mal gesehen, es ist echt faszinierend, wie schnell sie alles in den Tüchern eingeschlagen haben und der Platz vollkommen leer ist. Ach ja, besser keine Milchprodukte, frisches Fleisch oder Pilze. Das ist teilweise aus Gegenden mit sehr hoher Strahlung und das wird alles nicht kontrolliert.«
»Bist du eigentlich im Vatikan geboren?«, fragte ich unvermittelt.
»Nein, aber wir kamen so früh hierher, dass ich mich an kaum etwas anderes mehr erinnern kann.«
»Was machen deine Eltern beruflich?«
»Mama hat in einer Ganztagsschule gekocht, aber sie ist dann weggegangen, als mein Vater starb. Ich hatte damals nicht gewusst, wie schwer es ihr gefallen ist, sich anzupassen. Dabei hatte sie nie mit der Gendarmerie zu tun und die rückt mitunter schon bei Gesang in der Fastenzeit aus. Und sie hat nie in der Arbeit gefehlt und auch nichts Kritisches gesagt, nicht mal, als wir unter uns waren. Aber als dann mein Vater nicht mehr war, sagte sie mir auf einmal, dass ich alleine besser zurechtkommen würde und sie würde all das nicht mehr ertragen. Ich weiß noch, wie das war, als sie sich verabschiedete. Sie nahm nur ein paar Dinge in einem Leiterwagen mit und sie ging ganz alleine. Das war schon eine seltsame Sache, ich habe lange gebraucht, bis ich sie halbwegs verstanden habe.«
Wieder schwiegen wir lange, dann hellte sich Sigenas Miene plötzlich auf, als hätte sie nie über diese traurige Sache gesprochen.
»Genau das habe ich gesucht!«, meinte sie an mich gewandt und ging dann zu einem Stand, wo sie lautstark mit einem der Händler um eine Flasche mit einer grünlichen Flüssigkeit feilschte. Schließlich einigten sie sich auf einen Preis und zwei Gläser eines Schnapses, den wir direkt am Stand trinken konnten. Der edle Tropfen, als den der Händler ihn anpries, war ein Gesöff sondergleichen. Er brannte in der Kehle und es hätte mich nicht gewundert, wenn ich davon augenblicklich erblindet wäre. Trotzdem wollte ich mir vor Sigena nicht die Blöße geben, das halb volle Glas wieder zurückzugeben, also trank ich tapfer aus.
Wir schlenderten noch eine Weile über den Markt. Sigena blieb an einem weiteren Stand stehen.
In einigen Käfigen hockten Kaninchen. Sie ging vor einem Käfig in die Knie, in dem sich ein großes Tier und zahlreiche kleine Häschen befanden. Sie steckte einen Finger durch das Gitter und lächelte, als eines der Tiere daran schnupperte.
Genau an dieser Stelle zweigte eine enge Seitengasse ab. Sigena war abgelenkt und hockte dazu in einer so ungünstigen Position da, dass sie wohl kaum innerhalb einer Sekunde auf den Beinen sein würde. Also überlegte ich nicht mehr lange und lief, so schnell ich konnte, los.
Doch meine Flucht dauerte nicht lange, dann spürte ich etwas, als ob sich eben etwas in meinen Arm und in meinen Bauch gebohrt hätte. Aber es war eindeutig keine Kugel und ich hatte auch das typische Knallen eines Schusses mit Schwarzpulver nicht gehört.
Kurz darauf jagte mir ein entsetzlicher Schmerz durch den Körper und ich ging zu Boden. Etwas schien mit grausamer Gewalt durch mich hindurch zu fließen. Alle meine Muskeln waren so schmerzhaft verkrampft, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte.
Sigena trat zu mir und riss mir eine dicke Nadel aus dem Arm. Sie war über einen feinen Draht mit der Waffe verbunden, die sie die ganze Zeit über im Halfter getragen hatte.
Natürlich war mir die Waffe bewusst gewesen, aber da Sigena den Auftrag hatte, mich leben zu lassen, hatte ich nicht geglaubt, dass sie tatsächlich auf mich schießen würde. Zusätzlich hatte mich ihre scheinbare Unbekümmertheit, was meine Fluchtchancen betraf, dazu verleitet, keine Gefahr diesbezüglich zu sehen.
Sie stieg einfach über mich, zog ein Messer aus ihrem Stiefel und zerschnitt mir das Hemd, ehe sie vorsichtig die zweite Nadel aus meinem Bauch zu. Ihr war sicher klar, welche Wirkung ihre Waffe gehabt hatte und dass ich mich immer noch nicht bewegen konnte.
»Das war sehr dumm von dir«, sagte sie langsam, während sie immer noch vor mir hockte: »Ich bin im Moment der beste Freund, den du hast.«
Es dauerte lange, bis ich mich wieder bewegen konnte.
»Was war das?«, fragte ich.
»Eine Distanz-Elektroimpulswaffe.«
»Eine elektrische Waffe? Ich dachte, die Stromnutzung ist im Vatikan verboten!«
»Nicht für die Ungläubigen«, erwiderte sie kalt. »Und, was ist? Kannst du aufstehen?«
Ich erhob mich, war aber noch sehr wackelig auf den Beinen.
»Wir werden uns mit einer Rikscha zum Bahnhof bringen lassen und dann geht es ab nach Hause.«
Sie betonte die Worte am Ende absichtlich, denn sie wusste genau, dass ich den Vatikan nie und nimmer als mein Zuhause ansehen würde.
Das war vorerst der letzte Ausflug, den Sigena und ich miteinander unternahmen. Ich blieb allein zurück, in dem kleinen, düsteren Raum. Ich bekam schweigend das Essen hereingestellt.
Nach ein paar Tagen wurde ich wieder abgeholt. Und als ich in die Werkstatt gebracht wurde, war ich bereit, zu arbeiten.
Ich hatte immer gedacht, dass sie meinen Willen bestenfalls mit Gewalt brechen würden. Gut, sie hielten mich gewaltsam fest, aber seit ich im Vatikan war, hatte es mir nie an überlebensnotwendigen Dingen gefehlt, war ich niemals geschlagen worden.
Doch ich hatte die Einsamkeit kennengelernt, kein kurzzeitiges Alleinsein erfahren, sondern dieses alles durchdringende Gefühl der Verlorenheit in einer kleinen, dunklen Welt.
Wenn ich meine Sache gut machte, konnte ich mich nachher ein wenig mit einem der Wachposten unterhalten. Es war nicht viel, aber doch der Strohhalm, nach dem ich wie ein Ertrinkender griff.
Auf dem Weg zur und von der Werkstatt konnte ich den freien Himmel sehen und machte mir selbst Vorwürfe, dass ich diesen lächerlichen Fluchtversuch unternommen hatte. Andererseits, so sagte ich mir dann, hätte ich es nicht geglaubt, dass es tatsächlich nicht funktionierte, wenn ich es nicht zumindest einmal probiert hätte! Nach diesem Erlebnis war ich vorerst von jeglichen weiteren Versuchen dieser Art kuriert. Offenbar hatte man es bemerkt und ich war erstaunt, als man mich alleine gehen ließ.
Natürlich war es lediglich der Umzug von einem winzigen Käfig in eine Voliere: Man hatte mir Papiere ausgestellt und ich hatte fast eine Stunde gebraucht, die eingestempelten und eingedruckten Vermerke zu lesen und gut die Hälfte war derartig schlimme Amtssprache, dass ich sie nicht verstand. Aber so weit ich das beurteilen konnte, durfte ich nicht ausreisen, keine Arbeit annehmen, keine Wohnung kaufen oder mieten und musste mich öffentlich als Atheist kennzeichnen. Nun verstand ich auch, wofür das verschnörkelte A auf Sigenas Armbinde stand.
Kurz und gut: Meinem Ziel, zu entkommen, brachte mich meine neu gewonnene Freiheit nicht näher, ganz im Gegenteil schien sie mich sogar noch fester an diesen Stadtstaat zu ketten. Es war jedoch auch ein beruhigendes Gefühl, diesen geregelten Tagesablauf zu haben. Aufstehen, frühstücken, arbeiten, Mittagspause, arbeiten, Abendessen, Freizeit. Abends machte ich oft lange Spaziergänge, und nachdem ich meinen anfänglichen Abscheu überwunden hatte, staunte ich über die großartigen Bauwerke, aber auch über die prunkvollen Gärten. Das war so ganz anders, als ich es von zu Hause kannte, die zweckmäßigen Häuser hinter der Mauer, wo immer und überall alles nur notdürftig geflickt wurde. Es war schwer, als kleine zivilisierte Ansiedlung inmitten der allgemeinen Anarchie zu überleben und es war immer klar gewesen, dass unser Ende gekommen sein würde, falls uns mehr als ein paar gewöhnliche Wegelagerer entdeckten. Hier hingegen war alles so sicher, so schön, so geregelt …
Eines Tages fiel mir bei meinem abendlichen Spaziergang eine Menschenmenge vor einer Kirche auf. Ich blieb stehen, um zu sehen, was vor sich ging. Es war nicht sonderlich spektakulär, offensichtlich wurden die meisten von ihnen nach der Kontrolle von einer Einladungskarte eingelassen. Doch dann fiel mein Blick auf die beiden Personen, die da draußen Wache hielten: Beide waren schwarz-weiß gekleidet, ein Mann und eine Frau. Die Frau war nicht sonderlich groß, eher zierlich, und als sie sich einmal drehte, wusste ich, dass es Sigena war.
Ich kam näher und rief nach ihr. Als ich näher kam, stellte sich mir der Mann in den Weg. Sigena sah genau in dem Moment von der Kontrolle auf.
»Lass ihn, ich kenne ihn«, sagte sie zu dem Mann und winkte die Frau, die ihr die Einladung gezeigt hatte, durch. Er sah sie überrascht an und wich dann zur Seite, wobei er mich jedoch nicht aus den Augen ließ. Mir fiel auf, dass er kein Atheist war. Wie schnell man doch dazu überging, auf derartige Dinge zu achten! Ich konnte seinen Widerwillen fast körperlich spüren, während mich Sigena nun ungewohnt freudig begrüßte.
»Was macht ihr hier?«, fragte ich sie.
»Ach, nichts sonderlich Spannendes. Wir schauen, dass nur Leute mit Einladungen und gültigen Ausweisen und ohne Waffen in die Kirche gehen, da sich hoher Besuch angekündigt hat. Oder schreiten ein, wenn es drinnen ein Problem gibt. Oder genauer gesagt tue ich das, weil man als Christ keine Waffen in den Gotteshäusern benutzt.«
Sie erzählte, als sei das das Normalste der Welt, mir erschloss sich diese Logik allerdings bei Weitem nicht so eindeutig. Ich hatte das Gefühl, dass der Glaube im Vatikan auch sehr viel mit Aberglauben zu tun hatte; so war mir auch aufgefallen, dass bei Heiligenbildern durchaus irdische Opfergaben – nicht nur Blumen, Kerzen und Votivgaben, sondern auch Speisen und Getränke – ihren Platz fanden. Manche Menschen bekreuzigten sich auch an jeder Wegzweigung – oder auch bei anderen Anlässen, wenn jemand in Hörweite fluchte oder sogar, wenn sie es mit einem ihrer Ansicht nach Ungläubigen zu tun hatten. Neben den Atheisten gab es auch wenige Anhänger anderer Religionen, die sich ebenfalls durch ihre Kleidung kennzeichnen mussten und die mindestens ebenso strengen Regeln wie wir Atheisten unterworfen waren. Doch es gab auch immer wieder Ausnahmen, die den Katholiken verboten, ihnen aber gestattet waren. Im ersten Moment kam mir das absurd vor, andererseits war es wohl eine schlichte Notwendigkeit, in manchen Angelegenheiten Ausnahmen zuzulassen – und selbst hier lieferte die Religion die Antwort. Man musste anderen die Privilegien nicht neiden – immerhin tauschten sie dafür ihr Seelenheil gegen ewige Verdammnis in der Hölle. Dennoch konnte das System nur funktionieren, weil sie die Zahl der Nicht-Christen sehr strengen Quoten unterwarfen.
»Stimmt das eigentlich, dass du konvertierst?«, riss mich Sigena aus meinen Gedanken.
»Ich?« Nun war ich wirklich baff. »Wie kommst du denn da drauf?«
»Habe ich so gehört.«
»Nein, hatte ich nicht vor. Muss ich denn?«, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf und sah zu ihrem Kollegen hinüber, der inzwischen alleine die vereinzelt eintrudelnden Kirchengänger abfertigte.
»Es macht einiges leichter, aber es kann dich keiner zwingen«, sagte sie.
»Arbeitest du auch mal wieder was?«, mischte sich nun der Kollege ein.
Sigena murmelte leise etwas, aber man merkte ihr, auch ohne es zu verstehen, ihren Ärger deutlich an.
»Du hörst ja, die Pflicht ruft«, sagte sie.
»Kann ich dich wiedersehen?«, fragte ich.
Sie überlegte kurz, dann sagte sie: »Hast du immer noch dasselbe Quartier?«
Ich bejahte.
»Gut, heute geht es nicht, aber ich kann dich morgen Abend abholen. Wir können dann essen gehen oder so.«
Es war eine seltsame Situation – ich wartete ungeduldig, während mich eine Frau abholen sollte, um mich auszuführen. Ich fragte mich, wo wir hingehen würden. In der Gegend, wo ich aufgewachsen war, gab es diese Vielzahl an Geschäften und Restaurants gar nicht. Es gab den Markt, zwei Bäcker und eine Gaststätte, wo ohnehin jeder jeden kannte.
Ich sah auf die Wanduhr, Sigena war schon bald eine halbe Stunde überfällig. Dann stellte ich mich in der Waschecke vor den Spiegel und fuhr mir mit einer fahrigen Bewegung mit gespreizten Fingern durch die Haare.
Ich rümpfte die Nase, als ich mich selbst so sah, wie mich andere wahrnehmen mussten: helle, halblange und immer zerstrubbelt aussehende Haare über einem nichtssagenden Gesicht. Die Augen waren in Ordnung, aber waren die nicht von jedem gesunden Menschen ähnlich? Dazu viel zu schmale Schultern unter einem zu großen Hemd, das nicht einmal mein eigenes war.
Ich seufzte. Da wunderte mich nicht, dass ich versetzt wurde, denn was wollte eine Frau wie Sigena mit mir schon anzufangen, einem halben Gefangenen, ohne Geld, ohne Besitz und den Rest … nun, den zeigte mir schließlich der Spiegel. Plötzlich musste ich an Sigenas Kollegen denken, der sie so angefahren hatte, obwohl wir nur wenige Worte gewechselt hatten. War er denn eifersüchtig gewesen?
In Gedanken versunken, hätte ich fast das Klopfen überhört. Ich trat zur Tür, befürchtete erst, es könnte jemand anderer sein, aber es war tatsächlich Sigena.
»Tut mir leid«, sagte sie, »aber ich wollte erst gar nicht kommen, aber ich habe niemanden, den ich dir zum Absagen hätte schicken können und du hast hier ja auch kein Telefon.«
Erst jetzt sah ich, dass ihre ganze rechte Gesichtshälfte angeschwollen war.
»Was ist passiert?«, fragte ich.
»Ich sollte helfen, eine illegale Demonstration aufzulösen und habe dabei einiges abbekommen. Ist aber nicht weiter schlimm, also es ist nichts gebrochen, hat der Arzt gemeint, aber ich bin trotzdem völlig kaputt.«
»Komm doch erst einmal herein«, sagte ich. Im Licht der Petroleumlampe sah Sigena noch angeschlagener aus als im Halbdunkel in der Tür.
»Ich bleibe aber nicht lange«, sagte sie, ließ sich aber dennoch von mir zum Bett führen, das abgesehen von einem wackeligen Holzsessel die einzige Sitzgelegenheit darstellte.
»Magst du was trinken?«, fragte ich.
»Was hast du da?«
»Nur Wasser.«
Sigena verzog das Gesicht. »Ich glaube, heute brauch ich was anderes als Wasser.«
»Ich fürchte, damit kann ich nicht dienen.«
»Halten dich immer noch knapp, was? – Aber immerhin ist die Tür nicht zugesperrt. Ich hoffe, dass du es verstehst, dass ich jetzt nicht mehr ausgehen möchte, aber falls du nichts dagegen hast, könntest du uns was holen. Ich habe an der Ecke ein Lokal gesehen.«
Sie kramte in ihrer Tasche und hielt mir schließlich einen Geldschein hin. Mir war es natürlich peinlich, Bargeld einfach so anzunehmen.
»Na los, nimm schon, ich weiß doch, dass sie dir kein Geld geben.«
Schließlich rang ich mich doch dazu durch. Meine Hand streifte dabei die ihre, aber Sigena zuckte nicht zurück, sondern lächelte mir aufmunternd zu.
»Was soll ich denn mitbringen?«, fragte ich.
»Egal, lass dir am besten einfach das Tagesgericht für mich geben und such dir selbst was aus. Und bring auch was Ordentliches zu trinken mit.«
Es dauerte kaum zehn Minuten, bis ich wieder zurück aus der Eckkneipe war, die die Speisen bereits fertig gekocht verkaufte. Sigena saß erst steif und kerzengerade kniend in meinem Bett und es war auch für mich eine durch und durch unangenehme Situation. Sie hatte kaum Appetit, trank dafür aber umso rascher, während wir recht gezwungenen Small Talk führten, bei dem sie immer wieder einwarf, dass sie bald gehen würde.
Plötzlich sagte sie: »Weißt du eigentlich, dass ich dich erst in Verdacht hatte, dass dich die Sittenpolizei geschickt hat?«
»Die Sittenpolizei?« Ich war verwirrt. »Was sollte die Sittenpolizei Interesse an mir haben?«
»Nicht an dir, sondern an mir, um mir eins reinwürgen. Mir kam es total komisch vor, dass sie mir da einen Mann vor die Nase gesetzt haben. Einen Atheisten … und überhaupt eben.«
»Überhaupt eben, was meinst du damit?«
»Na ja, jung, schlank, blond, nicht dumm … und kein Christ …«
Sie nahm noch einen Schluck. Ihre Wangen waren gerötet und man merkte deutlich, dass sie immer gesprächiger wurde, je mehr ihr der Alkohol zu Kopf stieg.
»Und jetzt denkst du das nicht mehr?«
Sie schüttelte heftig den Kopf.
»Nein, dann hätten sie jemanden geschickt, der mir mehr Komplimente macht. Und sie hätten dich in ein hübscheres Gewand gesteckt.«
Sie kicherte und lehnte sich zur Seite.
»He, nicht umfallen!«
Ich nahm sie bei den Schultern.
»Pass auf, sonst kommt die Sittenpolizei«, sagte sie und kicherte erneut.
»Du mit deiner Sittenpolizei, wahrscheinlich gibt’s die gar nicht«, meinte ich, ohne jedoch loszulassen. Das Thema schien sie tatsächlich zu beschäftigen, so absurd mir das Ganze – und vor allem die Vorstellung, diese hätte mich engagiert, ausgerechnet mich! – auch vorkam.
Sie zuckte nicht zurück und löste sich auch nicht aus meinem Griff, als ihr mit einer Hand sachte über den Arm strich. Nun war ich mir sicher. Hatte sie es sogar so geplant und sich Mut angetrunken?
Ich wurde nun auch beherzter und drückte meine Lippen auf die ihren. Sie schien darauf regelrecht gewartet zu haben, denn sie ging auf den Kuss ein und lehnte sich mir nun entgegen, bis sie halb auf mir lag.
Die Art, wie sie nun reagierte, verriet alles über sie. Sie zierte sich nicht und hatte sicherlich schon so ihre Erfahrungen sammeln können. Aber sie spielte keine Spielchen mit mir, wie es eine Frau getan hätte, die ihre Reize allzu oft einsetzte und die nur nach einem neuen Kick suchte oder sie gar nur als Mittel zum Zweck einsetzte. Sie war ausgesprochen leidenschaftlich, ja, sie kam mir nahezu ausgehungert vor. Und in der Nacht verlor alles andere an Bedeutung, wer ich war, wo ich war, in diesem Moment zählte nur noch das, was zwischen uns beiden geschah.
Am Morgen erwachte ich und merkte schlaftrunken, dass jemand neben dem Bett kniete. Es war Sigena und in dem Moment war ich hellwach.
»Was ist?«, fragte ich.
»Ich suche meine Strümpfe«, erwiderte sie und zog sie nun unter dem Bett hervor.
»Die brauchst du nicht«, sagte ich und wollte sie zu mir ziehen, aber sie riss sich los.
»Doch, ich müsste schon längst unterwegs sein!«
»Bist du nicht freigestellt?«
»Nein, ich muss heute antreten. Verdammt noch mal, alles zerknittert!«
Sie zwängte sich in die Strümpfe und zog anschließend den Rock darüber wieder glatt. Dann lief sie hektisch zwischen der Waschnische und dem Bett hin und her, klaubte ihre Tasche vom Boden auf und durchsuchte die Utensilien neben der Waschschüssel.
»Wo hast du denn deinen Kamm?«, fragte sie.
»Hab keinen. Ich mach das mit den Fingern.«
Sie warf mir einen Blick zu, als hätte ich ihr eben offenbart, dass ich am liebsten kleine Kinder zum Frühstück verspeisen würde.
Als hinter ihr die Tür ins Schloss fiel, ließ sie mich verwirrt und allein zurück.
Dennoch ging die Arbeit für mich weiter – mir kam es sogar vor, als würde nun ein harscherer Ton angeschlagen. Hatte man meinen Verstoß gegen das Sittengesetz mitbekommen und deshalb meine Leine wieder kürzer genommen? Oder war es nur ein subjektives Gefühl? – Dass, je mehr Freiheit ich gekostet hatte, mir die Gefangenschaft umso schlimmer vorkam?
Doch auch die Arbeit veränderte sich: Während man mir anfangs mehr kleinere Basteleien übertragen hatte, wurden die Aufgabenstellungen zunehmend schwieriger.
Zuletzt saß ich da, neben mir allerhand Kleinteile und stoßweise verkritzeltes Papier, als man mich abholen kam.
»Kein Ergebnis?«, fragte mich der Mann. Ich kannte ihn nicht, es war nicht mein üblicher Aufpasser.
Ich schüttelte den Kopf.
»Es übersteigt meine Fähigkeiten«, gab ich zerknirscht zu.
»Das ist bedauerlich. Höchst bedauerlich. Es ist ein wichtiges Projekt und wir hatten Hoffnungen in Sie gesetzt, den angeblich talentierten Erfinder, den wir extra zu uns geholt haben. Anscheinend werden wir uns um Ersatz umsehen müssen. Und keine Sorge: Wir regeln das kurz und schmerzfrei und außerhalb der Mauern ist genug Platz …«
Der Schreck saß tief. Hatte ich tatsächlich so lange durchgehalten, damit man mich umbrachte und danach wegwarf, nachdem ich meinen Zweck nicht erfüllen konnte?
Mein erster Gedanke war Flucht. Mein zweiter: Sigena musste mir helfen! Zu deutlich hatte sie mir vor Augen geführt, wie unmöglich mein Unterfangen war, auf eigene Faust zu entkommen.
Ich bereute, dass ich mir nicht ihre genaue Adresse hatte geben lassen. Sie hatte zwar die ungefähre Gegend erwähnt, aber in dieser dicht besiedelten Stadt war es dennoch ein nahezu unmögliches Unterfangen, eine einzelne Person ausfindig zu machen. Oder vielleicht doch nicht? – Sigena hatte erwähnt, dass sie in einer Art Kaserne des Atheistenkorps lebte. Ich war mir recht sicher, dass die Menschen in der Gegend darüber Bescheid wussten. Aber sollte ich einfach hinspazieren und jemanden fragen? Immerhin waren viele Menschen den Atheisten nicht gerade wohlgesonnen und ich konnte mir die Reaktionen darauf nur allzu deutlich ausmalen.
Gerade, als ich so überlegte, klopfte es an meine Tür. Sofort schrillten alle meine inneren Alarmglocken; doch dann konnte ich mein Glück kaum fassen: Es war Sigena!
Ich sprang auf und umarmte sie. Sie erwiderte den Druck erst zaghaft, doch dann standen wir beide einen Moment lang einfach nur umschlungen da.
Dann löste sich Sigena aus meinen Armen und meine ganzen Sorgen sprudelten regelrecht aus mir heraus.
»Du musst mir unbedingt helfen …«
Ich stockte, als ich sah, dass sie nicht einmal richtig darauf reagierte. Erst jetzt fiel mir auf, wie kaputt sie aussah. Von ihrem blauen Auge war zwar nur noch ein schmaler, bräunlicher Ring zu sehen, aber die Augen selbst wirkten stumpf und abwesend.
»Was ist mit dir los?«, fragte ich.
»Ich habe auch Sorgen«, meinte Sigena. Es war für mich nicht leicht, nachzuvollziehen, was sie mir beschrieb. Doch offensichtlich hatte sie vergessen, irgendein Formular abzugeben.
»Kannst du das nicht einfach nachreichen?«, fragte ich verständnislos.
»Theoretisch ja, praktisch ist es sehr kompliziert geworden. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt. Und einige Ämter haben nur sehr beschränkte Öffnungszeiten, aber ich bekomme einfach keine Freistellung vom Dienst. Es ist absurd, aber leider ernst: Ich kann durch diese Sache meine Staatsbürgerschaft verlieren.«
»Dann gehen wir gemeinsam fort«, sagte ich spontan. Doch Sigena schüttelte nur den Kopf.
»Warum nicht?«, fragte ich, »Ich bin sicher, dass du bei uns im Dorf willkommen wärst!«
»Weil ich überleben will. Die Reise dorthin für zwei Gestalten, wie wir es sind, ist viel zu gefährlich, ein Menschenleben zählt da draußen nicht viel. Und bis zu deinem Dorf ist es ein weiter Weg.«
»Du hast deine Waffe«, gab ich zu bedenken.
»… die aufgeladen und gewartet werden muss. Sie ist nur dazu gedacht, einzelne Personen zu betäuben, aber nicht, um damit wochenlang ums Überleben zu kämpfen. Aber selbst wenn wir heil ankommen sollten und man mich als Fremde aufnehmen würde: Ich denke nicht, dass dein Dorf ein Ort für mich zum Leben wäre.«
»Du meinst also, wir sind dort unzivilisierte Barbaren?«
»Nein. Oder ja, irgendwie schon. Verglichen mit hier ist es ein rechtsfreier Raum. Gerüchteweise hat es immer wieder kleinere solcher Ansiedlungen gegeben, aber die waren nie stabil. Und selbst wenn, was soll ich da? Ich kann kein Feld bestellen oder irgendein Handwerk. Alles, was ich je gelernt habe, ist, meinen Platz im Korps auszufüllen.«
Es waren weniger ihre Worte an sich, als vielmehr, wie sie diese sagte. Die Endgültigkeit, die in jedem ihrer Worte mitschwang. Es war sinnlos, noch weiter in sie zu dringen; Sigena würde, selbst wenn alle Stricke rissen, nicht mit mir kommen.
Zu meiner eigenen Überraschung hielt sich mein Bedauern darüber in Grenzen. Sigena war zweifelsohne eine attraktive Frau. Ich mochte sie gerne und vermutlich bewunderte ich sie sogar. Ich konnte mir sogar vorstellen, meine Zeit mit ihr zu verbringen, unter anderen Umständen einige Monate zusammen mit ihr ins Land ziehen zu lassen, aus denen schnell ein oder zwei Jahre werden mochten. Doch sie mein Leben lang an meiner Seite zu wissen, neben und mit ihr alt zu werden, war etwas, das sich meiner Vorstellungskraft entzog.
Also fragte ich sie nicht erneut, ob wir zusammen fliehen würden, ich bat sie jedoch, mir zu helfen. Und Sigena tat das, allerdings anders, als ich es erwartet hatte.
»Und hier soll das sein?«, fragte ich zweifelnd, als wir in der kleinen Kapelle standen. Das winzige Gotteshaus war so gut wie leer. Es gab weder Bänke, noch einen richtigen Altar, lediglich einen gemauerten Sims, auf dem Blumen und Kerzen standen. Darüber hingen an einem einfachen Metallhaken Votivgaben aus Blech. Hier gab es keinen Platz, an dem man so etwas wie einen ausführlichen Schaltplan verstecken konnte. Selbst wenn in einer Ritze ein Zettel stecken mochte, so war ich sicher, dass wohl kaum etwas in brauchbarer Größe Platz fand und gleichzeitig die Jahre überdauern konnte.
»Sieh dir die Fresken an«, sagte Sigena und leuchtete mit einer Kerze, die sie kurzerhand ergriffen hatte, die Wände ab. Im flackernden Licht sah ich Heiligenbilder. Mir fiel nichts Ungewöhnliches auf, doch ich hatte von christlicher Mythologie auch wenig Ahnung.
»Und, wer soll das sein?«
»Die vier Evangelisten. Moses mit den zehn Geboten. Die bereuende Maria Magdalena. Das Lamm mit einem der sieben Siegel der Apokalypse. Alles übliche Darstellungen von Figuren aus der Bibel, doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie alle halten Tafeln, Schriftrollen oder Bücher in Händen. Und hier, offen sichtbar für jeden und dadurch versteckt vor dem Auge des Suchenden, sind die Schaltpläne verborgen.«
Sie strich über Moses’ Tafel der Gebote. Es war wie eine Liebkosung.
»Mein Vater hätte sicher nichts dagegen, dass du den Plan, den du brauchst, bekommst. «
In dem Moment hörten wir hinter uns ein Scheppern. Ein Mann stand hinter uns. Im Halbdunkel kam er mir nur vage bekannt vor, aber nach dem Verstreichen einiger Momente wusste ich, dass ich heute bereits mit ihm gesprochen hatte.
»Dann war das also eine Falle für mich«, meinte ich bitter, den Blick auf die Waffe in den Händen des Mannes gerichtet. Sie war um einiges kleiner als Sigenas Elektro-Distanz-Waffe, doch mein Instinkt sagte mir, dass sie wohl ungleich tödlicher war.
»Die Falle war nicht für dich, sie war für mich«, fuhr mich Sigena an.
»Ich weiß, dass Sie mich schon länger drankriegen wollen. Reicht es Ihnen denn nicht, was mit meinem Vater geschehen ist? Was sollte das ganze Spielchen? Wollten Sie mich über die Sittenpolizei drankriegen oder wegen Verschwörung oder … was?!?«
»Ach, Sigena, mit so etwas wie der Sittenpolizei halte ich mich doch nicht auf. Gegen diese Regeln verstoßen doch fast alle, für dich wäre das bestenfalls ein Ärgernis, das sich mit den üblichen Bestechungsgeldern beseitigen lässt. Du weißt ja inzwischen, wie das so läuft. Nein, es ging darum, einen Fehler auszuräumen, den ich vor langer Zeit bei deiner Familie begangen hatte.«
»Meine Familie? Sie waren in unserem Haus zu Gast und haben sich in unser Vertrauen geschlichen. Und dann dafür gesorgt, dass mein Vater ins Gefängnis kommt und das natürlich rein zufällig mit einem Typen in derselben Zelle, der ihn abgestochen hat!«
Sigena atmete heftig und ihre Finger spielten nervös mit dem leeren Halfter.
»Ob du es glaubst oder nicht, das war tatsächlich ein bedauerlicher Unfall.«
»Nein, Hieronymus, das glaube ich nicht mal, wenn ich hundert werde! Sie haben sich durch Intrigen, Mord und Korruption einen schönen Platz im Klerus gesichert, ein Mann mehr oder weniger, der da auf der Strecke bleibt …«
»Wir wollten deinen Vater weich kriegen, ihn aber sicher nicht töten. Nein, Sigena, es war zwar schlecht, dass es mir nicht gelang, diesen Mann erst durch Privilegien und Zahlungen ganz für unsere Sache zu gewinnen, und auch nicht, ihn durch Repressalien und im Gefängnis zu brechen, sondern mein größter Fehler war es, euch Frauen keine Beachtung zu schenken. Für mich wart ihr beide nur eine ungelernte Hilfskraft und ein dummes Mädchen. Mir war nicht klar, dass ihr beide tatsächlich wusstet, was die Arbeit deines Vaters war und ich habe erst spät entdeckt, dass deine Mutter viele Reinzeichnungen der Skizzen angefertigt hatte und die Tragweite der Erfindungen tatsächlich verstanden hatte. Und dann noch der kluge Schachzug, die Tochter vorsorglich beim Atheistenkorps unterzubringen, worauf der Papst selbst seine schützende Hand hält! Und deine Mutter ging nach dem Tod deines Vaters weg, wie wir heute wissen, am helllichten Tag, als einzige Tarnung die Aura einer einfachen Frau. Es war ihre ganz persönliche Rache, auf diese Weise zu verschwinden und uns eine Nachricht zukommen zu lassen, dass sie die Pläne mitgenommen hatte. Aber ich war mir bald sicher, dass sie nur unbedeutendes Zeug mitgenommen hatte, denn was sollte sie in der Fremde ohne die modernen Fabriken, die die nötigen Kleinteile erzeugen konnten, mit den ganzen Plänen? Nein, deine Mutter war trotz ihrer Trauer und Rachegelüste eine sehr pragmatische Frau. Ich ließ eure Wohnung durchsuchen und beobachtete dich, was mir dank der strengen Ausbildung leicht fiel, da es nur wenige Tage gab, die du zur freien Verfügung hattest. Aber nun gehst du, wohin du willst und dennoch bist du immer noch standhaft geblieben und nicht der Versuchung erlegen, das Versteck aufzusuchen. Wir spielen das Spiel schon so lange, aber ich traue dir zu, noch einige Jahre lang durchzuhalten. Ich musste dir also schnell einen Grund liefern und da kam mir dieser junge Mann ganz recht. Er ist ein Erfinder wie dein Vater, jemand, der etwas mit den Plänen anfangen kann. Und dazu Atheist und in etwa in deinem Alter. Ich war mir sicher, dass er etwas in dir berühren würde.«
Damit gab er uns ein Zeichen, die Kapelle zu verlassen. Anschließend ging es erneut in Gefangenschaft.
Als ich zu Sigena trat und ihr tröstend die Hand auf die Schulter legte, drehte sie sich zu mir und lächelte bitter.
»In zumindest der Kapelle werden sie nicht finden, wonach sie suchen!«
Einige Stunden später wurden wir abgeholt, Hieronymus und ein weiterer Mann scheuchten uns unter Waffengewalt vor sich her. Ich trat vorsichtig ein. Ich widerstand der Versuchung, Sigena an der Hand zu nehmen, obwohl ich mich damit wesentlich sicherer gefühlt hätte.
Vor dem Schreibtisch stand ein bulliger und drehbarer Stuhl verkehrt zu uns. Der Sockel aus glänzenden Metallteilen schien so gar nicht zu dem weinroten Samtbezug zu passen, doch dieser Gedanke verflog, als sich der Sessel langsam umdrehte. Leichter Dampf trat unten aus und ich merkte, dass es spezielle Hydraulikvorrichtung war, die den Stuhl bewegte, nicht die Gestalt darauf. Ich hatte erst das Gefühl, als würde da eine Leiche oder genauer gesagt eine vertrocknete Mumie sitzen. Doch der Mann war zwar alt, uralt und krank, aber nicht tot. Eine bestickte Decke lag über seinen Beinen und auch die restliche Kleidung wirkte prunkvoll.
Sigena starrte ihn an, als könnte sie gar nicht fassen, was sie da sah. Dann sank sie plötzlich in die Knie.
»Heiliger Vater!«, brach es aus ihr hervor.
Auch Hieronymus verneigte sich tief und warf mir einen bösen Blick zu, als ich keine Anstalten dazu machte.
»Das ist der Papst?«, fragte ich ihn leise.
»Ja, der Vertreter Gottes auf Erden!«, zischte mir Hieronymus zu. Mir war natürlich klar, dass ich mich respektlos verhielt, doch der Papst selbst beachtete mich überhaupt nicht, sondern hatte seine ganze Aufmerksamkeit Sigena zugewandt.
»Erhebe dich, meine Tochter, und komm zu mir!«, sagte er.
Sigena erhob sich zögerlich und trat mit gesenktem Kopf an den skurrilen Stuhl des Papstes. Dieser dampfende Sessel, der wandelnde Leichnam, der darauf saß und der Prunk seiner Kleidung, der Decke und der Schuhe ließen all das irreal wirken. Die Krönung der grotesken Szenerie war, als der Scheintote lächelte.
Erst jetzt fiel mir auf, dass Sigena zitterte. Wie konnte der halb tote Mann diese unerschrockene Frau zum Zittern bringen? War es sein Erscheinungsbild? Oder die reine Macht, die er in seinen Händen hielt? Diesen sehnigen, zu Klauen verbogenen Fingern, an denen zahlreiche Ringe steckten, von denen wohl jeder einzelne ein Vielfaches wertvoller war als alles, was ich in meinem Leben je besitzen würde?
»Du musst keine Angst haben, mein Kind. Ich will dir nichts Böses und ich werde dich auch nicht zwingen, die restlichen Pläne deines Vaters herauszugeben, wie Hieronymus das vorhatte.«
»Nicht?«, fragte ich.
»Nein«, stellte der Papst fest und sah nun ruckartig zu mir hinüber. Sein Stuhl erzitterte, und als er sich auf mich zubewegte, stellte ich fest, dass er sich offenbar durch eine Handsteuerung bewegen ließ. »Ich bin selbst bestürzt, wie manche meiner Befehle aus dem Ruder gelaufen sind – es war nie meine Absicht, jemals jemandem aus der Familie der jungen Frau zu schaden. Ja, ich brauche die Pläne, aber ich habe niemals den Befehl gegeben, ihren Vater zu inhaftieren oder gar zu töten. Als das passiert ist, habe ich selbst dafür gesorgt, dass Sigenas Bewerbung ins Atheistenkorps bevorzugt behandelt wird, um in Hinkunft meine schützende Hand über sie zu halten.«
»Gleichgültig. Ich kann Euch die Pläne dennoch nicht geben«, sagte Sigena leise. »Zumindest nicht den, den ihr wollt.«
»Welchen der Pläne will ich deiner Ansicht nach, mein Kind?«
»Mein Vater hat diesem Ding keinen Namen gegeben, aber Ihr wisst, was es ist und ich sehe keinen Sinn darin, jetzt noch drum herum zu reden. Es ist die Maschine, die ganze Landstriche verheeren kann und sie über Jahre hinaus vergiftet. Es sollte erst ein Fahrzeug werden, mit dem man ein unzivilisiertes Land gefahrlos durchqueren kann. Aber es wurde immer größer und immer gefährlicher. Als mein Vater fertig damit war, gab er die Pläne nicht heraus. Ich werde nie vergessen, als es ihm bewusst wurde, was er getan hatte. Ich habe ihn zuvor und auch danach nie wieder weinen gesehen.«
»Und warum hat er sie dann nicht zerstört?«, fragte ich.
»Er dachte, ich würde den Plan vielleicht eines Tages brauchen können, um mir mein Leben zu erkaufen. Das war ihm trotz allem wichtiger. Er stellte das Leben vieler über sein eigenes, aber meins dennoch über das all der anderen.«
»Das ist eine erstaunlich weise Erkenntnis für so einen jungen Menschen«, sagte der Papst und hustete trocken. »Ja, so ist das mit den Müttern und Vätern, das Wohl ihrer Kinder steht über allem anderen. So ist es auch bei mir. Aber als oberster Vater habe ich einen ganzen Staat voll Söhne und Töchter und es ist nicht leicht, allen gerecht zu werden.«
»Ich bin eine Ungläubige, im Zweifelsfall ist klar, wer mehr Kind dieses Staates ist«, erwiderte Sigena trotzig.
Der Papst wog den Kopf: »Gott hat den Menschen mit dem freien Willen das größte Geschenk gemacht, das er ihnen zuteil werden lassen konnte, und daher werde ich jeden führen und leiten, der zu Gott finden will, aber ich werde niemandem Grausamkeit zukommen lassen, der es nicht wünscht. Aber weitaus wichtiger für dich in dem Moment ist sicherlich, dass es nicht der Plan ist, den wir möchten. Du kannst den Plan dieses Vernichtungsfahrzeugs gerne weiterhin versteckt halten.«
»Was?«, entfuhr es Sigena.
»Es gibt Kräfte, die diesen Plan wollen, aber bei mir liegt er in der Dringlichkeit weit unten. Nein, was ich will, ist der Plan für den künstlichen Körper.«
»Den?« Sigena schien aus allen Wolken zu fallen. »Aber der ist nicht mal ausgereift. Es ist lebensgefährlich, etwas damit anfangen zu wollen!«
»Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich bin alt und krank, und wenn es so weitergeht, werde ich mich bald gar nicht mehr bewegen können. Ich bin daher bereit, dieses Wagnis eingehen. Wenn es schief geht, ist es gut, denn dann bin ich bei Gott.«
Er hustete erneut trocken und spuckte in ein weißes, mit Goldfäden besticktes Stofftaschentuch.
»Und warum wehren Sie sich dann gegen die Krankheit?«, warf ich ein.
»Mich selbst aufgeben, das kann ich erst, wenn ich sicher bin, dass es Gottes Plan ist, mich zu sich zu holen. Aber ich habe noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ich möchte so lange im Amt bleiben, dass ich noch einen neuen Nachfolger aufbauen kann.«
»Wird nicht auch so einer gefunden?«, fragte ich.
»Einer wird immer gefunden. Aber die besten Chancen hat derzeit Kardinal Liberius. Und unter ihm weht sicherlich ein anderer Wind. Man munkelt, dass er das Staatsgebiet weiter ausdehnen will«, gab Hieronymus zu bedenken.
»Und das bedeutet Krieg«, sagte der Papst finster, »erst Krieg, und wenn er dann den Hass gegen alles Fremde geschürt hat, werden es auch die Atheisten und Andersgläubigen zu spüren bekommen, danach die Menschen, bei denen nur der kleinste Verdacht dazu besteht. Wenn er an die Macht kommt, könnten schon bald Ketzer- und Hexenverbrennungen an der Tagesordnung sein. Ich bin jedoch der Meinung, dass wir in diesen schweren Zeiten zwar strenge Regeln im Staat brauchen, aber wir nicht dazu berufen sind, Richter über die gesamte Menschheit zu sein.«
Sigena sah mich an, als bräuchte sie erst meine Erlaubnis für ihre Entscheidung. Doch das Schiff segelte bereits unter der Führung seines Kapitäns.
26. Jul. 2012 - Nina Horvath
Bereits veröffentlicht in:
|
|
URIEL
M. Haitel (Hrsg.) |
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



