
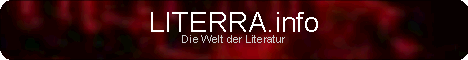
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Oliver Kern > Düstere Phantastik > Die Eismaschine |
Die Eismaschine
von Oliver Kern
Die Eismaschine kam Ende Mai. An einem Samstagmorgen hielt ein Lieferwagen vor Strickers Gemischtwarengeschäft und zwei Monteure der Alpini Kunstspeiseeis GmbH hievten den matt glänzenden Kasten schwitzend und fluchend in den engen Laden. Karl Demzki, ein Junge aus der fünften Klasse, behauptete später, dass das Kühlaggregat über sieben Tonnen wog. Eine Aussage, der ich trotz meines noch unausgeprägten Gespürs für das metrische System schon damals keinen Glauben schenkte. Wie auch immer! Bevor der Transporter zwei Stunden später aus dem Ort fuhr, wusste auch der Letzte im Dorf von dem neumodischen Apparat, was in unserem Siebenhundertseelenkaff nahe der tschechischen Grenze nicht verwunderlich war. Vor allem unter uns Kindern verbreitete sich die Nachricht schneller, als die Kopflausepidemie des vergangenen Herbstes. Vom Hörensagen war mir bekannt, dass die in der Stadt eine Eismaschine besaßen, doch die war gut vierzig Kilometer entfernten. Unerreichbar mit dem Fahrrad und unerschwinglich, um mit dem Bus dort hinzugurken. Mit dem surrenden Blechmonolithen, der eine Gänsehaut erzeugende Kälte abstrahlte, holte uns an jenem Maitag die Zukunft ein und mich befiel kurzweilig ein Gefühl, das sich sonst nur an Weihnachten einstellte.
Das mannshohe Ungetüm stand im hinteren Teil des Ladens und war von der Kasse nicht einsehbar. Dem alten Stricker sah man an wie zuwider er die Platzierung fand, doch sein Geschäft war dermaßen mit Regalen und Ware zugestellt, dass beim besten Willen nur diese schwach ausgeleuchtete Ecke übrig blieb. Daher ließ der krummbucklige Geizkragen uns Kinder nicht allein an den begehrten Kasten, obwohl das Ding — ganz dem modernen Trend folgend — auf Selbstbedienung ausgelegt war. Frevelhafterweise füllte er die Plastikbecher nie bis zum Rand, was ihn in den Augen seiner unmündigen Kundschaft noch engherziger machte. Niemals zuvor haben wir ihn abgründiger verflucht, als an jenen Tagen.
Für zehn Pfennig konnten wir ab halb elf rote Kunstspeiseeispampe kaufen. Pappsüße Farbstoffmasse, die zwischen den Zähnen knirschte, hundert Prozent chemisch – was in den späten Siebzigern nicht einmal die Alternativen in der Gemeinde beunruhigte – und Gehirnvereisung garantierte. Manche tippten auf Kirsche, andere auf Himbeere. Genau sagen konnte es keiner, denn für eine eindeutige Geschmackidentifizierung war das Zeugs schlichtweg zu kalt und zu zuckerlastig. Letztlich war das auch nebensächlich. Die Maschine vermittelte uns eine Lebensqualität, die unserem Nest bislang fehlte. Zumindest in diesem Punkt waren allesamt einer Meinung.
Da Stricker samstags Punkt zwölf das angerostete Absperrgitter runter ließ, war Eile geboten. Doch trotz des knappen Zeitfensters fällt mir kein Halbwüchsiger aus der Gemeinde ein, der es an diesem Vormittag nicht in den Laden schaffte. Bisweilen lungerte ein gutes Dutzend Kinder beseelt Eis löffelnd in der warmen Mittagssonne vor dem Geschäft herum. Es waren die letzten unbeschwerten Stunden dieses jungen Sommers 1978.
Wie bestellt brach mit Eintreffen der Eismaschine eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle über uns herein und trocknete den Landstrich samt seiner Bewohner aus. Die meteorologische Kapriole sorgte nach Schulschluss für kontinuierlich lärmenden Andrang an dem frostigen Verführer. Der Alte hatte bald genug vom Eis zapfen und zum Bedauern aller, stieg der Preis bis zum Monatsende auf zwanzig Pfennig pro Becher. Damit verdeutlichte uns der hohlwangige Eigenbrötler die ökonomische Wirkung von Angebot und Nachfrage schneller und effektiver, als der Sachkundelehrer es jemals hingekriegt hatte. Stricker demonstrierte einsichtig, wie man mit weniger Arbeit doppelten Gewinn erzielte. Der Ärger darüber gärte freilich nur kurz, denn schließlich durften wir endlich selbst die Münzen in den Schlitz stecken, den Becher aus der Halterung ziehen und vollmachen. Randvoll versteht sich!
Mitte Juni verschwand ein Kind aus dem Dorf. Der Junge hieß Viktor und war eine Klasse unter mir. Ich kannte ihn nicht wirklich. Wir spielten nicht mit ihm, weil er uns seltsam erschien. Seine Familie war zwei Jahren zuvor aus dem Norden zugewandert. Schon das stellte ein Problem dar, wenn man bedachte wie kaltblütig Kinder sein können. Rückblickend erinnere ich mich nur noch an sein weißblondes Haar und dass sich sein Hochdeutsch in meinen Ohren stets gekünstelt anhörte.
Ab wann Viktor vermisst wurde, konnte niemand mit Sicherheit sagen. Wie zu jener Zeit auf dem Land üblich, streunte auch er nach der Schule herum und tauchte für gewöhnlich erst zum Essen zu Hause auf. Zumindest bis zu jenem Junitag. Da fehlte er beim Abendbrot.
Bei jedem anderen von uns hätten sie wohl erst nach Einbruch der Nacht mit der Sucherei begonnen. Die Norddeutschen waren hinsichtlich ihrer Kinder jedoch schon damals sensibler. Ein erster Suchtrupp gruppierte sich bereits um halb neun, angeführt von Viktors Mutter, die minütlich hysterischer wurde. Gefunden haben sie ihn nicht. Nicht im Dorf, nicht in den umliegenden Wiesen, Feldern und Wäldern und auch nicht beim oder gar im Stausee, der zwei Kilometer außerhalb der Ortschaft lag. Sie fanden ihn auch nicht am Tag darauf und an allen, die noch folgten. Der weißblonde Viktor blieb verschwunden.
Die Hitze des Sommers drängte sich in den Gassen, den Häusern, Stallungen und Heuschobern, zusammen mit einem beklemmenden Gefühl der Ratlosigkeit. Hinzu kam das Misstrauen, das den Leuten aus den Augen leuchtete, die mir auf der Straße begegneten. Ein prekäres Gemisch, das fünf Tage später von unsichtbaren Fäden der Angst durchwoben wurde, als die kleine Maria nicht mehr nach Hause kam. Das Mädchen wohnte auf einem der Aussiedlerhöfe und fuhr ein gelbes Klapprad, das viel zu groß für ihre kurzen Beine war. Sie ging noch nicht zur Schule, konnte demnach höchstens fünf gewesen sein, als sich der Erdboden unter ihr auftat. Es war ihr nicht vergönnt, einen bleibenden Eindruck auf diesem Planeten zu hinterlassen.
Seit Viktors Verschwinden schlich ein Kriminalbeamter aus der Stadt durch das Dorf. Er hieß Bruckner, hatte einen runden Kopf, lichtes Haar, einen Schmerbauch und trug trotz der Hitze braune Cordhosen. Wenn die Leute über ihn sprachen, nannten sie ihn Kommissar. Der Kommissar stellte knapp gehaltene, präzise Fragen, die hin und wieder verfängliche Antworten zu Tage förderten. Der Polizist befragte alle, nur nicht uns. Kinder nahm man damals noch nicht ernst. Es passte nicht ins Weltbild der Erwachsenen, dass wir kapierten wie das Leben funktionierte. Oder das Streben.
Zu jener Zeit kam mir das Verhalten meiner Eltern anmaßend vor. Aus jetziger Sicht waren sie einfach nur naiv in ihrem Glauben, mich vor der grausamen Realität schützen zu können, indem sie das Offensichtliche verschwiegen. Dabei stand ihr ungefälliges Verhalten in krassem Gegensatz zu ihrem Getuschel, das erklang, sobald ich mich umdrehte. Für die Erwachsenen begann die Zeit der Anschuldigungen. Die Leute deuteten mit ihren knochigen Fingern auf jene, die sich umdrehten, um wiederum andere auszuspähen und zu verdächtigen. Ich traf niemanden mehr im Dorf, der nicht nervös, ängstlich und äußerst reizbar war. Es grassierte eine Epidemie namens Furcht, mit der sich Große wie Kleine unwillentlich infizierten. Aus der Entfernung von über dreißig Jahren betrachtet, möchte ich jedoch behaupten, dass wir Kinder souveräner mit dieser Seuche umgingen. Nachdem das Mädchen nicht mehr auftauchte, brannte die Luft und es war nicht die Sonne am stahlblauen Himmel, welche die Atmosphäre entflammte und giftiges Misstrauen in den Gassen verschleuderte, ähnlich den Bauern, die ihre Felder mit stinkender Gülle tränkten.
Marias Verschwinden brachte mehr Polizisten in den Ort. Welche in Uniformen und welche die keine trugen und Befehle gaben, so wie Bruckner, von dem man nun als Ermittlungsleiter sprach. Im Trausaal des Rathauses schlugen sie ihr Lager auf und nannten es Zentrale. Manchmal sah ich den Kommissar und seine Kollegen an den offenen Fenstern stehen und filterlose Zigaretten rauchen, während sie die verschwommenen Luftbilder über den Maisfeldern betrachteten. Doch selbst die geballte Macht der Exekutive konnte nichts daran ändern, dass eine Woche später erneut ein Kind nicht beim Abendessen erschien.
Josef war einer von uns, einer aus meiner Klasse. Einer, der sich schon letztes Jahr von der höchsten Abbruchkante in den Steinbruchweiher zu springen traute. Eine Mutprobe, zu der er diesen Sommer nicht mehr antrat. Diesmal fühlte ich echte Betroffenheit. Das Böse, das durchs Dorf schlich, hatte mir einen Freund genommen.
Die Ohnmacht der Polizei machte die Leute wütend, ein Zorn der die Angst betäubte und auch uns erfasste. Er packte mich, schüttelte mich so kräftig, dass ich Thomas und Roland überzeugte, die Sache selbst anzupacken. Wir spuckten in unsere Handflächen und besiegelten mutig diesen Bund. Erst abends im Bett kehrte die Furcht zurück und kroch mir eiskalte die Wirbelsäule entlang. Lange Wochen war es her, seit ich mir die Decke bis hoch zum Kinn gezogen hatte. Ich gestand mir ein, dass das Rätsel um die vermissten Kinder zu lösen, eine Spur zu ehrgeizig für zehnjährige Hobbydetektive werden könnte. Aus der Perspektive der vergangenen Jahrzehnte betrachtet, hatte ich den größten Respekt davor, etwas herauszufinden.
Keiner von uns gab zu, die Hosen voll zu haben. Abgesehen von den Ängsten, die in unseren Eingeweide bissen, lag die eigentliche Schwierigkeit der privaten Ermittlungen im Verbot, auf die Straße zu gehen. Mutters Anweisungen waren unumstößlich: Nicht vom Schulweg abweichen und ohne Umwege die sicheren, heimischen vier Wände aufsuchen. Ich hatte nicht vor mich daran zu halten – sofern der Mut es zuließ.
Am Sonntag nach Josefs Verschwinden war die Kirche so voll wie ich es noch nie erlebt hatte. Die harten Bänke knarrten unter dem Gewicht der Verzweiflung. Der Pfarrer predigte enthusiastischer als jemals zuvor und die Fürbitten, aus hunderten von Kehlen gleichzeitig gegen das Kirchendach geschmettert, konnte man wohl noch jenseits der Grenze hören. »Wir bitten dich, erhöre uns!«
Ich war nicht der Einzige den es überraschte, dass der Herrgott uns tatsächlich erhörte. Zwei Tage später führte man den alten Stricker in Handschellen aus seinem Laden. Der Einsatzwagen der ihn wegkarrte, hatte kaum das Ortsschild passiert, als Roland schon mit einer Zusammenfassung der Ereignisse aufwarten konnte. Er wohnte am nächsten am Gemischtwarengeschäft und konnte alles mit ansehen, während ich nach Schulschluss zappelig und nichts ahnend am Mittagstisch hockte und in meinem bereitgestellten Essen herumstocherte, um zumindest einen Ansatz von Gehorsam zu hinterlassen.
Der überbrodelnden Gerüchteküche konnte niemand entgehen. Filterte man das Dazugedichtet aus, blieben die nackten Fakten: Alle vermissten Kinder wurden zuletzt im Geschäft des Krämers gesehen. Laut zahlreicher Zeugen jeweils kurz vor Ladenschluss und stets ohne Begleitung eines Erwachsenen. Der Teufel, der unserem Kaff den Nachwuchs raubte, hatte nach drei bangen Wochen ein Gesicht bekommen. Unserer Meinung nach, hatte es keinen Falschen getroffen.
Blickte man an diesem Nachmittag in die Gesichter der Leute, konnte man ahnen, dass Strickers Glück im Unglück darin lag, dass die Polizei ihn aus dem Ort geschafft hatte. Die Verhörmethoden der Dorfgemeinschaft, was den Verbleib der drei Vermissten betraf, wären sicher nicht annähernd so human ausgefallen, wie es von den Ermittlern zu erwarten war. Trotz der aufgebrachten Stimmung fühlte man gleichwohl die Erleichterung, die sich wie ein kühlender Nebel über die Gemüter legte. Alle, die nicht direkt betroffen waren, dankten dem Herrn, dass das Grauen ein Ende gefunden hatte und dass sie selbst davon verschont geblieben waren. Auch ich war guter Dinge, dass die Polizei Josef bald zurück brachte und schlief in jener Nacht, trotz der anhaltenden Hitze, beruhigt ein.
Stricker beschäftigte zu jener Zeit eine übergewichtige Frau, die alle nur „die dicke Erna“ nannten. Eben diese Aushilfe öffnete am nächsten Tag den Krämerladen, als wäre nichts geschehen. Anzunehmen, dass dies auf eine Anweisung ihres Chefs geschah, die auf unergründlichem Wege aus der Untersuchungshaft heraus bis zu der beleibten Dame durchgedrungen war. Uns konnte es recht sein. Niemand wollte auf die gefrorene Pampe aus der Eismaschine verzichten und noch viel wenig darauf, den Ort des Verbrechens zu betreten. Mit etwas Hirnschmalz hätte allen Schaulustigen natürlich klar sein müssen, dass nicht der Krämerladen die Kinder verschluckt haben konnte, da die Polizei ihn sonst nicht frei gegeben hätte. Aber uns war diese Kleinigkeit egal. Zwischen den Regalen löffelten wir unser Eis und bekamen nicht nur deswegen eine Gänsehaut.
Der Frieden war trügerisch und der Herr im Himmel weniger verlässlich, als sein irdisches Sprachrohr es von der Kanzel propagierte. Zwei Tage noch dem frenetischen Gottesdienst fehlte wieder ein Kind und diesmal war das rote Eis in dem durchsichtigen Plastikbecher noch nicht einmal geschmolzen, bevor man es vermisste.
Der gefrorene Klumpen war das letzte Indiz, das auf den vom Erdboden verschluckten Jungen hinwies. Der Becher mit dem angetauten Eis stand noch im Laden, keinen Meter von dem Eisspender entfernt, als die dicke Erna darüber stolperte. Sie konnte sich bei ihrer Aussage später genau erinnern, dass der elfjährige Franz kurz vor Ladenschluss herein und Richtung Eismaschine gestürmt war. Allerdings war sie danach zu sehr mit der Abrechung beschäftigt, um mitzubekommen, wann er wieder gegangen war. Nicht nur Kommissar Bruckner fragte sich an jenem Abend, wieso Franz sein Eis auf dem abgetretenen Linoleumboden zurückgelassen hatte.
Wieder drängten sich die Massen, diesmal vor dem Gemischtwarengeschäft, weil gelbe Absperrbänder und zwei Streifenbeamte den Eintritt verwährten. Wir mussten unsere Hälse lang machen, um durch das verschmierte, mit Sonderangeboten zugeklebte Schaufenster, einen Blick zu erhaschen. Der Kommissar zündete sich eine filterlose Zigarette an und kratzte sich die Kopfhaut unter seinem lichten Haar. Diese Geste stand sinnbildlich für die Ratlosigkeit, die alle Anwesenden befallen hatte. Das Grauen legte seine frostige Klaue wieder um das Dorf. Die untergehende Sonne färbte den Himmel vanillefarben, rosa und dann purpurn, während wir dicht gedrängt am Randstein standen. Das Abendlicht verhöhnte mit seiner Farbenpracht die konsterniert ausharrenden Menschen. Noch nie und auch niemals danach, hatte ich so eine Ohnmacht gespürt und es gab keinen einzigen, dessen Gesicht nicht vom blanken Entsetzten gezeichnet war. In diese erdrückende Stille der herauf kriechenden Dämmerung hinein, war es Thomas, der in einer lapidaren Bemerkung die Eismaschine in Strickers Laden für den Horror dieses Sommers verantwortlich machte.
Außer mir hatte keiner die Worte gehört und ohne Frage kam mir diese Anschuldigung absurd vor. Andererseits war sie nicht minder verrückter, als die anderen Theorien, die am Stammtisch, über die Metzgertheke hinweg, oder auch sonst wie durch den Ort getragen wurden. Welche Wahrheit auch immer dahinter stecken mochte, Roland, Thomas und ich hörten auf, das Eis zu essen.
Dass diese auferlegte Abstinenz nicht alleinig Abhilfe gegen das Trauma schaffen würde, war uns selbstredend bewusst. Sollte das metallene Ungetüm irgendetwas mit dem Verschwinden der Kinder zu tun haben, mussten wir es im Auge behalten. Vormittags machte uns die Schule einen Strich durch die Rechnung. Da sich die Kinder jedoch kurz vor Ladenschluss in Luft auflösten, schien die Zeit bis in den späten Nachmittag weniger gefährlich zu sein. Folglich drückten wir uns ab halb fünf in Strickers Gemischtwarenladen herum, bis die dicke Erna uns um sechs hinauskomplimentierte.
Diese Taktik hielten wir drei Tage durch, ohne dass etwas Nennenswertes geschah. Genau genommen war es stinklangweilig, was auch am rückläufigen Eisumsatz lag. Beinahe so, als spekulierten noch andere im Dorf darauf, den surrenden Kasten in die Verantwortung zu nehmen. Außerdem waren wir nur zu zweit. Ich teilte mir die Schicht mit Roland da Thomas’ cholerischer Opa Gefallen daran fand, bei seinem Enkel den Aufpasser zu spielen und ihn nicht weiter als bis zum Gartentor laufen ließ.
Stricker beendete unsere Überwachung, als er am dritten Tag wieder auftauchte. Alle Verdachtsmomente gegen ihn waren fallen gelassen worden. Hatte uns die dicke Erna wortlos gedeudet, war seine erste Amtshandlung auf freiem Fuß, uns aus dem Laden zu werfen, nachdem er feststellte, dass wir keine Kaufabsichten hegten. Es musste eine andere Lösung gefunden werden. Der tollkühne Plan gährte schon länger in meinen Kopf und die Rückkehr des Geizkragens machte es nötig ihn auszusprechen, um die Sache zu Ende zu bringen. Das Wochenende stand vor der Tür. Eine bessere Gelegenheit würden wir nicht mehr bekommen.
Ich, Roland und Thomas, der einen unachtsamen Moment seines senilen Aufsehers zur Flucht nutzen konnte, schlichen kurz vor Ladenschluss in Strickers Geschäft und versteckten uns. Es war vermeintlich simpel. Oder ich war so voll Adrenalin, dass mir selbst bei der Kontrollrunde des mürrischen Krummbuckels nicht Angst und Bange wurde, unter dem Regal mit den Nudeln und Backwaren entdeckt zu werden. Erst als die Deckenlichter ausgingen und kurz darauf die blechernen Jalousien rasselten, überkam mich ein klammes Gefühl. Doch da war es zu spät.
Ich robbte unter dem Regal hervor und traf die anderen bei der Kasse. Ein Blick in ihre Gesichter machte deutlich, dass es nicht nur mir entgegengekommen wäre, wenn der Alte uns gefunden und hinausgeworfen hätte. Wir lungerten eine Weile in der Nähe des Eingangs rum, dort wo die Sonne wärmende Strahlen durch die verklebte Scheibe sandte. Keiner hatte Lust in die dunkle Ecke zu gehen, aus der das vertraute Surren zu hören war. Stattdessen drückten wir unsere Nasen gegen das Schaufenster und spähten durch die Risse in der Werbefolie. Obwohl nicht mal halb sieben, war der Gehsteig vor dem Laden verwaist. Roland machte eine Flasche Bier auf, trank einen tiefen Schluck und gab sie dann an mich weiter. Ich folgte halbherzig dem Ritual, weil ich Bier damals eklig fand. Der Alkohol schoss mir augenblicklich ins Gehirn, aber ich fühlte mich dadurch nicht mutiger. Nachdem Thomas getrunken hatte, wurde das Vorhaben unausweichlich. Wir hatten keinen Anlass es noch länger hinauszuzögern.
Da stand sie. Selbst im Halbdunkel war sie deutlich auszumachen. Sie leuchtete von innen. Illuminierter Frost sickerte aus ihr heraus. Selbstredend kannte ich das Wort »illuminiert« damals nicht, aber im Nachhinein betrachtet, war es die treffende Beschreibung. Was uns einst zwischen den Regalen entgegenstrahlte, war sichtbar gewordene Eiseskälte. Und sie besaß nichts Verlockendes mehr, selbst in diesem heißen Sommer nicht.
Ich möchte behaupten, die Maschine hatte uns erwartet. Sie wusste, dass wir im Laden waren, schon die ganze Zeit über. Ein verwegener Gedanke und doch war ich sicher, dass er zutraf. Sie hatte gewartet wie eine Spinne im Netz, hatte längst unser nervöses Zappeln vernommen. Doch anders als bei Arachnoiden, kam die Beute schließlich zu ihr, begab sich leichtfertig in ihren Wirkungskreis. Wir näherten uns bis auf drei Meter. Der Kältedampf war jetzt deutlich zu sehen. Er strömte wie etwas Organisches über die blanke Oberfläche. Sie atmete. Sie, oder das, was sich unter der Aluminiumhaut verbarg. Hatte ich bis vor einer Minute noch Zweifel an der Schuld der Eismaschine, so wusste ich in diesem Moment, dass sie das Verschwinden der Kinder verursachte. Damit wäre der richtige Zeitpunkt gekommen, das Weite zu suchen. Aber zum einen waren wir mit dem Aggregat eingeschlossen und zum anderen hingen wir längst in seinen unsichtbaren Fängen. Das bläuliche Strahlen, die kondensierte Kälte und das leise Brummen aus dem Inneren hatten eine hypnotisierende Wirkung. Selbst wenn wir gewollt hätten, wir wären an diesem Freitagabend nicht ohne Gegenwehr davon gekommen.
Roland warf die Bierflasche gegen die Forderfront. Der Knall und das splitternde Glas rissen mich aus meiner Lethargie. Unerklärlich, woher er den Willen nahm. In dem Trancezustand, in den ich kurzweilig verfallen war, wäre ich direkt weiter auf den Kasten zugegangen, um ihn zu umarmen. Und ich wäre daran festgefroren – so wie Thomas.
Während ich neben Roland stehen blieb, machte unser Freund noch drei Schritte, streckte wie ferngesteuert seine Hand aus und legte sie auf die vibrierende Metallhülle. Dann erst wurde ihm bewusst, was er tat. Eine Einsicht, die zu spät kam. Binnen Sekunden überzog eine dünne Eisschicht seine Finger. Er schrie, mehr vor Schrecken als vor Schmerz. Er zerrte und zog, beugte sich nach hinten, stemmte seinen Schuh dagegen, kam aber nicht mehr los. Thomas brüllte, heulte und suchte flehend unseren Blick. Die Fassungslosigkeit in seinen weit aufgerissenen Augen lähmte mich ein zweites Mal. Selbst Roland stocke in seiner Bewegung. Ich weiß nicht mehr wie lange wir so erstarrten – der eine tatsächlich und wir zwei anderen psychologisch festgefroren. Es wurde noch kälter um uns herum. Der Arm unseres Freundes färbte sich blau bis hoch zum Ellbogen. Längst hatte er aufgegeben sich gegen den Frost zu wehren und weinte leise. Es war dieses herzzerreißende Wimmern, das mich wieder reaktivierte, auch wenn die Angst mit einem Pürierstab meine Eingeweide verquirlte. Ich griff mir eine Fruchtcocktail-Konserve und pfefferte sie hart gegen die Eismaschine. Es war nicht zu erwarten, doch das Aggregat reagierte. Wenn auch nur leise und vom Geschepper der Blechdose fast verschluckt, entwich ein leises Geräusch, das ich im Mut der Verzweiflung für ein Stöhnen hielt. Die Vorderfront trug knapp über Thomas’ Kopf eine ordentliche Delle davon.
„Duck dich!“, hörte ich Roland neben mir schreien. Unser Mitstreiter verstand, sank auf die Knie und wir begannen das Bombardement. Wir griffen uns aus den Regalen, was sich in irgendeiner Weise als Wurfgeschoss eignete und schleuderten es gegen den Blechkasten. Das meiste prallte polternd ab und landete wieder vor unseren Füßen. Einiges davon prasselte auf Thomas nieder. Gelegentlich platzten Dosen oder Plastikbeutel auf und der Inhalt ergoss sich über ihn. Wir verfielen in einen Wahn, vergaßen alles um uns herum, vor allem die Konsequenz, die diese Sauerei nach sich ziehen würde. Aber schließlich hatten wir eine Mission. Es galt Thomas zu befreien und auch die anderen Kinder, wo immer sie auch sein mochten. Je mehr wir gegen die Eismaschine warfen, desto schwächer wurden die frostige Illumination und die hypnotisierende Macht der teuflischen Vorrichtung. Teile des Kastens flogen ab oder wurden weggesprengt. Der Behälter mit den Plastikbechern, die Werbetafel der Eisfirma, das Abtropfgitter. Wir konnten es verletzen. Diese Erkenntnis stachelte uns an.
Schweiß lief mir den Rücken runter und in die Augen – oder es war ein Fruchtsaft-Tomatensaucegemisch. Es spielte keine Rolle mehr. Ich befand mich im Krieg und kämpfte um mein Leben. Und die Wut der Aussichtslosigkeit zahlte sich aus. Nach einer nicht mehr nachvollziehbaren Zeit, löste sich Thomas Handfläche von der verbeulten Oberfläche und er kippte stöhnend zur Seite. Roland ließ die Konserven mit den Ananasstücken fallen, hechtete auf ihn zu, packte ihn am heilen Arm und zerrte ihn durch den Lebensmittelmatsch in den Gang hinein bis vor meine Füße. Gemeinsam lehnten wir ihn gegen das Regal. Er war lethargisch, starrte durch uns hindurch und verdrehte schließlich die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Das fachte den runtergekochten Zorn wieder an. Wir bewaffneten uns mit weiteren Dosen und postierten uns erneut. Zum Werfen kamen wir nicht mehr.
Die Vorderfront der Eismaschine glitt nach unten und schob sich über die Überbleibsel der Zapfvorrichtung, welche die Weißblechgeschossattacke nicht überlebt hatte. Das blaue Leuchten wurde intensiver, frostig weißer Dampf waberte aus dem Inneren und kringelte sich hoch bis zur Resopaldecke. Ich fing wieder an zu zittern, schon bevor ich überhaupt sehen konnte, was sich uns offenbarte.
Roland stieß einen hellen, quiekenden Laut aus, der mir durch Mark und Bein ging. Gleichwohl schockte mich der Anblick dessen, was in dem Hohlraum hockte, der sich im oberen Drittel der Eismaschine auftat. Ich habe nie wieder etwas Vergleichbares gesehen – nicht, dass ich das je wieder zu Gesicht bekommen wollte. Die Kreatur war nackt und krötenhaft. Die graubraun, schleimig schimmernde Haut war mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Das Wesen starrte uns aus beängstigend kalten und intelligenten Schlitzaugen an. Seine Bewegungen waren träge. Die langen, krallenbewehrten Finger reckten sich uns entgegen. Das Monster konnte nicht größer als einen halben Meter sein und trotzdem machte es mir eine Scheißangst. Ich hörte das Blut in meinen Ohren pochen und Rolands keuchenden Atem an meiner Seite. Sollte das Vieh etwas sagen, werde ich wahnsinnig, kam mir in den Sinn. Aber es sprach nicht. Er klotze nur, bewegte seine Spinnenfinger und wackelte unmerklich mit dem gedrungenen Kopf. Je länger ich es betrachtete, desto geringer wurde mein Ekel. Dafür wuchs die Faszination. Wie konnte so etwas existieren, noch dazu in einer Eismaschine in einem Gemischtwarenladen im hintersten Winkel der Republik? Wo kam es her? Vielleicht sollte ich es mir aus der Nähe betrachten? Ich war mir sicher, es hatte eine wichtige Botschaft für mich. Sie schallte wie ein Echo durch meinen Kopf. Die Kröte kam aus einer anderen Dimension, das Kühlaggregat war ihr Tor in unsere Welt. Der Kälte wegen, denn nur im Eis konnte das Wesen hausen. Es verriet mir, warum es trotz der Hitze in unsere Welt kam. Es brauchte Menschenkinder, das Kalzium aus unseren Knochen. Den Rest sonderte es als gefrorenen Eisbrei wieder aus. Es war so einfach und ich wollte ihm helfen am Leben zu bleiben. Das war meine Bestimmung.
„Schau ihm nicht in die Augen!“, hörte ich Roland brüllen. Er hatte mich an den Schultern gepackt und schüttelte mich durch.
„Was?“
„Du warst schon fast in Reichweite der Spinnengriffel“, schrie mein Freund und erst da erkannte ich, dass er mir das Leben gerettet hatte. Unbemerkt war ich erneut in den Bann des Eismaschinenmonsters geraten und obwohl Rolands Gekreische mir das bewusst machte, war es weiterhin so überzeugend, dass ich immer noch zu ihm wollte. Mit Gewalt stemmte er sich gegen mich und drückte mich zurück hinter die Regalreihen. Erst das schwächte die Macht der Kröte über meinen Willen.
„Wir müssen es aus der Entfernung erledigen“, gab er mir zu verstehen. „Ohne das Blech, hinter dem es sich versteckt, werden ihm die Dosen scheiße wehtun! Bist du wieder bei Sinnen?“, fragte er und drückte mir zwei 500-Gramm-Dosen mit Nudeleintopf in die Hände.
Ich nickte.
„Und nicht direkt ansehen!“
Ich nickte erneut.
„Machen wir es alle“, befahl er. Er drehte sich um und hob den Arm, ehe ich zustimmen konnte. Aber er warf nicht. Entsetzen überkam mich. Roland war im Bann der Kreatur gefangen. Panisch schloss ich zu ihm auf und erkannte, wieso er inne hielt. Das blaue Leuchten war erloschen. Im oberen Teil der Eismaschine waren jetzt Behälter, Kabel und Schläuche. Dafür kein Monster mehr.
Es wurde nie gefunden. Letztlich verschwand es genauso spurlos wie die Kinder, die uns in jenem Sommer verlassen hatten.
Natürlich glaubte man uns nicht. Kein Wort. Wir hatten Strickers Krämerladen verwüstet und es war klar, dass wir für diesen verantwortungslosen, vorpubertären Vandalismus eine Ausrede suchten. Ein Monster! Die Leute schüttelten ihre Köpfe, straften uns mit verächtlichen Blicken, so lange, bis wir uns dafür schämten, was wir getan hatten. Niemand hörte uns wirklich zu. Schlimmer noch: Man beschuldigte Roland und mich, unseren Freund Thomas in eine der Gefriertruhen im Laden gesteckt zu haben. Er trug schwerste Erfrierungen davon und büßte drei Finger seiner rechten Hand ein. Zu unserem Bedauern entlastete er uns nicht. Nach diesem Freitagabend redete er nie wieder ein Wort. Ich sah ihn nur noch ein einziges Mal. Aus der Ferne, bevor man ihn in die Obhut einer psychiatrischen Anstalt überstellte. Erst Jahre später erfuhr ich, dass er dort noch drei Jahre vegetiert hatte, ehe er sich mit vierzehn Jahren erhängte.
Für mich vergingen vier verwirrende Tage, in denen meine Eltern mich nicht aus meinem Zimmer ließen. Aufs Klo durfte ich nur unter Aufsicht. Mein einziges Unterhaltungsprogramm war der allabendliche Streit meiner Eltern, in denen sie sich gegenseitig beschuldigten, bei meiner Erziehung versagt zu haben. Am fünften Tag betrat Kommissar Bruckner meine Zelle. Mutter wollte hinter ihm her, doch er machte deutlich, mit mir allein sprechen zu wollen. Der Beamte wartete ihre Antwort nicht ab, sondern schloss die Tür vor ihrer Nase. Er setzte sich zu mir auf die Bettkante. Ich sah ihm an, dass er sich gerne eine Zigarette angesteckt hätte. Es dauerte lange, bis Worte über seine wulstigen Lippen perlten. „Ich weiß gar nicht, ob ich dir das überhaupt zumuten darf“, begann er und strich sich eine Haarsträhne über seine Glatze, die ihm beim Hinsetzen in die Stirn gefallen war. „Wir haben das Eis untersucht ...“
Ich sagte nichts, blickte ihm nur in seine geröteten, grauen Augen und verstand. Wäre es nicht so tragisch und gleichwohl absurd gewesen, hätte ich mich darüber freuen können, dass mir endlich jemand Glauben schenkte. Aber es war nichts auch nur annähernd Erfreuliches an dieser Geschichte.
„Das was aus der Maschine kam, war nicht allein rotes Kunstspeiseeis, es war nicht einmal künstlich.“
„... die Kinder“, flüsterte ich mit zittriger Stimme. Die Erinnerung an die Bilder, die mir die Kröte in meinen Kopf gepflanzt hatte, kehrte zurück. Wahrscheinlich hatte mich meine infantile Naivität in diesem Moment davor gerettet, den Verstand zu verlieren.
In seinem Bemühen aufzustehen, erkannte ich wie unendlich müde der Kommissar war. „Püriert, gefroren, gezuckert“, murmelte Bruckner auf dem Weg zur Tür. Dort drehte er sich noch einmal um. „Du und dein Freund, ihr werdet wegen der Sache keinen Ärger mehr bekommen, das wollte ich dir nur gesagt haben.“
Vielleicht täuschte ich mich, wobei ich mir bis heute eigentlich sicher bin, dass er noch ein Dankeschön brummelte, bevor er durch den Türrahmen trat. Und ich fand, dass ich diesen Dank verdiente. Wegen unseres Mutes konnte er seinen Fall abschließen, wenn auch nicht auf die versöhnliche Art, wie er es sich gerne gewünscht hätte. Es blieb mir verborgen, was er in seinen Akten notierte. Mit mir wurde nie wieder über die Geschehnisse dieses Sommers gesprochen. Keiner wollte mehr hören, was an jenem Abend in Strickers Laden vorgefallen war. Selbst zwischen Roland und mir blieb dies ein Tabu, bis er und seine Eltern ein halbes Jahr später wegzogen und ich nie wieder etwas von ihm hörte.
Auch ich hätte psychologische Betreuung nötig gehabt, aber meine Eltern hielten Verdrängung für die bessere Therapie. So war es an mir selbst, den Kampf mit dem Eismaschinenmonster zu verarbeiten. Allein gelassen mit dieser Last, sehne ich seitdem den Tag herbei, an dem ich jene Gräueltaten vergesse. Bis dahin bleibt der schwache Trost, dass keine Kinder mehr aus dem Dorf verschwanden. Nicht 1978 und auch nicht in all den Jahren danach, bis auch ich dem Kaff ein für alle Mal den Rücken kehrte.
30. Sep. 2012 - Oliver Kern
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



