
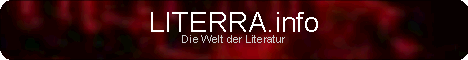
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Birgit Salutzki > Phantastik > Weihnachtsabend in Bethlehem City |
Weihnachtsabend in Bethlehem City
von Birgit Salutzki
Diese Kurzgeschichte ist Teil der Kolumne:
|
|
AGENTUR ASHERA
A. Bionda | |
„Mum, glaubst du, mein Wunsch geht auch in Erfüllung, wenn ich ihn dir verrate?“ Bens Blick haftete an der imposanten Figur, die auf einem mächtigen, goldenen Thron Platz genommen hatte.
Shelly strich ihrem Sohn über die Haare.
„Dein Wunsch? Hast du nur einen einzigen?“
Aus ihren Augenwinkeln konnte sie erkennen, wie Santa dem Jungen zunickte. Genau im richtigen Moment. Sie schmunzelte. „Natürlich, Ben. Aber wenn du es mir nicht sagen möchtest, ist es auch in Ordnung.“
Er zögerte noch ein wenig. „Ich wünsche mir so sehr, dass Daddy am Heilig Abend zu Hause ist.“
Shelly schluckte. So sehr sie sein Anliegen nachvollziehen konnte, das war etwas, das sie nicht steuern konnte. Howard arbeitete bei der Feuerwehr von Allentown. An den Weihnachtstagen führte die Festbeleuchtung mit brennenden Kerzen, die sich bei dem kleinsten Luftzug an trockenen Ästen entlanghangelten, allzu oft zu Einsätzen der Feuerwehr. In den letzten Jahren, hatten sie das Fest einfach um zwei Tage verschoben. Aber nun war ihr Sohn für solche Spielchen zu alt.
Sie drängelten sich durch die Menschenmassen, die sich am Vortag des Festes im Kaufhaus versammelten, um in Eile nach den letzten Geschenken zu suchen. Die Menschenansammlung interessierte Ben nicht, er hatte nur Augen für die weißen Flocken, die draußen vom Himmel in feingliedrigen Kristallen auf den schneebedecken Boden fielen. Freudestrahlend rannte er auf den Parkplatz.
Angesichts des Bildes, das sich ihr zeigte, seufzte Shelly. So sehr sie Schnee liebte, diese Massen, die seit heute Nacht vom Himmel gekommen waren, überforderten sie. „Ben, komm bitte her! Hilfst du mir den Wagen zu finden? Unter der Schneedecke sehen alle Fahrzeuge gleich aus.“ Frustriert schlug sie den östlichen Weg ein, da sie sich erinnerte, den Range Rover dort geparkt zu haben. „Und bitte entferne dich nicht zu weit, damit wir uns nicht verlieren.“ Sie setzte die Kapuze ihres Lodenmantels auf und zog die Mütze ein wenig tiefer ins Gesicht. Mit dem Öffnen-Schalter ihres Autoschlüssels, den sie aus ihrer Jackentasche fischte, suchte sie nach einem schwachen Signal der Blinker. Nichts. Bens Methode war effektiver. Er hüpfte von einem Auto zum anderen, nahm von der Motorhaube Schnee ab und formte einen Schneeball daraus, mit dem er versuchte, die Eiszapfen an den Parkbereichsschildern zu treffen.
Nach einigen mehr oder wenig erfolgreichen Versuchen rief er: „Mum, ich habe unseren Wagen gefunden!“ Während er das Fahrzeug vom Schnee befreite, beeilte sich Shelly, zu ihm zu kommen. Da klingelte ihr Handy. Das Bild ihres Mannes erschien.
„Was gibt’s, Howard?“
„Wo bleibt ihr denn?“ Shelly machte eine gewisse Ungeduld in der Stimme ihres Mannes aus. „Die Nachrichten haben weitere Schneefälle angekündigt. Bitte macht euch auf den Weg.“
„Ich muss noch die Einkäufe abholen, dann komme ich, okay?“
„Fahrt bitte direkt nach Hause. Wir haben genug zu Essen, aus dem du uns etwas zaubern kannst.“ Er zögerte etwas. „Bitte kommt jetzt. Ich liebe dich, Baby.“ Dann legte er auf.
Inzwischen hatte sich der Wind verstärkt. Das Ortschild von Bethlehem, das sie gerade passierten, wackelte bedenklich. Trotz der Kälte liefen Shelly die Schweißperlen über die Stirn, aber sie traute sich nicht, die Hände vom Lenkrad zu nehmen, um ihre Mütze herunterzuziehen. Sie fuhr die letzten Meilen bis zu ihrer Siedlung in Schrittgeschwindigkeit. Als das kleine blaue Holzhaus vor ihnen auftauchte fiel Shelly ein Stein vom Herzen. Sie parkte den Rover in der Einfahrt und kämpfte sich mit Ben durch den heftigen Wind zum Hintereingang.
Howard stürmte auf sie zu und nahm sie in seine Arme. Ben nutzte die Gelegenheit und drängelte sich zwischen die beiden. „Dreierkuss.“ Er lächelte verschmitzt. Das liebgewonnene Ritual des gemeinsamen Begrüßungskusses wollte er nicht missen. Er registrierte, dass sein Vater seine Winter-Arbeitsbekleidung trug. Howard kniete sich hin, um auf Augenhöhe mit seinem Sohn zu sein und umfasste dessen Hände.
„Ben, ich habe dir versprochen, an diesem Weihnachtsabend bei dir zu sein.“ Der Junge nickte eifrig. Ein ungutes Gefühl bildete sich in seiner Magengegend. „Pennsylvania ist von einer schwierigen Wetterlage betroffen. Gestern sind die Temperaturen plötzlich um 25°F gesunken. Kurz darauf setzte der Schnee ein. In den nächsten Stunden wird der Wind, von dem ihr schon einiges mitbekommen habt, noch stark ansteigen.“ Er machte eine Pause, atmete tief ein. Als er weitersprach, blickte er in das sorgenvolle Gesicht seiner Frau. „Die Nachrichtenstationen warnen vor einem Blizzard. In Ohio ist bereits Katastrophenalarm ausgerufen worden. Bethlehem und die umliegenden Städte bereiten sich gerade für den Ernstfall vor.“ Er zog Ben in seine Arme und hob ihn hoch. „Da ich zum Einsatzteam gehöre, werde ich am Heiligen Abend nicht bei euch sein.“
Shelly sagte nichts. Ihre Gedanken fuhren Achterbahn. Würde Ben den erneuten Einsatz verstehen? Sie selbst war sehr enttäuscht, doch das war nun zweitrangig. Sie musste Ben auffangen, der geknickt den Kopf hängen ließ und sich aus den Armen seines Vaters schlängelte, um in sein Zimmer zu gehen.
„Shelly, ich muss jetzt los. Eigentlich hätte ich schon vor einer halben Stunde ins Einsatzzentrum kommen müssen. Ich wollte euch nur unbedingt noch einmal sehen.“ Er fuhr mit seiner rechten Hand langsam an ihrem Arm herunter, glitt über Shellys kühle Haut und hakte seinen Zeigefinger in ihren ein. Ihr Zeichen: Stark sein. Ich komme wieder. Sorge dich nicht um mich.
Dieses stumme Symbol hatten sie sich in der Anfangsphase ihrer Liebe angewöhnt, als Shelly versucht hatte, durch viel zu viel Gerede ihre Angst vor einem Unfall während seines Einsatzes zu überdecken. Später hatte sie bereits nach seinen ersten Berührungen ihres Arms Ruhe gespürt. Obwohl sie das Ritual seit Jahren nicht mehr durchgeführt hatten, fühlte Howard, wie wichtig es nun für sie beide war.
Als er seine Tasche packte, war Howard bereits auf seine Aufgabe fokussiert. Er schaute sie noch einmal an, drückte sie kurz und verließ wortlos das Haus.
Während sie überlegte, wie sie die nächsten Stunden überstehen sollte, klingelte das Telefon. Wortlos hob sie den Hörer auf. Nach dem Gespräch war sie aufgewühlt, wie schon lange nicht mehr. Auch das noch. Shelly blickte aus dem Fenster. Die Fensterbank war bereits fast zugeschneit. Sollt sie jetzt wieder in die Kälte hinaus?
„Ben“, rief sie vom Wohnzimmer ins Kinderzimmer. „Ich brauche dich. Das was ich tun muss, kann ich nicht alleine machen. Wir müssen jemandem helfen, dem es nicht gut geht.“ Sie reichte ihrem Sohn Schuhe und Jacke. „Und jetzt komm.“
Draußen hatte sich der Wind verstärkt. Ohne große Worte reichte sie Ben einen zweiten Handbesen und räumte den Wagen. Die Siedlung glich einer Geisterstadt. Die meisten der Nachbarn waren im Urlaub oder verbrachten die Feiertage bei ihrer Familie. Shelly bog links ab und schlug den Weg zum Wald ein. In knapp zwanzig Minuten würden sie das Haus erreichen.
„Mum, schau mal, dort auf der Straße!“ Ben zeigte auf eine Schneeverwehung, aus der etwas Blaues ragte. „Dort liegt jemand!“
Tatsächlich. Die junge Frau bremste den Wagen vorsichtig ab. Ben riss die Beifahrertür auf und stapfte mit dem Blick nach unten gerichtet durch den Schnee, der am Straßenrand bis zu seinen Knien reichte. Als er angekommen war, schaufelte er mit seinen Armen die pudrige Schicht frei. Dort lag ein Junge von ungefähr sechzehn Jahren.
Durch seinen Schal nahm er den Geruch von billigem Fusel wahr. „Es ist Alan, Mummy.“ Er warf die Handschuhe zur Seite, um das Gesicht des Jungen durch Reiben zu erwärmen. „Alan Parker.“
Shelly zog die Handbremse des Rovers fest und stieg aus. Sie erinnerte sich an die Geschichte des Teenagers. Seit er vor einem Jahr vor seinem gewalttätigen Onkel geflüchtet war, lebte er auf der Straße.
„Steh auf, Alan“, befahl Shelly harsch. Er drehte sich auf die andere Seite, schirmte mit seinem Arm die Helligkeit des Auto-Scheinwerfers ab.
Ben packte ihn mit seinem kleinen Händen am Kragen. Er hatte den witzigen Teenager, der im Frühjahr ihrem Hausmeister geholfen hatte, gerne gehabt. „Bitte, du musst aufstehen. Ein Blizzard kommt in unsere Stadt.“
Keine Antwort.
„Jetzt reicht es mir aber, Alan. Der Schnee ist dabei, die gesamte Stadt unter sich zu begraben.“ Shelly gab ihm eine leichte Ohrfeige, um seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen. „Wenn du dort liegen bleibst, bist du in einer Stunde erfroren.“ Sie reichte ihm die rechte Hand „Lass dich jetzt nicht hängen und komm mit uns.“ Der ernsthafte Ton in ihrer Stimme ließ den jungen Mann aufhorchen. Noch benebelt vom Alkohol stand er auf.
Ben geleitete ihn zur Beifahrertür. „Du kannst vorne sitzen.“
Shelly nickte ihrem Sohn zu. So konnte sie Alan bei der Fahrt im Auge behalten. Mit einem Griff unter den Fahrersitz öffnete sie eine Schublade und zog eine Plastiktüte hervor, die sie auf den Sitz legte. Der Tag verlief alles andere als geplant. Sie startete den Rover und lenkte ihn wieder auf die Straße. Die Sichtverhältnisse waren noch schlechter geworden. Gegen den starken Schneefall konnte selbst die höchste Stufe der Scheibenwischeranlage nichts ausrichten. Nach weiteren sechs Meilen auf der Hauptstraße bemerkte sie plötzlich, wie etwas vor ihr Auto lief. Sie trat auf die Bremse. Die Räder blockierten. Jegliche Müdigkeit, die sich bei den Dreien durch den Aufenthalt im Freien eingestellt hatten, waren plötzlich verschwunden. Der Wagen brach nach hinten aus, während der Kotflügel einen dumpfen Schlag abbekam. Alan sprang aus dem Rover, doch sein Magen rebellierte und er übergab sich in den Schnee. Während sich Shelly mit aller Kraft gegen die Tür stemmte um sie aufzubekommen, verließ Ben an der anderen Seite den Wagen. Kaum war er ausgestiegen, erfasste ihn eine Windbö. Er wurde gegen eine Schneeverwehung geschleudert. Sein Kopf traf auf etwas Hartes. Als er zu Boden rutschte, zeigte sich das braune Holz eines Schildes mit der Aufschrift Waldhaus, das von den Schneemassen verdeckt gewesen war. Mütze und Kapuze seiner Jacke federten den Aufprall ab, sodass er direkt aufstehen konnte.
Shelly entdeckte bei ihrem Rundgang um den Rover die Ursache des Unfalls. Ein Karibu war vor ihren Kotflügel gelaufen. Ein Vorderlauf stand in unnatürlichem Winkel ab. Am unteren Hals klaffte eine große Wunde, deren austretendes Blut den weißen Grund rot einfärbte. Außer den Blessuren schien das Rentier nichts abbekommen zu haben, denn es versuchte mit aller Kraft auf die Beine zu kommen.
„Brav, wir tun dir nichts.“ Alan war um den Wagen gekommen. Er hockte sich neben dem ängstlichen Tier in den Schnee und streichelte über seinen Hals. Die Muskeln des Rens entspannten sich. „Wenn wir nichts unternehmen, wird es sterben.“ Er schaute fragend zu Shelly auf. „Ben, kannst du mir deinen Schal geben?“ Er fertigte aus einer Zigarettenschachtel, die er aus seiner Jackentasche hervorholte und Bens Schal einen Druckverband an, der die Blutung stillte. „Können wir …?“ Sein Blick war erneut auf Shelly gerichtet.
„Ich klappe die eine Hälfte der Rücksitzbank um. Setz du dich bitte nach hinten. Verletzte Tiere reagieren oft anders, als man es erwartet.“
„Danke, Shelly.“ Alan fasste das Tier unter dem Bauch und hob es hoch. Gespannt, aber ruhig blieb es in seinen Armen liegen. Während er es zum Wagen trug sprach Alan mit sanfter Stimme in sein Ohr.
Mit jedem Yard, den sich die Reifen durch die Schneemassen kämpften, stieg Shellys Unwohlsein. Was fiel ihr überhaupt ein? Seit Eleonore deutlich ihr Missfallen gegen eine Schwangerschaft der ungeliebten Schwiegertochter zum Ausdruck gebracht hatte, hatten Howard und sie den Kontakt eingestellt. Der Plan der Älteren, ihren Sohn vor der Frau zu schützen, die zwei Jahre ihres Lebens in einer geschlossenen Psychiatrie verbracht hatte, ging nach hinten los. Howard liebte sie. Er hatte sich bei seiner besitzergreifenden Mutter klar zu ihr bekannt. Shelly schüttelte den Kopf, wie um die finsteren Gedanken zu verdrängen. Nun waren sechs Jahre vergangen. Ihre Schwiegermutter brauchte ihre Hilfe. Andere Gedanken wollte sie nicht zulassen.
Der dichte Nadelwald schützte vor den Auswirkungen des kommenden Blizzards. Der Schnee lag weniger hoch als sie erwartet hatte. Beim Aussteigen vor dem Waldhaus spürte sie zwar starken Wind, der jedoch mit den Verhältnissen auf der Main Street nicht vergleichbar war. Shelly machte den Jungs klar, dass sie zuerst einmal alleine gehen wolle. Sie trat unter das Vordach, nahm die Mütze ab und klopfte an. Ihr Herz schlug laut gegen ihre Brust. Niemand öffnete. Als Shelly die Klinke hinunterdrückte, spürte sie bereits, dass hier etwas nicht in Ordnung war. Ihre Schwiegermutter lag in einem Bett, das jemand neben der Couch aufgestellt hatte. Ihr ausgemergelter Körper, der unter einer kratzig aussehenden Wolldecke lag, wurde von Hustenanfällen geschüttelt Shelly winkte Alan und Ben herein und trat zu der älteren Dame. Es war achtzehn Uhr. Hier war noch viel zu tun. Sie würden den Heiligen Abend im Kreise von Menschen und einem Rentier verbringen, die ihre Hilfe bitter nötig hatten und für die sie ein heller Stern in der Dunkelheit war.
26. Dez. 2013 - Birgit Salutzki
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



