
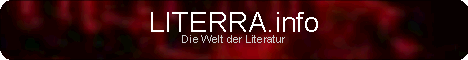
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Marc-Alastor E.-E. > Düstere Phantastik > Ich bin allein und ohne Gott, wo ich bin |
Ich bin allein und ohne Gott, wo ich bin
von Marc-Alastor E.-E.
“Power, like a desolating Pestilence,
Pollutes whate'er it touches; and obedience,
Bane of all genius, virtue, freedom, truth,
Makes slaves of men, and, of the human frame,
A mechanical automaton.”
- Percy Bysshe Shelley, Queen Mab, III -
Man kann den Kreis nicht durchbrechen. Und man sollte die Stille nicht verraten, wenn sie schützend um einen liegt.
Doch allein mein Atem lieferte mich aus, denn im leisen, atmosphärischen Rauschen der Natur klang er wie das Fauchen eines Feuers. Ich glaube, ich hatte meinen Atem noch nie beben hören, und an jenem Abend schüttelte er mich wie der Wind die Pappeln und Weiden.
Ich wusste nur, dass ich nach Hause musste.
In all den Jahren meiner Jugend hatte ich die Schemen kommen und gehen sehen, aber nie waren sie mir so nah gewesen. Nie zuvor waren sie mir derart bedrohlich erschienen, dass ich um mein Leben gebangt hatte.
An dem weißen, duftenden Stamm einer Silberpappel kauernd, besah ich mir die vier runden Kiesel, die ich bei diesem abendlichen Ausflug am Bachlauf des Reizgerrinnsals ergattert hatte. In ihrer Schwere lag diese mir bekannte und geliebte Sicherheit, eine ausgewogene Ausstrahlung des Schutzes, den ich begehrte, seit ich die Schatten zum ersten Mal zu Gesicht bekommen hatte.
Irgendwo am Bach knackte und knirschte Unterholz. Mit Schrecken wurde mir klar, dass die Schattengestalt noch immer da war. Die Angst hatte sich in all den Jahren nicht dermaßen bestechend und erdrosselnd an mich geworfen wie zu dieser Dämmerstunde. Ich traute mich zu keiner Bewegung, die mir gleichsam verräterisch und gefährlich anmutete. Die Furcht lähmte mich mit der Kühle und Klamme des nahenden Abends, während ich an unser Haus und mein Bett dachte, und nichts lieber getan hätte, als mich auf schnellstem Wege dorthin zu treiben.
Als ich lauschte, herrschte wieder das monotone Sausen der Luft und kein anderer Laut war zu vernehmen. Und auch wenn ich dieser trügerischen Ruhe keinesfalls vertraute, so musste ich dennoch um den schmalen Stamm des Baumes spähen, um Gewissheit gewinnen zu können.
Den Bachlauf selbst konnte man von der Stelle, an der ich mich verborgen hielt, nicht sehen, das Ufer mit seinen Böschungen und Wallungen jedoch war gut zu erkennen. Anders als erwartet war die einzige Bewegung, die ich auszumachen imstande war, das seichte Schwingen der Gagelsträucher im Wind. Ich schaute die Uferhänge hinauf und hinab, aber ich konnte keinen Schatten finden.
Tief atmete ich ein, in der Hoffnung die Beschwer auf meiner Brust auf diese Weise lösen zu können. Da mir die Erscheinung dessen ungeachtet so nah wie nie zuvor gekommen war und mir dabei einen Teil ihrer Gefährlichkeit dargelegt hatte, wurde mir aber nicht leichter zumute. Nun nahm ich sogar die beklemmende Angst wahr, die mich bereits wieder übermannt und zerdrückt hatte. Ich fühlte mich kraftlos und erschöpft, obgleich ich an diesem Tag keineswegs schwerere Arbeit verrichtet hatte, als in den vergangenen sechs Jahren meiner Jugend auf dem Hof meiner Eltern.
Es war die Angst, die mich auslaugte. Es war die Angst, die jeden Tag mit mir um die Luft zum Atmen focht und es war jene Angst, die mich stets einholte, wenn ich erkannte, dass die Schemen gegenwärtig waren.
Mutter und Vater erkannten diese nicht. Sie hielten mich stattdessen für absonderlich und kränklich. In der Tat war ich dürr und schwach und neigte zudem dazu, bei jedweder Bewegung einer Person furchtsam zusammenzuzucken.
Mit einem Mal hörte ich ein stampfendes Geräusch hinter mir. Und seine Plötzlichkeit schockte mich bis in die letzten Grundfesten meines Gemütes hinan. Ich zuckte zusammen und warf meine Arme schützend über den Kopf, als erwarte ich einen Schlag, der mir das Bewusstsein oder das Leben rauben würde.
In den bereits brütenden Schatten des drohenden Zwielichtes stand die schwarze Gestalt unweit vor mir und stampfte mit einem Fuß auf den Boden.
Sie musste sich um mich herum geschlichen haben, um mir in den Rücken fallen zu können. Allerdings näherte sie sich nicht. Der Schattenriss stand lediglich da und stampfte ab und an mit dem Fuß auf den Waldboden.
Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich das Ungetüm vor mir und war zu Tode erschrocken, denn ich konnte kein Gesicht und keine Haut erkennen. Es war ein Schatten mit der Ausstrahlung eines Raubtiers. Das Einzige, woran ich mich später sehr genau erinnerte, waren Lichtschimmer, die bewiesen, dass die Gestalt überhaupt räumliche Tiefe besessen hatte.
Dann, als das Grauen mir bereits das Leben auszusaugen versuchte, wandte sich der Schatten ab und lief leichten Fußes in die Richtung unseres Gehöftes. Dabei mutete mir sein Wesen zähflüssig und wabernd an, so dass es mir ekelte.
Es dauerte eine Weile, bis ich vom Krampf der erschütternden Ereignisse angestoßen wurde.
Ich schrie und umklammerte die Kiesel in meinen Fäusten. In mir lösten sich Erschütterungen, und Tränen rannen aus meinen Augen. Zeit meines Lebens waren die Schatten existent gewesen und hatten sich nicht um mich geschert. Sie waren ihrem böslichen Tagewerk nachgegangen und hatten meine Welt nur mit ihrem flüchtigen Dasein gestriffen. Doch jetzt schien ich mich im Mittelpunkt all ihres Interesses zu bewegen.
Ich sprang auf meine wackeligen Beine und spürte, dass ich am ganzen Leib flatterte. Ich wusste nicht, ob ich hinter dem Schatten herlaufen sollte oder ob es vernünftiger war, die Flucht zu ergreifen.
Schluchzend und weinend flehte ich um den Beweis, dass ich mich in einem üblen Traum befand. Da Gott allein aber die Entschlusskraft zu fehlen schien, was nun mit mir passieren sollte, begann ich irgendwann zu unserem Hof zurück zu laufen. Und mit mir trug ich die Hoffnung, mein Beschützer möge unversehrt bleiben. Nur in seinen Armen empfand ich Geborgenheit und Schutz und nur in seiner Nähe verspürte ich Ruhe und Gelassenheit.
Mein Vater war Zeit seines Lebens nicht in der Lage gewesen, mir Sicherheit zu geben. Überhaupt dachte er nur an den Hof und an die paar Tikueen, die er ab und an mit dem Verkauf von Ferkeln oder Kälbern verdiente, damit er in die nächste Wirtschaft gehen konnte, um sie dort flüssig werden zu lassen. Großmutter wähnte schon früh, das Selbstsucht und Zügellosigkeit in meinem Vater vorherrschten. Sein Zodiakus war die Jungfrau, so lehrte sie mich. Und Mutter, im Zeichen des Wassermanns geboren, folgte der inneren Treue, die sie diesem Mann einst geschworen hatte. Milde, barmherzig und nachgiebig war sie in all ihrem Handeln.
Während ich mich dem Gehöft eiligen Schrittes näherte und mein Kleid an den Ästen der Bäume zerriss, erinnerte ich mich meiner Ahnin, die mich unterwiesen hatte, in welchen Bahnen sich das Leben im Fleische zu verwirklichen suchte und was für eine entscheidende Rolle die Tierkreiszeichen dabei spielten, wenn man den Menschen mit seinen Eigenschaften einzuschätzen versuchte. Und diese Erinnerung beruhigte mich etwas. Denn auch wenn meine Großmutter schon lange tot war, so war sie dennoch eine bleibende Zuversichtlichkeit in meinem Leben. Und sie hatte nie dieser niederen schwarzen Magie vertraut, wie es meine Eltern taten.
Unweit des Gehöftes blieb ich stehen, denn ich war vollkommen außer Atem. Außerdem waren meine Hände schmerzhaft verspannt, da ich die ganze Zeit über die Kieseln gehalten hatte, und aufgrund ihrer Größe war ich gezwungen gewesen, sie sehr fest zu umkrallen, damit ich sie nicht verlieren konnte. Also steckte ich sie in meine Taschensäcke und besah mir dabei die zerfetzten Seiten des Rockes, als ich den gellenden Schrei meiner Mutter hörte.
Mein Herz blieb, im Schocke gebannt, stehen. Als es einen weiteren Schlag wagte, war dieser schmerzhaft.
Zögernd ging ich Schritt für Schritt durch das Gehölz, bis unser Haus, die Umzäunung und die Stallungen und Schuppen in Sicht kamen. Dann blieb ich stehen und raffte meine Hände wie ein Dach über meine Nase. Ich spürte mein Blut durch den Kopf rasen, als ich gespannt die Umgebung absuchte.
Und ich erschrak, als hätte ein Blitz dicht neben mir eingeschlagen, denn etwas war auf mein Gesicht getropft, das sich überhaupt nicht nach Tau oder einem Regentropfen angefühlt hatte. Ich wischte mir über die Stirn, wo ich die unangenehme Feuchtigkeit spürte und erblickte Blut auf meinen Fingern. Sekunden vergingen, in denen ich weder spürte, dass ich lebte und atmete, noch denken konnte.
Dann sah ich auf und suchte in den Baumkronen die schreckliche Quelle des Blutes. Ich glaube, in diesem Moment fühlte ich mich dermaßen unreal und bestürzt, das der zweite, schauerliche Schrei meiner Mutter mich nicht erreichte.
Ich gewann meine Besinnung nicht einmal zurück, als ich das tote Kaninchen über mir an einem Ast des nahe stehenden Baumes erspähte. Das Blut des Tieres tropfte zu mir herunter. Und ich gewahrte erschaudernd, dass mein Vater von Zeit zu Zeit tote Tiere in die Bäume hängte, um den bösen Geistern zu huldigen.
Ich machte einige Schritte rückwärts und konnte keinen Blick von dem blutenden Vieh lassen.
Verfluchte schwarze Magie, verflucht sei sie, schimpfte ich in Worten, für die ich schon oft Backpfeifen bekommen hatte.
„Strafe mich nicht, Morgenstern, strafe mich nicht, Blut ist mein und Blut ist dein“, rief mein Vater aus der Ferne und flehte nicht für meine Mutter.
Ich schlug meine Hände über dem Kopf zusammen und das Klopfen in meinem Haupt riss mich aus der Wirklichkeitsferne. Als ich herumfuhr, war am Wohnhaus noch immer niemanden auszumachen. Aber mir wurde klar, dass ich nur eine Chance haben würde, zum sichersten Ort der Welt zu gelangen; wenn ich zu meinem Beschützer gelangte, meine Finger über ihn gleiten lassen konnte und seine Beständigkeit und Härte zu spüren bekam.
Irgendetwas knallte und Holz knirschte und splitterte am Haus, in das ich hinein musste.
Ich rannte jetzt mit Panik und Angst in der Brust um das Gehöft herum, sintemal ich hoffte, durch den Hintereingang ungesehen ins Haus schlüpfen zu können. Die Kiesel in den Taschen meines Rockes schlugen mir dabei schmerzhaft gegen die Beine.
Als zu meiner Linken die Stallung lag, rannte ich um sie herum und hörte in ihrem Inneren die Tiere schreien und kreischen. Ihre Todesangst entlud sich in einem panischen Tumult.
An der Seite des Gebäudes pirschte ich um den Wassertrog und die Außenpferche herum, bis ich nah genug an unser Wohnhaus heran gekommen war.
Das Herz klopfte in meinem Hals und sein Widerhall in meiner Stirn, als ich die Hintertür betrachtete. Im Inneren des Hauses schien ein wilder Kampf zu toben, denn jemand warf mit Gegenständen, die krachend und klirrend zerschellten.
Und ich befand mich in einem Zustand geistiger Erosion. Während die Angst mich noch immer in ihrer nagenden Gewalt hatte, verspannte ich mich mehr und mehr in der Lage willensorientierter Sturheit. Nur bei meinem Beschützer konnte ich mich sicher fühlen, selbst wenn er inmitten des Chaos selbst gelegen hätte.
Mit einigen großen Schritten sprang ich zur Hintertür. Es polterte und krachte in den seitlich gelegenen Räumen, ein weiterer, erstickter Aufschrei meiner Mutter verriet mir, das sie noch immer am Leben war.
Mit bebenden Fingern drückte ich gegen die Tür, deren Riegel nur des Nachts vorgeschoben wurden, und öffnete sie nur so weit, dass ich hindurchschlüpfen konnte. Der Flur lag vor mir.
Dunkel und verlassen mutete er an. Eine alte Vase war an der Stirnwand zur Treppe zerschlagen worden. Mit größter Vorsicht umging ich die Scherben, um vorbei am Eingang, der in den Wohn- und Küchenraum führte, zur Treppe nach oben zu gelangen. Als ich sie erreichte, warf ich einen Blick in den Teil des Wohnraumes, der einsehbar war.
Ein Regal war von der Wand gerissen worden und die Behältnisse, die auf ihm gestanden hatten, lagen am Boden. Auf den Scherben lag mein Vater auf dem Rücken, mit einer grimmigen, angsterfüllten Mimik hielt er die Arme in die Höhe gestreckt, um den Schemen, welcher drohend über ihm stand, von sich fern zu halten.
Ich war dem Schatten jetzt so nah, dass ein Flüstern gereicht hätte, um ihn auf mich aufmerksam zu machen.
Ich konnte das Wabern und Flackern der pechartigen Gestalt erkennen. Und zum ersten Mal wurde ich auch der weiblichen Form gewahr. So wie sie jetzt über meinem Vater stand, mutete sie mir wie der Teufel persönlich an. Vielleicht war er es sogar, erschienen, alldieweil ihm die vielen Versuche meines Vaters ihn anzubeten verleidet waren, und bereit, den Tod zu bringen, um all dem endlich ein Ende zu bereiten. Mit einem Male ahnte ich die Möglichkeit, dass es nicht viele unterschiedliche Schemen gewesen waren, die in meinem vergangenen Leben aufgetaucht waren, sondern immer ein und derselbe.
Keine Identität und doch lebendig.
Nur ein finsterer Abdruck, den der Tod in der Wirklichkeit hinterließ, und doch so real, dass er sein unabhängiges Dasein damit zu verbringen schien, seinen Schöpfer zu mehren.
Als hätte ich es mit den Gedanken heraufbeschworen, so wandte sich der Schemen urplötzlich mir zu. Keine erkennbaren Augen stierten mich an und gleichwohl spürte ich Blicke auf mir. Ich erschauderte.
Nur drei Schritte machte der Schemen auf mich zu, während ich die Treppe hinauf stolperte.
Hinter mir vernahm ich, wie er wieder mit einem Fuß stampfte, als wolle es einen kleinen Hund damit verjagen. Und in der Tat erklomm ich bereits auf allen Vieren die letzte Stufen und raste in meine freudlose Kammer, um mich unter das Bett zu zwängen, wo meine Beschützer auf mich gewartet hatte.
Dort lag er, still und starr wie ein Abbild eines Königs auf dem Deckel seines Sarkophages.
Ich klammerte mich an den steinernen Gesellen und war froh seinen festen Leib spüren zu können.
Jeden Moment erwartete ich, dass die Zimmertür aufflog und der Schemen kam, um sich meiner Seele zu bemächtigen. Doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen überzeugte mich ein peinverzerrtes Gebrüll aus dem Untergeschoss davon, dass der Schemen sich zunächst weiter meinen Eltern zu widmen gedachte. Mir fiel ein, dass ich noch die vier Kieseln in den Leib meines Beschützers bauen musste, und da ich überzeugt war, dass seine Schutzaura nur noch stärker werden würde, wenn ich sein Wesen vervollständigte, begann ich nach dem Tiegel mit dem Harz zu tasten, welcher ebenfalls unter dem Bett aber auf der anderen Seite stand. Als ich ihn zu mir herangezogen hatte, entfernte ich den ausgehärteten, oberen Teil und entnahm eine Hand voll des zähen Harzes und füllte damit die Lücken am Leib des Beschützers. Dann holte ich die Kiesel aus meinen Taschen und presste sie in das Harz, bis sie eine Einheit mit dem Körper bildeten.
Dann reinigte ich meine Finger an meinem Rock und haftete mich wie einen weiteren Kiesel ganz eng an meinen steinigen Beschützer, schwor mir nie wieder von seiner Seite zu weichen, wenn der Schemen nicht abließ. Mein felsiger Schirmherr flößte mir für Augenblicke etwas Ruhe und Besinnung ein. Zum ersten Male in den Monaten seines Daseins erinnerte ich mich an den Tag seiner Entstehung zurück. Sieben Kieseln waren in den ersten Tagen des letzten Jahres zusammengebracht worden, und wäre er ein natürliches Lebewesen gewesen, so hätte er das Tierkreiszeichen des Ouroboros inne gehabt.
Der Zodiakus des Lebens und der Ewigkeit.
Die Geräusche, die mich aus dem Untergeschoss erreichten, lenkten meine Aufmerksamkeit wieder auf mein Entsetzen.
Mehrmals polterten wieder Möbel, als sie zu Bruch gingen. Ich hörte meine Mutter weinen und zetern. Irgendwann trat eine Stille ein, die nach Minuten von der jammernden Stimme meines Vaters unterbrochen wurde.
„Nimm sie dir, sie gehört dir, doch lass mich entkommen. Dir habe ich gedient. Dir habe ich geopfert.“
Ich bebte und zitterte. Und als ich den gurgelnden Schrei meiner Mutter vernahm, der nichts anderes als ihren Tod verheißen konnte, schüttelte mich ein Weinkrampf. Meine Fingernägel brachen bei meiner krallenden Umklammerung des Beschützers, der zwar mein Leben sicherte, doch nicht das von anderen. Nun herrschte Stille. Und Stille verstand es wie keine anderer Umstand, angsteinflößend und unberechenbar zu sein.
Die Zeit verrann ohne die ihr üblichen Veränderungen vorzunehmen. Die einzigen Zugeständnisse, die sie den Zuständen machte, waren ihre eigene wechselhafte Geschwindigkeit, da binnen Sekunden mein ganzes Leben vor meinen geistigen Augen ablief und wiederum Stunden vergingen bis Geräusche den kommenden Morgen verkündeten, und ihre Art und Weise für ein Höchstmaß an innerer Unsicherheit zu sorgen.
Trotz großer Müdigkeit schüttelte mich Angst und Schrecken stets wieder wach, wenn mein Augenlider schwer genug schienen, um sich schließen zu wollen. Schließlich hörte ich die leichten Schritte eines Lebewesens. Schleppend kamen sie die Treppe hinauf. Mein Körper zitterte dabei wie Espenlaub.
Dann erkannte ich in den alten Stiefeln meinen Vater, wie er mit mühevollem Gang das Zimmer betrat.
„Wo bist du, Göre ?“, keuchte er und seine Stimme klang rau und abgerissen.
Zielstrebig ergriffen seine Finger das einzige Stück Mobiliar, welches ich neben einer Truhe, in der sich nur meine Kleidung, ein alter Kreisel und eine kaputte Marionette, die ich einmal auf dem Müll in der Stadt gefunden hatte, mein Eigen nennen konnte, und rissen das Bett in die Luft, so dass es mit einem Krachen an die Stirnwand des Zimmers schlug.
„Da hast du dich also verkrochen. Was hast du da nur verdammtes gemacht? Warum hast du all diesen Dreck ins Haus geholt? Und warum, zur Hölle, hast du deiner Mutter nicht beigestanden?“, krächzte er. Seine Augen hatten das Funkeln des Wahnsinns, seine Kleidung war zerrissen und blutverschmiert und seine Haare waren ungewöhnlich grau. Die ränderigen Augenpartien waren schwarz, so als niste Pech in seinen Augenhöhlen.
Ich verkrampfte mich so kraftvoll um den steinernen Leib meines Beschützers, das ich jede Faser meiner Muskeln vor Anstrengung beben und schmerzen fühlen konnte.
„Steh auf und geh hinunter und räume auf. Hilf deiner Mutter“, schnarrte mein Vater, in dem ich den Schemen zu erkennen glaubte. Zumal ich meine Mutter für tot hielt.
Natürlich war ich nicht in der Lage, mich von meinem Schutzherrn zu lösen. Und so geriet mein Vater in Wut und versuchte mich zu packen. Sein großer, behaarter Arm schnellte in meine Richtung und als er mich erreichte, blieb der stählerne Griff, der mich sonst immer seiner immensen Kraft ausgeliefert hatte, aus. Stattdessen nahm ich ein wimmerndes Stöhnen von ihm wahr.
Ich blickte zu ihm auf und erstarrte in einem Schock, der in mich einschlug wie ein Blitz.
Der Arm meines Vaters wurde nur zwei Ellen von mir getrennt durch den steinernen Griff meines Beschützers gehalten.
Entsetzt und die Fassung vollends verlierend sprang ich auf, um Abstand zu den Monstren zu gewinnen.
Mein Vater schrie vor Schmerz und versuchte mit seiner noch freien Hand den Griff der Finger, die aus kleinen runden Kieseln bestanden und eigentlich nicht leben durften, zu lösen. Er ächzte dabei vor Schmerzen und Anstrengungen, doch auch ihn ereilte die Panik. Denn mein steinerner Beschützer erwachte zu einem unverständlichen Leben, richtete sich mit steifen Bewegungen auf und stemmte sich in die Höhe, in dem er sich auf den Arm meines Vaters zu stützen suchte. Der wurde durch die Kraft in die Knie gezwungen und begann vor Schmerzen zu schreien.
Ich wich in die hinterste Zimmerecke zurück und versuchte mir die Ohren zu zuhalten, doch als die Armknochen meines Vaters wie trockene Zweige im Herbst brachen und der knackende Laut, der dabei entstand, selbst seinen Aufschrei übertönte, wurde mir bewusst, dass ich flüchten musste, wenn ich den weiteren Ereignissen zu entgehen trachtete.
Als ich an der Wand entlang zur Tür schritt, sah ich das Steinungetüm, dass ich erschaffen doch nicht wissentlich belebt hatte, über meinem jammernden Vater stehen. Der aus runden Kiesel zusammengesetzte Riese reichte fast bis an die Decke und seine gewaltigen Arme wirkten wie Birkenstämme. Seine Bewegungen muteten steif und dennoch fließend an. Sein unerklärliches Leben spiegelte sich in keiner Mimik und in keinem Blick wieder. Die steinerne Front seines Hauptes war unbeweglich, und doch mochte dahinter ein unheimlicher Antrieb verborgen sein, der weder Schlaf noch Nahrung brauchte, um seine Kräfte zu erlangen.
Das, was dort seinen Arm erhob, um meinem Vater den Schädel einzuschlagen, war die teuflische Nachahmung eines natürlichen Ablaufes, den kein menschlicher Geist zu verstehen imstande gewesen wäre.
Als ich den Türrahmen erreichte und mich dem Flur in eiliger Flucht zuwandte, konnte ich noch das ekelerregende knirschende, krachende Geräusch hinter mir hören, und etwas heißes, nasses spritzte mir in den Rücken.
Dann sprang ich bereits die Treppe in großen Sätzen herunter. Ich glaube, ich schrie. Ich befand mich in einer wirklichen Bewusstseinsleere. In meinem Herzen gab es nur eiskaltes Grauen und die Angst. Ich erinnere mich an wirre Gedankenspiele, in denen ich ein Leben geboren hatte, dass unnatürlicher kaum hätte sein können, oder in denen ich einen Teil meiner Lebensangst von meiner Persönlichkeit abgestoßen hatte, um es von mir zu bannen, oder in denen ich schlicht und einfach einen natürlicheren Tod gestorben war, welcher nur noch eine funktionierende Hülle aus Fleisch oder Stein hinterlassen haben mochte.
Ich war nicht in der Lage, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich in meiner Flucht dem Schemen geradewegs in die Arme lief, ob dieser im Körper meines Vaters gesteckt und nun getötet worden war, oder ob es gar der Schemen selbst war, der meinen Beschützer belebt hatte.
Von der Treppe bog ich in den Hausflur, in dem überraschenderweise meine Mutter kauerte. Ihre Anwesenheit schockte mich natürlich, da ich sie für tot gehalten hatte. Jedoch kniete sie am Boden und widmete sich weinend und schluchzend den Scherben, die dort lagen. Obgleich ich keineswegs leise gewesen war, schaute sie nicht auf, nicht einmal als ich auf sie zuging. Nicht einmal als ich sie erreicht hatte. Und nicht einmal, als der blutende Leichnam meines Vaters die Treppe heruntergerutscht kam.
Nun knarrte und knirschte das Holz der Treppe unter dem Gewicht des Steinwesens, das mir zu folgen schien. Als er den Flur erreichte und sich in den Gang drehte, so dass ich plötzlich zwischen ihm und meiner Mutter stand, hob diese mit einem Male den Kopf. Sie blickte mit einem beängstigenden Irrsinn durch mich hindurch. Ihre Augen waren verquollen und leer, als wären sie bereits gebrochen gewesen.
Und dann trat das Ungetüm näher.
Schritt für Schritt.
Mit weichen Gliedern und bebendem Leib wich ich zurück.
Schritt für Schritt.
Jeder seiner Stampfer ließ den Holzfußboden erbeben. Jeder meiner Schritte war ein unterwürfiger Laut.
Schritt für Schritt.
Mein Kleinmut ließ mich flattern und meine Zähne klappern. Seine Zielstrebigkeit war zugleich ein schmähender Spottvers, dessen Worte im Poltern seiner steinernen Sohlen mitschwangen.
Schritt für Schritt.
Der Moment, in dem ich mit dem Rücken gegen meine Mutter stieß, ließ mich aus dem betäubten Zustand erwachen. Ich wand mich an ihr vorbei und rannte zur Tür, die ich mit schweißnassen Händen öffnete.
Ein grauer, nebelverhangener Morgen empfing mich und ich rannte hinaus.
Schnell entfernte ich mich von den widerwärtigen Geräuschen, die sich nach Todschlag anhörten. Ich entfloh in eine Welt aus seidenen, weißen Schwaden unwirklicher Gleichgültigkeit. Und was sich angehört hatte wie ein Felsbrocken, der immer wieder auf ein Neues in feuchtes Fleisch klatschte, zerfiel im leisen atmosphärischen Rauschen der Natur.
Heute lebe ich bei meiner Tante in einem Dorf, das nur wenige Meilen vom ehemaligen Gehöft meiner Eltern entfernt liegt. Es ist ein ruhiger und dem arbeitsamen Trott verfallender Ort, dessen Bauern und Viehzüchter dem Lehnsherrn treu ergeben sind, und in dessen Mitte der übliche Tempel steht.
Die Büttel des Lehnsherrn berichteten meiner Tante, meine Eltern seien einem Raubzug ansässiger Schächer zum Opfer gefallen, denn man habe im Hof keinerlei Wertgegenstände finden können. Diese Begründung war mehr als oberflächlich gewesen, da arme Bauern ohnehin nicht die Möglichkeit besessen hatten, irgendwelche Besitztümer oder gar klingendes Vermögen anzuhäufen, gleichwohl diese Erklärung mir ebenso recht war, da man mir auf diese Weise keinerlei Erklärungen abverlangte. Ich war des Nachts ausgerissen, wie Kinder es eben taten, und als ich zurückgekehrt war, hatte ich meine Eltern bereits erschlagen vorgefunden.
Meine Schweigsamkeit trug mir deshalb niemand nach. Jedennoch galt ich seitdem als seltsam, da vielen Leuten auffiel, dass ich jegliche Angst verloren zu haben schien.
Und in der Tat, seit jener grausigen Nacht habe ich nie wieder Angst oder Entsetzen verspürt. Ich kann mich erschrecken oder gar geschockt sein, doch Furcht und das Grauen sind mir fremd. Selbst wenn ich von Zeit zu Zeit dem Schemen begegne, so ängstige ich mich nicht.
Einmal traf ich den Schatten, der in jener verhängnisvollen Nacht einfach verschwunden gewesen ist, auf meinem abendlichen Heimweg von den Feldern. Da stand er vielleicht zwei Dutzend Fuß von mir entfernt, doch er stampfte nicht mehr auf und schien mich nur zu mustern, so als teile er ein Wissen mit mir, das sonst kein anderes Leben mit sich trug.
Aber selbst in jener Nacht war ich nicht bange.
Es ist, als habe jene von mir erschaffende Kreatur mich dieses Gefühles beraubt; als wäre ich jetzt bar jeder Besorgnis, während dieses Monstrum vielleicht aus meinen damaligen Furchtsamkeiten entstanden, nun einzig und allein mit ihnen beseelt, durch die Welt schleicht und tötet, was es fürchtet.
Ich kann es nicht begründen, aber tief in mir weiß ich, dass ich dem Steinernen eines Tages gegenüber stehen werde, und das er mich dann töten wird. Selbst das fürchte ich nicht, da ich nur allzu gut weiß, wie es ist, wenn man sich graust.
Vielleicht weiß ich ja auch um all das, alldieweil ich in den letzten Tagen eines Jahres geboren worden bin. Mein Tierkreiszeichen ist das Vierzehnte – Corvus. Und dem Zodiakus des Raben misst man nicht umsonst den Tod bei.
14. Okt. 2006 - Marc-Alastor E.-E.
Bereits veröffentlicht in:
|
|
DES TODES BLEICHE KINDER
B. Jung (Hrsg.) |
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



