
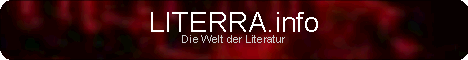
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Marc-Alastor E.-E. > Düstere Phantastik > Der Dorn im Auge |
Der Dorn im Auge
von Marc-Alastor E.-E.
Von allen Bekenntnissen, die ich einzugestehen bereit bin, stelle ich stets meine Vergesslichkeit allen anderen voran. Zu dieser mir seit frühester Kindheit eigenen Gedächtnisschwäche kommt ein mir unverständlicher Mangel an Genauigkeit. Von Zeit zu Zeit entsinne ich mich an bestimmte Begebenheiten, vertausche jedoch Personen, Handlungen oder Umstände, und daher bin ich mir in einzelnen Fällen selbst uneins, ob sich alles letzten Endes so zugetragen hat, wie ich davon berichte. Zeit meines Lebens habe ich daher ein natürliches Gespür für diese Schwäche entwickelt, so dass ich schon während ich erzähle, meine Unsicherheit bemerke und dieser dann eiligst Ausdruck verleihe, damit im Nachhinein nicht der Eindruck entstünde, ich hätte willentlich gelogen. Sie können sich sicher vorstellen, wie viel Ungereimtheiten und bösliche Missverständnisse daraus bereits entstanden sind, und wie wenig jene von mir gewollt gewesen sind. Deshalb mühe ich mich stets, nur auf das zu schwören, welches mir sicher erscheint, und alles andere als fraglich und sogar bedenklich auszuweisen.Bei den Begebenheiten, die ich Ihnen nun allerdings erzähle, bin ich mir allein ob der Eigenartigkeit der Vorfälle ausgesprochen sicher, dass sich alles so zugetragen hat, wie ich es Ihnen nun darlegen möchte. Ich tue dies, weil ich mir meiner Schuld vollauf bewusst bin, doch mahne ich Sie dennoch zur Achtsamkeit, denn so sehr wie sich diese Geschichte in mein Gedächtnis gebrannt hat, muss sich nun mein Zweifel an die Gesundheit meines Verstandes wenden.
Alles begann sicherlich an dem Tag, da ich vom Lande und dem Hof meines jüngst verstorbenen Großvaters, bei dem ich seit frühester Jugend gelebt hatte, in die nächste, größere Stadt zog. Noch vom Schock des plötzlichen Todes gezeichnet, hatte ich Hof, Vieh und Gerätschaften rasch veräußert, um zu Geld zu kommen und nach Möglichkeit alles, was mich an die gemeinsame Zeit mit meinem Großvater zu erinnern vermochte, vergessen zu können.
Verstehen Sie mich nicht falsch, mein Großvater war ein großartiger und ehrbarer Mann, und ich konnte auf eine glückliche, wenn auch arbeitsame Jugend zurückschauen. Doch es war mein Ansinnen, ein neues Leben zu beginnen, und dies sollte nicht gleich mit bekannten, alten Aspekten geschehen. Dreißig Jahre harte Arbeit waren mehr als genug, wie ich fand, und es war an der Zeit, etwas von der Welt und ihren Freuden erleben zu dürfen.
In der Stadt zog ich in eines dieser schmalen, mehrstöckigen Wohnhäuser, die eher bescheiden ausgestattet sind. Ich gedachte, mein Geld nicht unbedingt zum Fenster hinauszuwerfen, denn ich plante, mir erst in einigen Wochen eine Arbeit zu suchen. Derweil wollte ich mein Leben etwas genießen, Bekanntschaften knüpfen und mich in der städtischen Gesellschaft einfinden. Ich glaube, dass ich mich nie lebendiger und freudiger gefühlt habe, als in jenen Stunden, als mir der Vermieter meine kleine Maisonette zeigte. Sie war möbliert, hatte ein kleines Schlafzimmer unter dem Dachgiebel mit einem dieser wunderbaren Ochsenaugen, die einem einen fantastischen Ausblick über die Dächer der Stadt boten, sowie eine Kochnische mit allem was nötig war, um bescheidene Gerichte zu kochen. Ich erzähle Ihnen das alles nur deshalb so genau, damit Sie erkennen mögen, wie präzise meine Erinnerung in diesem Falle ist.
Das Mobiliar sei von den Vormietern übrig geblieben, erklärte mir der Hausherr damals, ein nobel gekleideter Bankier mit einer riesigen Taschenuhr, einem Stock, der einen silbernen Greif auf dem Knauf trug und einem Monokel – woran ich mich am besten entsinne, alldieweil es stets von seiner kleinen Nase kippte – und fuhr anschließend fort, jener letzte Mieter habe die Wohnung plötzlich räumen müssen. Dabei setzte er, so weiß ich noch, ein ungeschlachtes Lächeln auf. Mir war es zu diesem Zeitpunkt einerlei, weshalb jener Vorgänger die Wohnung verlassen hatte, ja, mir entging auch, dass der Hausherr in diesem Zusammenhang zunächst in der Mehrzahl gesprochen, dann aber in der Einzahl geendet hatte; wichtig war mir, eine solide und behagliche Behausung in der grauen, fremden Stadt zu haben.
In der folgenden Nacht aber, dessen hänge ich nur allzu gut nach, vernahm ich, nachdem ich zu Bett gegangen war, das entfernte Geräusch zum ersten Mal. Zunächst schien nur die Ruhe der Nacht leise in den Ohren zu rauschen, danach begannen sich ungemein leise Laute aus dieser Stille hervorzuschälen, das ratternde Fahrwerk einer Droschke auf dem Kopfsteinpflaster, das Knirschen des Holzes oder der Wind, der sachte durch den Dachstuhl fuhr. Und allgemach traten die fremden Laute in den Vordergrund, breiteten sich gemächlich über allen anderen Geräuschen aus und wurden schon sehr bald zum Zentrum dessen, was man alleinig vernahm, doch nicht vernehmen mochte. Zunächst hielt ich es für den Nachbarn, der aus irgendwelchen Gründen zu nachtschlafender Zeit auf die Idee gekommen schien, Fleisch auf einem Holztisch flach zu schlagen. Die Monotonie des dumpfen Tones und die Müdigkeit der Reise und des Erlebten ließen mich trotzdem einschlafen.
Doch in jeder der Folgenächte hörte ich wieder das Geräusch und, hatte ich zu Beginn noch alles mit dem mir üblichen Humor ertragen, wurde es mir von Nacht zu Nacht unbehaglicher. Es gelang mir immer seltener, über das Geräusch hinweg einzuschlafen, so dass ich mich im Bett umherwälzte und verdrossen dem Tone lauschte, den ich längst verfluchte. Von Abend zu Abend erschienen mir die Laute klarer, eindringlicher und aggressiver, auch wenn ich mir sicher war, dass es sich nicht veränderte. Vor allen Dingen mutete es mir immer unwahrscheinlicher an, dass man nächtelang und ohne Unterbrechung solch ein Geräusch verursachen konnte, da mir keine Arbeit in den Sinn kommen wollte, die einem dauerhaft solch eine Gleichförmigkeit abverlangt hätte. Und so viele Fleischstücke hätten alle Metzger der Welt wohl kaum verkaufen können, wie mein Nachbar in diesen Nächten flach schlug.
Gerade als ich beschloss, am Folgetag meinen Nachbarn zur Rede zu stellen, da übertönte ein noch viel lauteres Klopfen das mir wohl bekannte, welches sogleich verstummte. Zunächst glaubte ich an eine Täuschung, doch kurz danach klopfte es noch einmal und nun gewahrte ich, dass jemand an meine Stubentür polterte. Geschwind sprang ich aus dem Bett, lief hinunter und öffnete meine Tür. Vor mir stand ein alter, gebrechlich wirkender Herr mit lohweißem Haar und in ein bleiches Nachthemd gekleidet. Er hielt eine Öllampe in der Hand und schimpfte mit einer lauten Stimme. Es wäre eine Frechheit, mitten in der Nacht solch ruhestörende Geräusche zu verursachen, und auch wenn ich neu sei und mich erst an die Gepflogenheiten der Stadt gewöhnen müsse, sei dieser Lärm nicht länger duldbar, er werde sich beim Hausherrn beschweren, wenn ich nicht auf der Stelle die Nachtruhe einhielte.
Es war schier unmöglich, ihn davon zu überzeugen, dass ich selbst Opfer des von ihm vernommenen Lärms geworden war und ihn deshalb in Verdacht gehabt hatte. Schließlich trennten wir uns einvernehmlich, die Angelegenheit bei der nächsten Möglichkeit dem Hausherrn vorzutragen.
Bereits in der nächsten Nacht begannen die Laute aber von neuem und sie beunruhigten mich mittlerweile so sehr, dass ich gereizt reagierte und in der Dunkelheit meiner Wohnung die Wände ablief, an einigen Stellen kurz verharrte, um zu lauschen, nur um mich kurz darauf an einer anderen Stelle erneut zu versuchen. Ich wollte feststellen, ob eine genauere Richtung auszumachen war, doch es erwies sich als unmöglich. Vielmehr noch, das Ergebnis war umso beängstigender, da ich mehr und mehr den Eindruck gewann, das monotone Klopfen begleite mich auf meinem Weg, so als stünde der Verursacher des Pochens direkt hinter mir.
Längst schwitzte ich und reagierte allergisch auf fast alle äußeren Einflüsse, welche meine Ruhe der Nacht störten. Ich fühlte sogar die Rauheit der Holzbohlen wie reißendes Schmirgelpapier unter meinen Fußsohlen. Mein Nachthemd klebte wie ein viel zu enger Anzug auf meiner Haut und ständig kitzelte mich ein Schweißtropfen, der an irgendeiner Stelle meines Körpers hinabrann.
Ich fand keinen Schlaf mehr. Das Pochen hörte nicht auf. Und es begann zunehmend in meinem Kopf zu schmerzen.
Eiligst kleidete ich mich, bereits am Ende meiner geistigen Kräfte, an und verließ fluchtartig die Wohnung, so dass ich fast über meinen greisen Nachbarn gestolpert wäre, der sich abermals vor meiner Stubentür eingefunden hatte, um mich auf das Übelste zu beschimpfen. Er würde wider meine Dreistigkeit um Hilfe anrufen und wenn das nicht helfe, mir höchstpersönlich mit einem Hammer den Schädel einschlagen. Die Angst vor den schmerzenden Geräuschen ließen mich den Greis nicht weiter beachten und in die Stadt fliehen, um die letzten Stunden bis zum Morgengrauen – die Zeit, in der ja bekanntermaßen ein jedweder Spuk endet – irgendwie hinter mich zu bringen.
Natürlich wähnte ich mich am Tage in Ruhe und versuchte mich daher im Hellen, wenn die Geräuschkulisse der Stadt lauter war, im Schlafen. Doch selbst gegen den Lärm aus den Höfen, den die Hausfrauen beim Schlagen des nassen Weißzeugs auf dem Wäschebrett erzeugten, oder gegen den regen Stadtverkehr von Kutschen, Droschken und Lastkarossen, setzte sich das geheimnisvolle Geräusch durch. Nur wenn ich das Haus verließ, verebbte das Pochen. Dann irrte ich vollkommen übermüdet durch die Straßen, fragte mich hinwieder, welch eigenartiger Fluch da wohl am Werke sei, oder ob ich mich doch zu schnell von meinem vorherigen Leben losgesagt hatte und ein gewisser Stress nun sein Tribut erheischte. Zuweilen suchte ich mir dann eine Pension und nahm mir dort für einige Stunden ein Zimmer. Ich schlief dort wie ein Toter und wurde ein jedes Mal erst zu später Stunde wieder wach.
Freilich waren meine Probleme damit nicht geringer geworden, denn ich musste natürlich ein jedes Mal in meine Wohnung, die mir mittlerweile unheimlich geworden war, zurück. Und die schlimmste Erfahrung stand mir damit noch bevor, denn kaum hatte ich meine Wohnstatt betreten und mich ob der vermeintlichen Ruhe in Sicherheit gewähnt, da begannen die Geräusche von neuem, als hätten sie auf meine Wiederkehr gelauert, nur um mich sorgsam umfangen zu können.
Beim dritten Mal jedoch waren sie lauter und eindringlicher als zuvor. Der Klang erzeugte längst schmerzhafte Vibrationen, die mir vorkamen, als versuche jemand mein Hirn gegen die Schädeldecke zu drücken. Auch wenn der Rhythmus der gleiche geblieben war, so kennzeichneten doch eine veränderte Klangfarbe und Tonhöhe die Laute.
Der Schmerz trieb mich gleichwohl bis in die Knie, und ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, außer mich ideell an die Laute zu heften und sie zu sondieren. Gleich einem Tier kauerte ich in einer Zimmerecke und kam mir dabei wie das Fell einer Trommel vor, welches unter der Wucht der Schlegel zu reißen drohte. An dieser Stelle vermeinte ich zum ersten Mal unter dem einen sich stets wiederholenden Ton, einen zweiten wahrnehmen zu können. Er war leiser und wirkte wie der Widerhall des Ersteren. Zweifelsohne veränderte sich dadurch aber meine Vorstellung von dem Klang, denn nun erinnerte er mich an den Schlag eines Herzens. Ein grausamer Schlag, herausfordernd und zugleich verächtlich.
An dieser Stelle, und das möchte ich gesondert betonen, entschwindet meine Erinnerung kurz, denn ich kann mir beim besten Willen nicht ins Gedächtnis rufen, wie ich es und in welcher Zeit ich es schaffte, die Tür zu erreichen. Dort angelangt, riss ich den Verschlag auf und fiel fast dem davor stehenden Mann in die Arme. Es war wiederum der greise Nachbar, dessen Haar diesmal zerzaust wie der Samenfilz einer Baumwollkapsel wirkte und welcher – diesmal schlicht wetternd und sich ereifernd – meinen Namen verwünschte und mir erneut mit dem Tode drohte, wenn ich nicht bald Ruhe gäbe.
Ich aber floh in die Nacht hinaus, kam verstört, und ohne ein Gespür für die Wirklichkeit zu haben, in das Zimmer einer Pension und lag danach eine ganze Nacht schlotternd und bebend vor Angst und, wie mir schien, kaltem Fieber unter der Bettdecke und lauschte in die absolute Stille der Nacht. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, dass in jener Nacht nicht ein einziges Geräusch außer meinem verhaltenen Atem zu vernehmen gewesen ist. Und nur diese vollkommene Ruhe schaffte es, mich zu beruhigen und mich im Morgengrauen einschlafen zu lassen.
Als ich am Abend erwachte, fühlte ich mich elend und schlecht, denn ich wusste, ich würde noch ein letztes Mal in diese vermaledeite Wohnung zurückkehren müssen, um meine Habseligkeiten abzuholen. Es stand für mich zu diesem Zeitpunkt außer Frage, der Sache auf den Grund zu gehen, da ich nur noch aus dieser Wohnung ausziehen wollte. Ich wusste nicht, was mit ihr nicht stimmte, und es kam mir nicht in den Sinn, dass es etwas mit dem Vormieter zu tun haben mochte, ja, ich entsann mich nicht einmal mehr der Bemerkung meines Hausherrn.
Es dauerte noch einige Zeit, bis ich mich überwinden konnte, die Straße, in der ich vorgehabt hatte ansässig zu werden, überhaupt zu betreten. Schlotternd stand ich schließlich vor der Tür und schaute zu meinen Fenstern empor. Ich entsinne mich, dass wir in jener Nacht einen klaren Himmel hatten und dass man die gotterlesenste Vielzahl funkelnder Sterne erblicken konnte, die es womöglich je zu sehen gegeben hatte. Ich halte nach wie vor fest, dass ich zwar an jenem Abend nur am Rande zwei schwarze Droschken vor dem Nachbarhaus und eine gewisse Aufruhr im Inneren des Gebäudes wahrnahm, doch dass ich mich unzweifelhaft und fürwahr daran erinnere.
Von meiner eigenen Aufgabe jedoch in Beschlag genommen, fasste ich mir ein Herz, eilte zu meiner Wohnungstür und vermeinte schon dort den garstigen Klang entfernt zu hören. Die Aufregung umklammerte mein Gemüt und schien mein Herz und meine Eingeweide mit Fieber heimzusuchen. Ich sehe noch deutlich meine zitternden Finger in unheimlicher Langsamkeit den Schlüssel in das Schloss schieben, dann die Türe aufschließen, den Knauf betätigen und den Eingang öffnen. Und wie der bestialische Gestank verwesenden Fleisches schlug mir sogleich das pulsierende Geräusch entgegen. Lauter und eindringlicher als je zuvor.
Gebeutelt von panischer Angst und den körperlichen Schmerzen, die ich durch die Lautstärke der unerklärlichen Laute empfand, schlug ich mich tapfer die Treppe hinauf und begann, im mir schwindenden Sinn, meine Habseligkeiten zu finden und sie in meiner Reisetasche zu verstauen. Ich war schweißgebadet und versuchte den Kopfschmerz, der sich dem Puls des Pochens angeglichen hatte, einzugrenzen. Selbst mein Herzschlag schien sich dem Klopfen anzugleichen. Und währenddem sah ich eiserne, einst polierte Bilder von meinem Großvater, das matte Silbergrau seiner Haare, das stählerne Blitzen des Beils, wie er es auf Holz schlug, das metallische Funkeln des Hammers, mit dem er Nägel in Zaunlatten hämmerte, und wie er einen silbergrauen Bierkrug durstig auf die Tischplatte ballerte, und da wusste ich plötzlich, ich hatte alles gepackt.
Eilig lief ich die Treppe in die Stube hinab, stolperte über einen Stuhl, den ich nicht gesehen hatte, riss die Türe auf und fiel sogleich zwei dunklen, uniformierten Männern in die Arme, die offenbar soeben Anstalten gemacht hatten, zu klopfen. Sogleich bat ich sie um Hilfe und haspelte erklärende Schilderungen hintendrein.
Die Polizisten blieben ruhig, lachten freundlich und drängten mich in meine Stube mit der Bitte, mir einige Fragen stellen zu dürfen. Ich glaube mich erinnern zu können, dass sie mir erklärten, man habe meinen greisen Nachbarn mit einem Hammer erschlagen vorgefunden und dessen Frau habe ausgesagt, ich hätte mich zwei Mal an deren Türe ungebührlich über Lärm beschwert, ihren Mann in Verdacht gehabt und ihm zuletzt sogar mit dem Tode gedroht. Unbändig versuchte ich mich und meine schmerzhafte Lage erneut zu erklären und meine Verwunderung darüber auszudrücken, dass sie bei diesem unerträglichen Lärm noch die Ruhe zu bewahren wussten. Ich vermochte nicht zu erkennen, ob sie mich verstanden, denn der Lärm in meinem Kopf wuchs stetig und ich raufte mir die Haare, während ich in der Stube hurtigen Schrittes umherlief. Längst übertönte der unheilige Puls jedes andere Geräusch, längst konnte ich die Stimmen der beiden Polizisten nicht mehr vernehmen, längst war ich bereit, einen Mord zu begehen, nur um diesen Lauten ein für alle Mal entrinnen zu können. Sie wollten oder konnten den Rhythmus nicht hören. Sie standen da, in ihren dunklen Gehröcken und mit ihren runden Helmen, schauten mich mit einer Mischung aus Häme und Belustigung an und fragten mich müßige Dinge, die ich nicht verstand.
Aber gerade als ich den Entschluss gefasst hatte, durch ihre Mitte aus der Wohnung zu stürmen, da erblickte ich zu ihren Füßen einige Bohlen, die sich im Takt mit dem donnernden Puls bewegten. Sie schienen locker zu sein und da sie die einzigen Balken waren, die den Schlägen folgten, musste sich darunter die Quelle des Übels befinden. Endlich hatte ich es gefunden. Endlich würde ich erfahren, was hier im Argen lag. Endlich würde sich alles zum Guten wenden, sagte ich mir, rannte auf die Polizisten zu, stieß sie beiseite und ließ mich zu Boden fallen. Dort krallte ich mich in eine Bohle und zog sie – Gott weiß wie – aus der Diele. Danach folgten die Zweite und die Dritte. Und dann legte ich zwei Gegenstände frei, von dem aber nur einer wirklich meine Beachtung verdiente, da er mir gänzlich unbekannt erschien und ich mich bis heute beim besten Willen seiner nicht entsinnen kann – der Lichtschimmer der Zimmerleuchte fiel genau darauf und ließ das grausige, mir fremde Ding noch widerwärtiger erscheinen – es war ein mattes, blaues Auge wie aus Glas, welches einen abscheulichen, milchigen Schleier über der starren Linse hatte.
Daneben lag ein blutbesudelter Hammer, an dessen Kopf zweierlei Haarsträhnen klebten – silbergraues und lohweißes Haar.
Der Blick dieses grausamen Auges aber schien unnachgiebig auf mich gerichtet, war irgendwie eins mit dem fürchterlichen Puls, fast als ginge er von ihm alleine aus, und jener machte mich wütend und tobsüchtig, so dass ich hochfuhr und lauthals schrie: "Da – daher kommt er, der fürchterliche Herzschlag – ich gestehe alles, wenn es nur aufhört, ich gestehe alles – ich erinnere mich an nichts."
31. Jan. 2007 - Marc-Alastor E.-E.
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



