
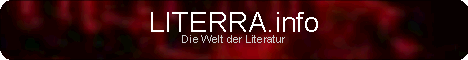
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Berndt Rieger > Mystery-Thriller > Voodoo Holmes - Der Pfeifenputzer |
Voodoo Holmes - Der Pfeifenputzer
von Berndt Rieger
Wenn die weißen Klippen von Dover auftauchen, weiß ich, dass ich Sherlock-Territorium betrete. Das macht sich anfänglich mit leichter Übelkeit bemerkbar, kann aber bis in mein Gedärm fahren, und die anderen Passagiere belustigen sich dann fortdauernd, dass es nun zu spät sei, um noch seekrank zu werden. Ist es Vorfreude oder Angst, die ich da empfinde?
Wahrscheinlich beides. Das Bewusstsein, der jüngere Bruder eines Genies zu sein, hat damit zu tun. Es ist fast so, als würde man nie richtig erwachsen. Und dann ist da das Gefühl des Abgrunds. Die ständige Bedrohung eines Mannes wie Sherlock, der gegen Verbrecherkartelle angeht, die Mächtigen entlarvt, das Böse einer gerechten Strafe zuführt. Das Gefühl, in dieses Spannungsfeld zu geraten, sobald man englischen Boden betritt. Der Zweifel, ob man in diesem Spiel mithalten kann, nicht nur der eigene Zweifel, sondern auch der in den Augen der anderen, denn sobald man mich sieht und ich mich vorstelle, kommt automatisch die Frage: Holmes, aber doch nicht der Holmes? - Nein, nicht der. Ein anderer.
Und was bin ich nun eigentlich?
Einen Privatdetektiv oder Spürhund würde ich mich selbst nicht nennen, obwohl ich es im Laufe der Jahre auch geworden bin. Und doch fühle ich mich mit den Berufsbezeichnungen wie Taschenspieler, Schlangenbeschwörer oder Befreiungskünstler wohler, alles Berufe, die ausgeübt und in denen ich mir meinen Ruf erworben habe. In Buenos Aires - würde ich behaupten -, kennt man mich, aber als was kennt man mich da? Als Priester eines Teufelskultes war ich bereits in den Gazetten abgebildet, mit einem Panamahelm, den ich an dem Tag zufällig trug. Ich stand damals aus Gefälligkeit einer religiösen Vereinigung vor, die dem Pan huldigte und Bacchanalien veranstaltete – die Laune einer Dame der besseren Gesellschaft, die mich auf der Straße aufgelesen hatte. Sie bezahlte pro Abend 100 Pesos, was mir gelegen kam. Ich war jung und brauchte das Geld. Außerdem machte es mir Spaß, nur mit einer gehörnten Maske bekleidet aufzutreten. Schon damals umgab mich das Gerücht, ich spräche mit den Toten. Eine exaltierte Bolivianerin bestand außerdem darauf, ich sei ein Verstorbener, der ins Leben zurückgekehrt war. Dieser Dame verdanke ich zu einem gewissen Teil meinen heutigen Beruf. Dann kam hinzu, dass ich kurz nach meinem Eintreffen mit dem Dampfschiff auf Friedhöfen übernachtete – dort vor allem in Grabhäusern der Vorfahren jener Reichen, die mich später als Maskottchen in ihre Gesellschaft aufnahmen. Sie erkannten recht bald, dass meine Begabung irgendwo in diesem Bereich liegt, eine Art von Ausstrahlung, die mir manchmal eigen ist, vor allem, wenn ich es darauf angelegt habe. Menschen werden blass davon und beginnen zu schwitzen, und wenn man sie fragt, was sie empfinden, drücken es so aus, sie hätten das Gefühl gehabt, es sei ihnen der Tod begegnet.
So ähnlich war es mit Diego Barcassas, der mich entdeckt hat. Eines Tages sah er mich wie eine Krähe auf einer der Friedhofsmauern sitzen. Er war schon an mir vorbeigegangen drehte sich dann aber noch einmal um, trat vor mich hin, holte seine Brieftasche aus der Jacke, blätterte mir ein Bündel Scheine hin und fragte: "Hast du heute Abend Zeit?"
"Was muss ich tun?"
"Einfach diesen Gesichtsausdruck aufsetzen. Das reicht."
"Warum, was ist damit?"
Ich merkte, dass er stark schwitzte. Diego war ein Mann Mitte Fünfzig, aber er wirkte älter. "Mir reicht es, wenn du beim Pokern neben mir sitzt", sagte er, "und dass dich Don Pedro anschauen muss."
Und so war es dann. Ich saß da, und der Mann, der Don Pedro hieß, verlor an diesem Abend eine größere Geldsumme, von der ich später, als wir an einer Bar abrechneten, zehn Prozent erhielt. "Egal, was du für den anderen tust", schärfte mir Diego ein, "nimm immer zehn Prozent von dem, was er dabei verdient, nicht mehr, aber auch nicht weniger." Von nun an begleitete ich Diego Barcassas bei seinen Geschäften, und er hielt sich streng an diese Regel. Ich wurde quasi einige Monate lang sein Leibwächter. Wenn ich neben ihm stand, bezahlten manche Schuldner ihre Rechnungen, und andere wurden ohnmächtig. Eines Tages sagte er mir aber: "Es tut mir Leid, lieber Freund, aber unsere Wege müssen sich trennen."
Als er meinen fragenden Gesichtsausdruck bemerkte, fügte er hinzu: "Ich bin alt genug, um zu wissen, dass jede Glückssträhne einmal zu Ende geht. Ich war noch nie so wohlhabend wie heute, und ich weiß, dass ich Dir alles zu verdanken habe." Im bittenden Tonfall fügte er hinzu: "Lässt du mich gehen?"
"Natürlich", erwiderte ich, "warum sollte ich nicht?" Ich musterte ihn und merkte, dass er bleich geworden war.
"Bitte", flüsterte er.
Dann verdrehte er die Augen und sank besinnungslos zu Boden
***
Man sollte denken, dass ich durch diese und ähnliche Erlebnisse die Empfindung entwickelt hätte, Macht über die Menschen zu haben. Tatsächlich ist das aber nicht so, zumindest nicht in meiner englischen Heimat. Offen gestanden löse ich auch in Buenos Aires mysteriöse Vorkommnisse und Kriminalfälle mit einem Gutteil an Analytik und nüchternem Sachverstand. Und doch wäre ich dort weniger erfolgreich, wenn ich es mit Menschen meiner Heimat zu tun hätte. Der Engländer mag sich für einen gottesfürchtigen Mann halten. Tatsächlich aber ist er ein Mensch, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, und solche Naturen empfinden mich nicht nur keineswegs als einschüchternd, sondern sie erscheinen mir völlig verschlossen. Vielleicht ist es auch dieses Ohnmachtgefühl, das mich befällt, sobald ich englischen Boden betrete, das Wissen, dass ich mit dem Hokuspokus, mit dem ich in Buenos Aires so manchen verzwickten Fall zu lösen vermochte, hier nur zweitrangige Ergebnisse erzielen könnte.
Hier der Text
Ich war erstaunt, dass mich Sherlock an der Victoria Station abholte, und noch überraschter, dass sein "Schatten", der gute Dr. Watson, nicht bei ihm war. Eines hing mit dem anderen zusammen, wie mir mein Bruder während eines Zwischenstopps im Shay-Club anvertraute: "Ja, er ist wieder bei mir eingezogen. Vorübergehend, wie ich Mrs. Hudson gesagt habe. Irgendetwas mit einem Rückgang seiner Praxiseinkünfte."
"Aber er schreibt doch auch. Er muss doch nicht von seinen Patienten leben, oder?"
Sherlock verzog sein Gesicht. "Das stimmt so nicht. Er hat nie wirklich von den Geschichten, die er über mich verfasste, leben können, selbst wenn man zugeben muss, dass er zwischendurch ein einträgliches Geschäft damit machte. Aber in letzter Zeit war vielleicht auch zuwenig Spektakuläres darunter. Oder ist es so etwas wie ein Schreibblock? Ich kann es nicht sagen."
"Oder deine lange Miene, Sher."
"Was würdest du dazu sagen, wenn dir dein Freund dauernd auf der Tasche liegt? Er lässt sich ja überall hin einladen, es ist peinlich. Ehrlich gesagt, kann das so nicht weitergehen. Wenn er sich nicht bald zusammenreißt, muss ich ihn auf die Straße setzen."
"Und deshalb hast du mir geschrieben?"
Sherlock machte eine unschuldige Miene. "Nein, keineswegs. Ich freue mich, wenn du da bist."
"Zumindest liege ich dir nicht auf der Tasche, Bruderherz."
"Ich meine nur, es wäre doch auch für dich eine nette Abwechslung. Ich habe da einen interessanten Fall. Offen gestanden komme ich damit auch nicht so recht weiter. Ich habe derzeit eben sehr viel zu tun. Die Jagd nach dem karibischen Opal, und dann ist da noch die Angelegenheit mit dem Borghodon."
"Aber das wären doch gute Fälle für Watson. Karibischer Opal, das klingt verkaufsträchtig."
Sherlock zog die Stirn kraus: "Ich bezweifle, dass er sich überhaupt der Komplexität der Verhältnisse bewusst ist. Und das gilt für beide Situationen."
"Also gut", gab ich mich geschlagen. "Welchen Fall hast du für mich vorgesehen?"
***
Am folgenden Morgen sprach ich wie mit meinem Bruder vereinbart in der Baker Street vor. Als ich den Salon betrat, saß dort ein Mann aufrecht in dunklem Anzug und Monokel und mit einer großen goldenen Uhrkette. Kaum war Mrs. Hudson meiner ansichtig geworden, drehte sie schon den Kopf und rief: "Dr. Watson!"
Er eilte herbei und wir begrüßten einander herzlich, auch weil wir einander schon seit einigen Jahren nicht mehr gesehen hatten. Dann trat Watson gleich zu dem Herrn im dunklen Anzug hin und machte ihn mir als Mr. Payne aus Kensington Gardens bekannt. Während Watson sprach, fiel mir auf, dass er den Mann vorstellte, als handle es sich bei ihm um einen Patienten, und tatsächlich war es so. Seine Frau hatte ihn verlassen. "Mr. Holmes", sagte er mit einer leisen, heiseren Stimme, "es ist ein großes Unglück, von dem ich nicht sagen kann, ob es das Leben kosten wird. Gekostet hat. Ob es das Leben meiner Frau …" Er brach ab.
"Sie wollen sagen, dass Sie traurig über das Verschwinden Ihrer Frau sind", sagte ich, so sanft und mitfühlend, wie man das von einem Arzt erwarten würde, "und zugleich in der Ungewissenheit befangen sind, ob sie nun wissentlich oder gar absichtlich das Haus verlassen hat, oder vielleicht – entführt wurde?"
Er nickte stumm.
"Und worauf führen Sie diese Vermutung zurück?"
Mr. Payne hob ratlos die Schultern.
Ich blickte Sherlock an, der sich im Hintergrund gehalten hatte. Er stand beinahe hinter dem Vorhang am Fenster und hielt lesend ein Buch in die Höhe.
"Es handelt sich um eine Entführung, Holmes", sagte Dr. Watson in einem drängenden Tonfall, als wünschte er sich das. "Wollen Sie sich nicht das Haus ansehen?"
Nun war es an mir, ratlos die Schultern zu heben.
***
Eine halbe Stunde später hielt unsere Droschke vor einem sehr ansehnlichen Haus in unmittelbarer Nähe der Kensington Gardens. Unser Gastgeber führte uns mit sichtlichem Stolz durch das weitschweifige Haus. Auf meine Frage, ob seine Frau irgendetwas mitgenommen hätte, zeigte er uns wortlos ihre privaten Gemächer. Ich blickte auf den Schminktisch mit allen Utensilien und dem leicht gewellten Spiegel. Ich öffnete die Kleiderschränke. Sie waren dicht gefüllt, und es gab sogar einen eigenen Raum mit Schuhen, so zahlreich, dass keiner sagen konnte, ob nun das eine oder andere Paar fehlte. Draußen im Salon, einem herrschaftlichen Raum von der Größe eines Tanzsaals, wies der Hausherr auf ein Gemälde, das Porträt einer Frau, und sagte dazu: "Das ist sie, beziehungsweise war sie es, Sie werden an der Signatur erkennen, dass es sich um einen alten Meister handelt. Dieses Bild ist über zweihundert Jahre alt. Zugleich aber ist es auch das perfekte Abbild meiner Frau, weshalb ich es vor kurzem von einem Händler in der Gomer Street erstanden habe, um es meiner Frau zu ihrem Geburtstag zu schenken."
"Wann war das?"
Er überlegte, und flüsterte: "Am vergangenen Mittwoch."
"Und wie hat sie darauf reagiert?"
"Als ich nach Hause kam, war sie nicht mehr da."
"Standen die Türen offen, oder war eines der Fenster beschädigt?"
"Nein, es war alles an seinem Platz. Ich kam nach Hause, schloss die Tür auf und wartete auf meine Frau in der Annahme, sie sei noch in die Stadt gegangen. Sie wollte noch etwas einkaufen."
"Sie leben allein?"
"Ja. Wir haben keine Kinder."
"Seit wann lebten Sie zusammen?"
"Drei Jahre."
"Das ist nicht lang. War Ihre Ehe glücklich?"
"Ja, überaus. Wir liebten einander mit einer Intensität, die mit der Zeit noch gewachsen war."
Bei diesen Worten nahm seine Stimme an Festigkeit an, was mich dazu veranlasste, meine Befragung auf dieser Schiene fortzusetzen. "Ah ja. Die Intimität nahm zu und Sie hatten keine Geheimnisse voreinander."
"So ist es."
"Sie freuten sich jeden Tag darauf, endlich nach Hause zu Ihrer Gattin zurückkehren zu können."
"Ja."
"Sie sahen, dachten und lebten nur mehr diese Dame."
Als sich nun ein Ausdruck der Irritation auf das Gesicht des Hausherrn malte, schlug ich die Augen nieder und fuhr fort: "Es besteht ein kleiner Altersunterschied?"
Nun hatte man das Gefühl, die Stimme Mr. Paynes töne aus einem Grab, als er bekannte: "Dreiundzwanzig Jahre."
"Was zählt das Alter, wenn der Himmel einen füreinander bestimmt hat?", fragte ich, worauf sich sein Gesichtsausdruck wieder aufhellte. "Das ist wahr."
"Und was machte Ihre Frau den Tag über?"
"Sie las oder ging spazieren."
"Das ist nicht viel."
Der Hausherr zuckte mit den Achseln.
"Sie war also ziemlich faul?", fragte ich geradeheraus.
"Nein, war sie nicht."
"War sie krank?"
"Nein, keineswegs. Was sollen diese Insinuationen? Meine Frau war von hohem Charakter."
"Gewiß."
Die junge Frau auf dem Bild trug ein hochgeschlossenes Kleid, das dicht mit Diamanten besetzt war. Ihr blondes, hochgestecktes Haar wurde von einer Brosche geziert, die aus Kristall, vielleicht aber auch aus Edelsteinen zusammengesetzt war. Die dunklen Augen passten nicht zu dem hellen Haar, und schauten groß und eindringlich, beinahe hypnotisierend auf den Betrachter.
"Haben Sie eine Photographie Ihrer Frau?", fragte Watson, dem offenbar der Augenblick geeignet schien, in meine Befragung einzugreifen, sah aber dann das Bild bereits auf einer Anrichte stehen und trat näher. "Was für eine verblüffende Ähnlichkeit, goldig!", rief er aus, fuhr dann aber erschreckt zusammen, als er bemerkte, was ich mittlerweile mit dem Gemälde veranstaltete. Ich hatte nämlich unterdessen meinen Pfeifenausputzer aus der Tasche geholt und kratzte mit der Spitze an der Ölfarbe. "Um Himmels willen!", entfuhr es Watson, aber es war bereits zu spät: Schon hatte ich ein Loch in die Leinwand gestoßen. "Hoppla", sagte ich. Die Oberfläche des Bildes war nämlich brüchig geworden, und zahlreiche Haarrisse sprachen von vergangenen Zeiten.
Ich drehte mich um: "Eine Fälschung ist wohl auszuschließen." Ich musste grinsen, als ich den schmerzensreichen Gesichtsausdruck des Hausherrn sah. Watson blickte mich an wie ein Erziehungsberechtigter, doch er beschränkte sich darauf, mir schweigend die Photographie der jungen Dame unter die Nase zu halten. "Tatsächlich, Watson, die Ähnlichkeit ist frappant", bestätigte ich, und wandte mich dann an Mr. Payne. "Wie kamen Sie dazu, das Bild zu erstehen?"
Ich merkte, dass der Mann sichtlich schwitzte.
"Der Antiquitätenladen liegt auf meinem Heimweg. Ich sah das Bild hell erleuchtet in der Auslage und erkannte sogleich, dass es sich um einen mystischen Zufall handelte. Sie müssen zugeben: Man hat den Eindruck der Identität zwischen diesen Frauen, und sie sind doch zweihundert Jahre voneinander entfernt."
"Ja, tatsächlich. Und verzeihen Sie das Missgeschick", meinte ich, während ich mit dem Pfeifenausputzer wedelte, "es gibt da Dings, Typen, die so was reparieren. Die Rechnung geht dann an meinen Bruder."
***
Am folgenden Morgen fanden wir uns in der Gomer Street wieder – einer schmalen Gasse, die von der Tottenham Court Road, einer dicht befahrenen Verkehrsstrasse, abzweigt. Wir gingen die Strasse hinauf und hinunter, fanden aber weder einen Antiquitätenladen, noch ein anderes Geschäft in der baufälligen Strasse, deren ehemalige Ladeneingänge mit Holzverschlägen verbarrikadiert waren. Ich hatte mich irgendwo an eine Wand gestellt, als ginge mich das alles nichts an und schaute geradeaus, während Watson ratlos im gleißenden Sonnenlicht zwischen den Hauswänden herumwandelte.
***
Am Nachmittag kam dann die Überraschung, und es stimmte mich ein bisschen verdächtig, dass die Angelegenheit in Dr. Watsons Dienst fiel, den er am St. Mary’s Hospital tat. Ein Hotelbote brachte mir die Nachricht, als ich im Wintergarten nach südamerikanischem Brauch meine Siesta hielt. Ich eilte ins Krankenhaus, wo mir ein sichtlich erregter Watson in weißem Mantel gegenüber trat. "Es ist eine junge Frau", sagte er, "Holmes, ich spüre, das ist sie."
"Ja?"
Ich folgte ihm einen langen Gang hinab. Dann ging es eine Treppe hoch und wieder auf einen anderen Flur, und während wir nebeneinander ausschritten, erzählte er mir die Geschichte. Die junge Frau war bewusstlos in den Kensington Gardens aufgefunden worden. Der Parkwächter, der sie auf dem Kies liegend antraf, vermutete anfangs das Schlimmste. Sie hatte die Augen geschlossen und atmete flach und aus einer Wunde an ihrem Hals tropfte frisches Blut. Tatsächlich aber handelte es sich nur um eine oberflächliche Verletzung. Wie es nun aber zur Bewusstlosigkeit der Dame kam, so mochte die große Hitze eine bedeutende Rolle gespielt haben. Kaum war sie in den Schatten gebracht und ihre Stirn mit Eiswürfeln gekühlte worden, zeigte sie erste Lebenszeichen, wurde aber zur Beobachtung ins St. Mary’s gebracht. Eine anhaltende Schwäche bestand aber noch zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wie ich mich durch eigenen Augenschein überzeugen konnte. Die junge Dame lag in einem großen, hellen Krankensaal auf einem weißen Bett mit weißen Tüchern, aus denen nur mehr ihr weißes, vom Hellblond ihrer Haare umgebenes Gesicht hervorragte. Sie fieberte, ihr Puls ging rasch und sie schien benommen. In dem ganzen Bild gab es nur einen dunkleren Farbtupfen, und der befand sich an ihrem Hals.
Es bestand kein Zweifel, dass ich die Frau auf der Photographie und auf dem Gemälde vor mir hatte, und dass sie gerade an der Stelle, wo ich die Leinwand mit meinem Pfeifenausputzer zerkratzt hatte, nämlich am Hals, eine frische Wunde trug.
"Ich dachte unwillkürlich an einen Vampirbiss", stammelte Watson, "aber gut, Vampire … nun, vielleicht Schlangen."
"Wie?"
"Vergessen Sie’s."
Ich zog meinen Pfeifenputzer aus der Tasche und betrachtete ihn näher. An seiner Spitze hatte er eine Rille, das heißt, es war eigentlich eine Doppelspitze. Ich hielt den Pfeifenputzer direkt an den Hals der Bewusstlosen, und siehe da, der Abstand der zwei kleinen Bissstellen an ihrem Hals und der zwischen den Spitzen meines Pfeifenputzers war identisch.
Watson pfiff leise. Als ich ihn anblickte, sagte er: "Ich habe die Wunde sogleich frisch desinfizieren und gegen Tetanus immunisieren lassen."
"Konnten Sie mit ihr einige Worte wechseln?"
"Als sie kam, war sie ansprechbar, aber sie antwortete nur unverständlich und wirr. Und es war da dieser Mann."
"Welcher Mann?"
Watson zeigte mir, dass ich ihm folgen sollte. Wir traten nebenan in eine Kammer, wo ein älterer Herr auf einem Stuhl saß. Er trug eine Uniform, die dunkelblau und etwas abgegriffen war. Nun, da er unser ansichtig wurde, erhob er sich und näherte sich mit einem scheuen, devoten Lächeln.
"Mr. Spraddock", sagte Watson zur Vorstellung, "das hier ist Mr. Holmes."
Ich ärgerte mich etwas darüber, dass er die mögliche Verwechslung mit meinem Bruder zuließ, merkte aber, dass der Mann mit dem Namen ohnehin nichts anfangen konnte. Stattdessen zeigte er mit dem Finger in die Richtung des Krankensaals.
"Ich kenne sie", murmelte er, "ja ich habe die schon oft gesehen, aber ich dachte...", er machte eine kleine Pause, "...es wäre ein Traum gewesen."
"Ein Traum?"
"Ja. Sie müssen wissen, mein Name ist Spraddock, Ethelred Spraddock, und ich stehe im Dienste des Grafen Hocksmith-Burnes, in dessen Garten diese Dame mitunter wandelte, so auch in den letzten Tagen in vermehrtem Maße. Ich kann es nicht anders sagen, dass sie wandelte, denn sie schien kein Ziel zu haben, sondern sich dort einfach aufzuhalten. Meist trug sie einen Camisol."
"Die Dame wandelte im Garten des Grafen Hocksmith-Burnes?" fragte ich.
"Ja, selbstverständlich."
"Und nicht in den Kensington Gardens?" setzte ich hinzu, während ich Watson einen strafenden Blick zuwandte.
Mr. Spraddock lächelte wie jemand, der sich an eine häufige Verwechslung gewöhnt hat. "Nein. Die Gärten sind gewissermaßen … benachbart."
Ich merkte, dass Watson errötete.
Längst aber setzte Mr. Spraddock seine Erzählung fort: "Man sah sie und sah sie nicht. Sie war da, hinter einer Hecke. Schaute man aber um die Ecke, war sie schon wieder verschwunden. So konnte man auf der Suche nach ihr stundenlang durch den Garten laufen, und sah einmal hier einen Zipfel ihres Kleides, dann dort wieder ihren blassen Arm, oder nur die Finger, oder eine Schuhspitze, oder ihr Gesicht, hervorleuchtend zwischen Blättern. Sie antwortete nicht. Und wenn man dann um die Hecke trat, verschwand sie längst hinter einer anderen. Es war sehr belastend für den Haushalt des Grafen Hocksmith-Burnes, das können Sie mir glauben. Alles in allem geht das nun schon drei Monate. Wenn man darauf wartete, dass sie kam, blieb sie aus. Dann sah man sie wieder, einmal am Vormittag, dann wieder am Nachmittag, mitunter nachts. Ja, im vollen Mondschein. Sie müssen wissen, meine Wohnung liegt über der Garage, nun , und sie geht auf den Park und ich lebe allein, also, damit will sagen, meine Abende sind lang und ich habe einen Feldstecher. Ein Fernglas, das ich in den vergangenen Jahren vornehmlich auf die Planeten richtete. Bald aber machte ich es mir zur Angewohnheit, die Bäume und Büsche des Gartens zu durchsuchen, und tatsächlich sah ich sie dann eines Nachts im Mondschein, oder besser gesagt, ihre Silhouette. Es war merkwürdig, man hatte den Eindruck, sie grabe in der Erde. Ja, sie grabe oder vergrabe etwas. Jedenfalls hockte sie hinter einer Hecke und scharrte. Und das wiederholte sich dann, vor allem nachts. Man sah sie irgendwo hocken und mit raschen, kratzenden Bewegungen das Erdreich durchwühlen. Und das geht natürlich nicht. Es entstanden dabei ja richtige Maulwurfnester, müssen Sie wissen, die ich dann am folgenden Morgen mit dem Rechen zu begradigen hatte."
Ich merkte schon, dass dieser Mann eher Gärtner als Parkwächter war. Vielleicht wurde er etwas zugänglicher, wenn man mit ihm über sein Hobby sprach: "In Bezug auf die Anordnung dieser Scharrstellen, können Sie mir dazu etwas sagen?" fragte ich deshalb.
"Nein."
"Bestand ein Zusammenhang, örtlich oder von Seiten der Geometrie?"
"Nicht dass ich wüsste. Eher so, wie das auch Maulwürfe tun."
"In Bezug auf Wasseradern vielleicht", sagte ich, "oder Spannungsgittern. Sie wissen doch, Wünschelrutengänger können das aufspüren, und man weiß ja, dass Ameisenhäufen auf Gittern zu liegen kommen, wo sich zwei Wasseradern kreuzen, und dass Hunde solche Stellen meiden, Katzen aber lieben, und dass Buchen diese Stellen meiden, Eichen aber gerade dort hervor sprießen. Haben Sie solche Zusammenhänge beobachten können?"
Der Mann sah mich völlig verständnislos an und fuhr dann fort: "Egal, was sie gemacht hat und warum, man darf so etwas nicht. Der Park ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Und es ist streng verboten, die Parkanlagen zu benutzen oder gar zu beschädigen. Selbst der Herr Graf bleibt immer auf den Wegen."
Ich überlegte mir gerade, wie ich das Verhör fortsetzen sollte, da wurde ich von einem Aufleuchten in den Augen des anderen überrascht. "Und was ist jetzt, darf ich sie sehen?"
Ich wandte mich an Watson. "Sie sind der Arzt."
Er zuckte mürrisch mit den Achseln und wir kehrten in den Schlafsaal zurück. Dabei eilte uns Mr. Spraddock voraus, angetrieben von – nun, was? Vorfreude? Oder war es eher …. Schadenfreude? Jedenfalls rieb er sich die Hände und strahlte über das ganze Gesicht, als er dort stand. Sein Blick war auf das Antlitz der Schlafenden geheftet. Es schien angespannt, wie von schlechten Träumen, und glänzte.
"Jetzt haben wir sie", sagte der Diener des Grafen Hocksmith-Burnes bedeutungsschwanger, lachte dann auf und drehte sich zu mir um: "Sie müssen wissen, ich bin Schmetterlingssammler. Ja, ich spieße die Dinger auf. Die schönsten Stücke – hinter Glas."
"Was die Wunde an ihrem Hals betrifft", fragte ich ihn scharf, da mir der Mann unheimlich wurde, "haben Sie etwas damit zu tun?"
Er taumelte unter der Anschuldigung zurück. "Nein, nein, ich... entschuldigen Sie."
"Vielleicht mit einem Pfeil?" bohrte ich weiter. "Sie kennen doch diese vergifteten südamerikanischen Blaspfeifen, nicht wahr? Man weiß doch, dass diese Fieber auslösen können. Kann es sein, dass Sie Ihr Herr mit so einem Pfeil ausgestattet haben könnte, um damit die Einbrecherin in Ihrem Garten zu jagen?"
"Nein, aber das kann doch gar nicht sein", gab er zu bedenken, indem er den Finger der Bewusstlosen an den Hals legte: "Schauen Sie, Doktor", wandte er sich nun hilfesuchend an Watson, der sogleich einen zustimmenden Ton wie "Hrrrmm" hervorstieß, "zwei Einstiche. Vielleicht die Bisse einer Giftschlange. Nicht dass im gräflichen Garten..."
"Oder der Biss eines Vampirs, nicht wahr?" rief ich aus, "das wollten Sie doch sagen, oder? Nun, ich kenne den Grafen Hocksmith-Burnes nicht, er scheint sich nur nachts in den Trubel der Theater und Bars von West End zu stürzen. Jetzt sagen Sie mir bloß, Sie brächten ihm nach Sonnenuntergang das Frühstück an den Sarg, in dem er tagsüber zu schlafen pflegt!"
***
Abends bei Sherlock, der auf der Dachterrasse lag und in den Sternenhimmel blickte. Er hörte sich an, was wir herausgefunden hatten und sagte dann nach einer Weile: "Ja, ich habe gehört, dass die Vampire wegen der Umweltverschmutzung oder aufgrund von Spontanmutationen, in letzter Zeit auch tagsüber ihre Opfer suchen, aber das ist doch etwas zu weit aus der Luft gegriffen, nicht wahr, Watson?"
Er schwieg dann eine Weile. "Letztlich aber", fuhr er fort, "Voodoo, als du mit deinem Pfeifenputzer an dem Gemälde schabtest, teilte sich dein Zweifel an der Echtheit des Bildes der Frau mit, die es darstellte, und sie wiederum verfiel daraufhin in einem traumartigen Verwirrtheitszustand. Es liegt aufgrund der Spitze meines Pfeifenputzers nun ein böser Zauber auf ihr, und zwar ein weit schlimmerer Fluch als der, unter dem sie zuvor litt und noch die Gärten des Grafen Hocksmith-Burnes unsicher machen konnte. Denn obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon fremdbestimmt gewesen sein musste, waren ihre Augen offen, und sie hatte noch die Gewalt über ihre Glieder. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass dein Zweifel die Verlängerung eines schon bestehenden Zweifels ist, der aber schon weit länger bestand. Ein Zweifel an der Echtheit ihrer Existenz, nun, wie kommt so etwas zu Stande? Und dann müssen wir uns noch fragen, wie man den Zauber brechen kann, die Antwort ist aber längst klar: Das Gemälde muss entweder restauriert und jeder Hinweis auf dein Gekratze entfernt werden, das wäre die symptomatische Therapie. Kausal aber wäre, das Bild zu zerstören, was natürlich auch den Tod der Betreffenden zur Folge haben könnte."
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich meinem Bruder ein indianisches Rauschkraut zum Probieren mitgebracht hatte, dessen Wirkung noch nicht genau bekannt ist, aber es scheint das Bewusstsein zu erweitern. Dieses hatten wir beide im Laufe der letzten Stunde ausgiebig in unseren Pfeifentabak gemischt.
"Holmes!" rief Dr. Watson entsetzt aus, der dem Sherry schon etwas zu sehr zugesprochen hatte. Er lag beinahe in dem Fauteuil, in dem er vorher noch gesessen hatte, und der Ruf, den er ausstieß, hatte was Überirdisches.
Sherlock warf mir einen bezeichnenden Blick zu.
Watson setzte sich auf: "Um Himmels willen, Holmes", brabbelte er, "denken Sie an meinen Ruf im St. Mary’s! Wir müssen die Patientin retten, koste es, was es wolle."
Sherlock blickte ihn wortlos an, und dann wandte er sich wieder mir zu: "Ja, es ist letztendlich eine Liebhaberfrage", fuhr er fort, "darf man Kunst zerstören oder soll man sie bewahren?"
"Die Frage ist wohl, warum habe ich das Bild zerkratzt?", sinnierte ich. "Es war eine dieser Stimmungen. Du kennst das vielleicht. Wir standen da, in diesem wundervollen, prächtigen Haus, in dem alles stimmte. Es gab dort keinen Staub, und alles war an seinem Platz. Und da packte mich so ein Gefühl. Es war fast so, als wollte man einen Luftballon zum Platzen bringen, verstehst du?"
"Wenn eine Axt dagestanden hätte, hättest du das Gemälde zertrümmert", meinte Sherlock, warf den Kopf zurück und lachte.
"Man darf nicht zerstören, was einem nicht gehört!" Watson heftete den Blick unverwandt auf seinen alten Freund. "Außerdem, was diese junge Frau betrifft: Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass sie einmal, vielleicht in einem früheren Leben, Schlossherrin von Hocksmith war. Eine bislang unklare, aber sehr starke Verbindung zu dieser Vergangenheit hält sie gefangen. Denn schließlich sucht sie doch etwas auf dem Grundstück, etwas, das in der Erde liegt. Es könnte sich um Geschmeide handeln, oder einen Schlüssel, oder ein Schriftstück, das sie in einem früheren Leben dort vergraben hat, und dieser Gegenstand, den sie sucht, ist der Schlüssel zu ihrer Heilung. Wir sollten uns morgen früh bei erstem Tageslicht in den Park begeben und selbst zu suchen anfangen. Sie und ich. Genauso wie früher. Als unabhängige Beobachter haben wir doch alle Möglichkeiten, auf analytischem Wege und mit Beharrlichkeit zum Ziel zu kommen. Dort liegt unsere Aufgabe. Der zweite Weg wäre der, Hypnose einzusetzen, sobald die Patientin erwacht ist und im Bereich der Tiefenpsychologie unser Heil zu suchen. Wahrscheinlich wurde sie als Kind missbraucht oder sie hatte als junge Frau eine Fehlgeburt zu beklagen. Das ist es! Sie hatte einmal ein Kind, das wurde im Rosengarten verscharrt, oder ihr geraubt, oder wurde dort von einem Baum erschlagen. Jedenfalls ist es ein Unglück, das sie im vorhergehenden Leben nicht verwinden konnte und wahrscheinlich starb sie vor Gram daran, oder beging Selbstmord. Oder ein wahnsinnig gewordener Ehemann erschlug sie, weil er sie für die Mörderin des gemeinsamen Kindes hielt. Irgendeine Schuld, Holmes, und wenn es nur die war, dass er sie für den Verlust des Kindes verantwortlich machte."
"Watson, Watson, Watson", sagte Holmes in tadelndem Ton, und stand auf, während er an seiner Pfeife schabte und sie ausklopfte. Mir fiel auf, dass er den gleichen Pfeifenputzer hatte wie ich.
"Was nun schon wieder? Wenn Sie mit meinen Ideen nicht übereinstimmen, dann müssen Sie doch immerhin zugeben, dass sie von unserem Nichtstun zunehmend dahindämmert. Die Vergangenheit gewinnt einen immer stärkeren Zugriff und wird sie bald dahingerafft haben, wenn wir weiterhin untätig bleiben. Seitdem dieses Gemälde ins Haus gekommen ist, strebt sie unvermeidlich dem Tod zu. Als ich heute die Klinik verließ, hatte sie hohes Fieber. In den frühen Morgenstunden ist eine Krise zu erwarten, und wenn uns bis dahin nichts eingefallen ist, befürchte ich das Schlimmste."
"Also spricht alles dafür, das Bild zu zerstören!" Holmes, schwang seine langen Beine von der Liege und stand kurz entschlossen auf.
***
Wir nahmen eine Droschke nach Kensington. Das Haus unseres Klienten lag im Dunkel, was nicht weiter verwunderlich war, denn es war lange nach Mitternacht. Wahrscheinlich schlief er. Wir läuteten trotzdem an der Eingangstür. Es dauerte eine Weile, bis man öffnete. Mr. Payne schaute etwas verwundert, als er uns erblickte. Sherlock ist etwas größer als ich und hat schon vereinzelt graue Haare, aber die Familienähnlichkeit ist relativ stark. Hilfe suchend wandte er sich an Watson, der sich aber zugeknöpft gab. "Es betrifft das Gemälde", erklärte Sherlock knapp und wandte sich dann an mich: "Der Salon?"
Ich ging ihm voraus. Wir wurden gefolgt von Mr. Payne, der ratlose Worte stammelte, und Watson, der so etwas sagte wie: "Weiß ich selbst nicht."
Dann standen wir im Salon vor dem Gemälde, und es musste etwas im Blick meines Bruders gelegen haben, das unseren Gastgeber zum Aufschrei veranlasste. Da hatte Sherlock längst sein Schweizermesser aus der Tasche gezogen, das Gesicht der Frau aus dem Bild geschnitten und zusammengeknüllt. Bevor unser Gastgeber meinen Bruder an dieser Handlung hindern konnte – er schrie wie jemand, dem es um Leib und Leben geht –, hatte ich ihm längst eine mit dem Spazierstock über den Schädel gezogen. Während Sherlock das Leinwandstück auseinander riss, mir eine Hälfte in die Hand gab und sich die andere in die Pfeife stopfte, zündete ich ein schmales Scheit am Herdfeuer an und tat das Gleiche. Wir setzten uns auf den Boden dem Gastgeber gegenüber, der bewusstlos war und leicht am Kopf blutete. Watson kümmerte sich darum, was relativ praktisch war, denn wo hätte man um diese Zeit noch einen Arzt auftreiben können? Er lehnte es allerdings ab, einen Zug aus meiner Pfeife zu nehmen. Als ihm allerdings Sherlock seine anbot, rauchte er mit. Wahrscheinlich hielt er die Geste für versöhnlich, quasi im Sinne einer Friedenspfeife. Gemeinsam rauchten wir also abwechselnd das Leinwandstück auf und wurden wohlgemut dabei. Eine Stunde mochte vergangen sein, und der Morgen graute bereits, als draußen die Türklingel schellte. Wir erhoben uns taumelnd und blickten der Hausherrin entgegen, die sichtlich besorgt, kaum hatte sie den Salon betreten, auf den weiterhin bewusstlosen Hausherrn zustürzte. Ihr Gesicht, es wunderte uns nicht weiter, war kohlrabenschwarz.
"Er ist tot!", schrie sie, ließ den reglosen Ehemann los und starrte uns fassungslos an. Ich blickte zu Sherlock hinüber, der etwas verlegen wirkte und kicherte.
"Tun Sie doch etwas!" brüllte die Dame.
"Was schreien Sie mich an, er ist der Arzt", antwortete Sherlock, "und er ist doch der mit dem Spazierstock!"
"Dr. Watson!" rief sie da, als sie ihn erkannte, doch unser Freund war zu dem Zeitpunkt dermaßen weggetreten, dass er nur mehr ein "Hehe" hervorbrachte.
***
In der Zwischenzeit war unser Gastgeber, von seiner Gemahlin mehrmals couragiert geohrfeigt, wieder halbwegs aufgewacht, hatte sich torkelnd erhoben und auf das Sofa geworfen. Unsere Gastgeberin stand kurz mit verschränkten Armen da, und da wir wortlos zurückschauten, drehte sie sich mit einem unwirschen Ton um und begab sich ins Bad. Nachdem sie frisch gewaschen zurückgekehrt war, hatte sich ihre Stimmung deutlich gehoben. "Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist", gestand sie lächelnd, "aber so wohl habe ich mich hier das letzte Mal kurz nach der Hochzeit gefühlt."
Sherlock erhob sich, und ich tat es ihm nach. Wir stellten uns vor und küssten ihr die Hand, worauf sie kicherte. Ich hielt ihr meine Pfeife hin, doch sie winkte ab, goss sich stattdessen ein kleines Glas Sherry ein und sank rückwärts neben ihren Mann auf das Sofa, ihre Beine hochgeschlagen. Sie konnte das, selbst im Nachthemd, denn sie hatte schlanke Beine und schöne Füße. Zu der Gelegenheit erzählte sie uns, während ihr Mann nun mit gebeugtem Rücken und umwölkten Augen lauschte, was sich in den letzten Tagen und Wochen zugetragen hatte. Ja, tatsächlich hatte sie vor einer Weile ein Kind verloren, sogar abtreiben lassen. Ihr Mann wollte keinen Nachwuchs, und sie wollte ihm deshalb ihrerseits auch kein Kinderglück aufdrängen, obwohl sie sich wahrscheinlich danach sehnte. Als dann das Kind abgetrieben war, verlor sie den Halt im Leben. Das merkte sie dadurch, dass sie wünschte, nicht in dieser Zeit leben zu wollen. Die neue Welt war ihr nicht adäquat, nicht nur, weil in ihr dergleichen ärztliche Eingriffe vorgenommen und gewollt wurden. Sie sehnte sich nach der Ordnung und nach dem Modegeschmack jener Zeiten, die in alten Gemälden zu sehen waren, und die man an Gebäuden vergangener Epochen oder am Geruch vergilbter Bücher erahnte. So kam es, dass sie in dem Moment, als ihr Mann mit einem Gemälde nach Hause kam, das ihr suggerierte, sie habe schon einmal gelebt, völlig orientierungslos wurde. Sie hatte auf Nachfrage erfahren, dass die Frau, die hier in Öl dargestellt war, Lydia Gräfin von Hocksmith war. Im Adelskalender war nachzulesen, dass diese während der Geburt ihres ersten Kindes im Alter von siebenundzwanzig Jahren verstarb an gerade jenem Tag im August, an dem unsere Gastgeberin dann auch im Hocksmith Park kollabierte. Einige Nächte zuvor war sie bei ihrem Rundgang im Park von einem Insekt (s. Anmerkung) in den Hals gestochen worden. Diese Wunde hatte sich infiziert und ein Fieber hervorgerufen, unter dem sie aufgrund der Mittagshitze und der psychischen Erregtheit dann auch das Bewusstsein verlor. Nun aber, als sie im Krankenhaus erwachte und lebte, wurde ihr klar, dass sie keineswegs eine Widergängerin jener Gräfin von Hocksmith aus dem vergangenen Jahrhundert sein konnte, sondern Senta Payne hieß, siebenundzwanzig Jahre alt war und einen netten Mann hatte. Also stand sie auf und verließ das Krankenhaus im Schutze der Nacht barfuss und durch ein Seitenfenster.
***
Der Ehemann saß ihr zu dem Augenblick heulend zu Füßen und wiederholte unter Tränen immer wieder die gleichen Phrasen. Was für ein merkwürdiger Kontrast zwischen dem beginnend glatzköpfigen Gemüsehändler – denn das war er, wie ich später erfuhr– , der schon ziemlich aus der Form ging, und der ruhigen, sachlichen Vortragsweise dieser Dame, die sich ohne weiteres für höhere repräsentative Aufgaben in Adelskreisen empfohlen hätte. Er entschuldige sich bei ihr, er nannte sich einen Idioten, einen Gefühlsklotz, und er bat sie, bettelte sie an, ihm zu verzeihen, und übrigens auch, ihm ein Kind zu schenken. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit der eine oder andere Wunsch vorlag oder nur aus Scham vorgespiegelt wurde, weil wir anwesend waren und das alles miterlebten. Auch bleibt der Spekulation überlassen, inwieweit ein direkter Zusammenhang zwischen der späten Nachtstunde, der außergewöhnlichen Situationen, seiner Zerknirschung und einer Art Kater bestand, den wir alle, wenn auch aufgrund verschiedener Ursachen, hatten. Jedenfalls beneidete ich ihn um seine Frau. Sie hatte das gewisse Etwas, eine Form der Weichheit und des Gefühlsreichtums, den man recht selten vorfindet. Und manchmal ist die Anwesenheit eines warmherzigen Menschen wirklich mehr wert als alles andere.
Anmerkung:
Dabei handelte es sich um Anopheles bispiculata Pfeifenputzerensis, eine Stechmückenart, die mit einem doppelläufigen Stachel ausgestattet ist. Wie uns Watson einige Tage später nach einem längeren Gespräch mit einem Tropenmediziner erklärte, wird dieses Insekt mitunter in Verpuppungsform in den Blüten mancher tropischen Pflanzen eingeführt und kann eine Spielform der Schlafkrankheit hervorrufen. Benannt ist sie nach ihrem Entdecker, dem deutschen Forscher Ortwin Pfeifenputzer, der 1867 in Bombay der Ruhr erlegen ist.
15. Aug. 2007 - Berndt Rieger
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



