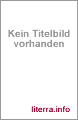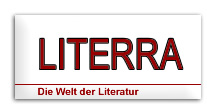
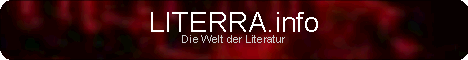
|
|
Startseite > Rezensionen > Peter Schünemann > Science-Fiction > Kallocain |
Kallocain
| KALLOCAIN
Buch / Science-Fiction |
1932 erschien Huxleys "Schöne neue Welt", 1949 Orwells "1984". Beide Werke sind weithin bekannt; selbst in Englischkursen an Schulen liest man sie (ich weiß nicht, ob das gut oder eher ein bedenkliches Zeichen ist).
Doch wie steht es um Karin Boyes "Kallocain"? Immerhin nennt das HeyneSFLexikon den Roman eine "bedeutende AntiUtopie, die ... manches vorwegnimmt, was später in George Orwells 1984 ... thematisiert wurde, beispielsweise den totalen Überwachungsstaat" (München 1987, S. 246). Und der Innentext der suhrkampAusgabe bezeichnet ihn als "wohl die bedeutendste AntiUtopie" zwischen den oben genannten Werken. Vielleicht ist "Kallocain" also weithin bekannt, und nur ich hatte wieder einmal keine Ahnung. Nun, besser zu spät als nie. Da es aber möglich ist, daß auch andere nichts über Karin Boye wissen, hier einige spärliche Daten (mehr fand ich nicht):
Die schwedische Lehrerin, Kritikerin, Lyrikerin und Schriftstellerin wurde am 26. Oktober 1900 geboren. "Ihre moralisch engagierte und formschöne Lyrik spiegelt die persönl. Problematik des von totalitären Zeiterscheinungen bedrohten Individuums wider", läßt uns der Brockhaus auf S. 590 seines dritten Bandes wissen. Ein Thema auf Leben und Tod, im wahrsten Sinne des Wortes: Karin Boye brachte sich am 24. April 1941 um. Einerseits gewann der Faschismus, den sie verabscheute, an Macht; andererseits enttäuschte sie, wie sich die Sowjetunion, ihre große Hoffnung, unter Stalin entwickelte. "Kallocain", 1940 geschrieben, gibt dem Ausdruck. Hier spricht eine Demokratin und Pazifistin, welche die Menschheit allmählich dem Totalitarismus rechter und linker Couleur verfallen sieht. Ihr "Weltstaat" trägt Züge sowohl Hitlerdeutschlands als auch der stalinistischen SU.
Leo Kall, die Hauptfigur des Romans, schreibt seine Erinnerungen auf. Er fristet in der Chemiestadt Nr. 4 des "Weltstaates" (der aber nicht die ganze Welt umfaßt) sein genormtes, streng geregeltes Dasein. Schon die Beschreibung des "ganz normalen" Alltags in den ersten beiden Kapiteln erweckt kältestes Grausen; allein die Bezeichnung der Staatsangehörigen, auch der Kinder, als "Mitsoldaten" spricht Bände. Überhaupt ist eines der zentralen Themen des Romans die Beziehung zwischen Frau und Mann sowie zwischen Eltern und Kindern unter dem Druck des totalitären Regimes. Karin Boye schildert diese Problematik mit schmerzhafter Eindringlichkeit. "Kallocain" ist eine politische, aber in noch weit stärkerem Maße eine soziale Dystopie.
Die Autorin läßt Kall, einen um Ergebenheit bemühten Staatsdiener, über die Umstände seines Daseins nachsinnen. Er benennt sie, er rechtfertigt sie, er möchte sie und sich selbst im Sinne der herrschenden Ordnung verbessern. Das Mittel dazu hat er erfunden: Eine Spritze seines "Kallocain" und jeder sagt die volle Wahrheit, gibt seine innersten Gedanken und Gefühle preis. Wir erfahren, wie Kall seine Erfindung am Menschen testet, wie ihre Bedeutung erkannt und ihre breite Anwendung unverzüglich in die Wege geleitet wird. Sein schönster Erfolg, sollte man meinen, und doch ist er unglücklicher denn je. In Wahrheit, in den Tiefen seines Ich, gehört er nämlich ebenfalls zu jenen "Defätisten", die er so wortreich verabscheut. Lange gesteht er sich das nicht ein, aber der Leser weiß es. Kall fürchtet sich davor, daß man ihm einmal die Spritze in den Arm stechen könnte.
Doch er findet auf andere Weise zur Wahrheit: in der Auseinandersetzung mit den Versuchspersonen, mit Linda, seiner Frau, und mit Rissen, seinem Chef. All diese Menschen haben eigene Gedanken über das Leben. Sie alle fragen, ob es denn wirklich das höchste Glück ist, völlig im Staate aufzugehen. Sie zweifeln aus ganz unterschiedlichen Gründen: aus Neugier, Liebe zu den Kindern, Enttäuschung durch den eigenen Beruf oder durch die Mitmenschen. Doch alle machen sie sich letzten Endes auf die Suche nach etwas anderem auch wenn sie nicht genau wissen, wie es aussieht. Linda, mit der Sicherheit einer Mutter, erkennt wohl am klarsten, was für sie selbst wichtig ist.
Der Roman vermittelt also keinen durchweg pessimistischen Eindruck. Sicherlich Karin Boye läßt den schließlich auch denunzierten und mit Kallocain gespritzten Rissen sagen: "Ich möchte so gern glauben, daß im Menschen eine grüne Tiefe ist, ein Meer voll unverbrauchter Lebenskraft, die alle toten Reste einschmelzen und ewig heilen und neu schaffen würde ... Aber ich habe die Tiefe nicht gesehen. Was ich weiß, ist, daß von kranken Eltern und kranken Lehrern noch kränkere Kinder herangezogen werden, bis das Kranke Norm geworden ist und das Gesunde ein Schreckbild. Von Einsamen werden noch Einsamere geboren, von Ängstlichen noch Ängstlichere ..." Doch unter dem Einfluß des Mittels spricht ein Mensch auch seine Hoffnungen aus, und so endet Rissens Rede mit folgenden Worten: "Oh, wenn sie doch trotzdem vorhanden wäre, die grüne Tiefe, das Unzerstörbare und ich glaube, daß sie existiert. Es ist wohl das Kallocain, aber ich freue mich doch, daß ich ... es glauben kann ..."
Man gewinnt den Eindruck, daß gerade die Droge, welche die Menschen noch stärker unter die Knute des Systems zwingen soll, der Anfang von dessen Ende werden könnte. "Wo aber Gefahr ist / Wächst das Rettende auch" schrieb Friedrich Hölderlin einmal vielleicht kann man damit die Botschaft des Buches am besten umschreiben. Das Kallocain, Leit und Titelmotiv des Textes, ist zwiegesichtig: Symbol für Resignation, aber auch für Hoffnung trotz allem für die Ambivalenz, mit der Karin Boye den Menschen betrachtet. Einige Augenblicke lang erlöst es die Verhörten von aller Angst, läßt sie offen sprechen, befreit sie so von angestautem Druck, konfrontiert sie mit den Wahrheiten in ihrem Inneren, mit ihren echten Gedanken, Wünschen, Gefühlen. Was Anlaß zur Auslöschung des Individuums sein soll, kann Quelle seiner Kraft werden: Wer so weit ging, hat kaum noch etwas zu verlieren. Selbst Kall erlebt endlich diese lichten Momente, die er mehr ersehnt als fürchtet. Dabei ist er seinem Mittel nicht einmal ausgesetzt. Aber er beobachtet täglich dessen Wirkung auf andere, und das befreit auch ihn. Wenn er am Ende seiner Erinnerungen schreibt: "Ich kann nicht, ich kann die Illusion aus meiner Seele nicht ausmerzen, daß ich immer noch, trotz allem, helfe, eine neue Welt zu schaffen." dann ist damit kein perfekterer Staat gemeint, sondern im Gegenteil eine Ordnung, in der das Individuum wieder zu seinem Recht gelangt.
So gesehen, stellt "Kallocain" eine düstere Bestandsaufnahme dar und gleichzeitig läßt es leise hoffen, daß da, allen Erfahrungen zum Trotz, doch jene Tiefe im Menschen ist, von der Rissen spricht in dem Karin Boye sich wohl selbst porträtiert hat.
Karin Boye: Kallocain. Roman aus dem 21. Jahrhundert; 1940, übersetzt von Helga Clemens, suhrkamp taschenbuch 2260 (Phantastische Bibliothek 303), 1. Auflage 1993, 160 S., DM 14,80
http://www.solar-x.de
Der Rezensent
Peter SchünemannTotal: 138 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info