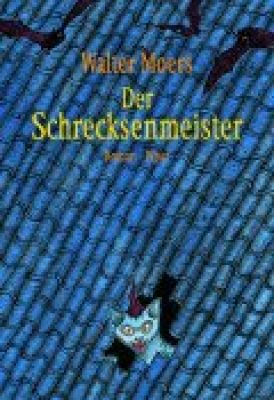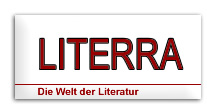
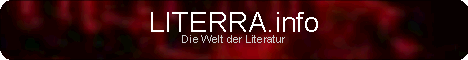
|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Fantasy > Der Schreckensmeister |
Der Schreckensmeister
| DER SCHRECKSENMEISTER
Walter Moers Fester Einband, 384 Seiten |
Mit „Der Schreckensmeister“ legt Walter Moers seinen fünften Zamonienroman vor. Der Roman sollte schon zu Weihnachten 2006 auf den Gabentischen liegen, aber eine Erkrankung Walter Moers machte das unmöglich. In seinem Nachwort berichtet der Autor, der sich selbst als Übersetzer der Werke und nicht als deren Erschaffer sieht, von den erheblichen Kürzungen, die immerhin mehr als siebenhundert Seiten umfassten. Ein stringentes und kurzweiliges Buch sollte es werden, frei von allen Abschweifungen, ein leserlicher Roman. Das Hildegard von Mythenmetz mit seinem letzten Roman „Die Stadt der träumenden Bücher“ eine Meisterleistung vorgelegt hat, macht es dem „Schrecksenmeister“ nicht leichter, sich in die Herzen seiner Leser vorzukämpfen und dort für Unwohlsein in Tradition der Stadt Sledwaya, der kränksten Stadt Zamoniens zu sorgen.
Gleich zu Beginn des Romans zeigt Walter Moers bei der Beschreibung des Schauplatzes seine herausfordernde Phantasie. Im Gegensatz zu anderen Zamonien- Abenteuern ist „Der Schreckensmeister“ keine Quest, die Handlung spielt sich überwiegend in einer Stadt, sogar in einem alten Schloss ab. In Sledwaya sind die Straßen nach Krankheiten benannt worden, es gibt keine körperliche oder geistige Schwäche, welche der unvorbereitete Besucher hier nicht antreffen kann. Nur in der ehemaligen Heilanstalt werden die Verrückten wieder gesund und die Ärzte wahnsinnig. Verdrehte Welt, mit der Walter Moers so gut spielen kann. Eine Stadt, in der man sich natürlich mit „Ohwehohweh“ begrüßt und sich bei der Verabschiedung gute Besserung wünscht. Eine Stadt im Siechtum, ein Ort für Schrecksen. Und natürlich den Schrecksenmeister. Deren Aufgabe ist nicht nur die Kontrolle der Schrecksen, sondern vor allem das Erfindungen neuer Drangsale, mit denen die Plagegeister an die Kette gelegt werden können. Wenn von unverständlichen, sich widersprechenden Steuererklärungen und sinnlosen Anweisungen gesprochen wird, fühlt sich der Leser an die Schildbürgerstreiche der eigenen Behörden erinnert. Mit sanfter, aber pointierter Ironie versetzte der Autor unsere quere Gegenwart immer wieder nach Zamonien und zeigt, dass mancher Aufreger in Wirklichkeit auch mit einem Lächeln und keiner mürrischen Miene bekämpft werden kann.
Im Mittelpunkt von Walter Moers Geschichte steht der Titel gebende Schrecksenmeister Succubus Eißpin, der in der ehemaligen geschlossenen Anstalt lebt und dessen Aufgabe es ist, die Schrecksen zu drangsalisieren. Er selbst sieht sich eher als ernsthafter Wissenschaftler, der mit seinen Entwicklungen dafür sorgt, dass es den hypochondrischen Bewohnern Sledwayas niemals langweilig wird. Dazu erfindet er eifrig Seuchen und Epidemien, die er mit Wonne über der Stadt verteilt. Wie Frankenstein sucht er allerdings noch nach einer Möglichkeit, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Und im nächsten Schritt den Lebenden das ewige Leben zu schenken. Ihm fehlt noch ein kleiner Bestandteil, der sich bislang weder durch Geld noch Forschung hat Auftreiben lassen: das ausgekochte Fett einer Kratze. Bis auf wenige Exemplare, die weit hinter dem blauen Horizont leben sollen, sind diese Wesen in Sledwaya ausgestorben. Bis auf eine Kratze, die Jahre lang bei ihrer gütigen Herrin gelebt hat. Als diese verstorben ist, wird Echo auf die Straße gesetzt. Sie ist nicht in der Lage, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen und die Bewohner meiden sie wie die Pest. Durch einen Zufall wird Eißpin auf sie aufmerksam und macht ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Für die nächsten dreißig Tage wird Echo in Eißpins Schloss kulinarisch verwöhnt und kann sich in dessen Räumlichkeiten aufhalten. Danach stellt sie ihr Körperfett dem Wissenschaftler zur Verfügung und lässt sich widerspruchslos töten. Das Kratzenfett ist nämlich nur wirksam, wenn die Kratze es freiwillig gibt. Echo unterschreibt den diabolischen Vertrag in der festen Überzeugung, mehr als genug Zeit zu haben, nach dem er wieder zu Kräften gekommen ist, dem Schrecksenmeister und dem Schreckenshaus zu entkommen. Allerdings unterschätzt Echo die Wirkung der guten Nahrung, die seinen Körper träge werden lässt. Als er diesen verhängnisvollen Kreislauf entdeckt, beschließt er, auf eine radikale Diät zu gehen. Alle Fluchtversuche scheitern, dass Eißpin heimlich Echo mit einem magischen Bann belegt hat, der ihn immer wieder in das Haus des Schrecksenmeisters zurückkehren lässt.
In seinen bisherigen Zamonien- Romanen hat sich der Übersetzer Walter Moers als ein Literat erwiesen, der seine ihm vorgelegten Geschichten ganz gegen den Strich der gängigen Literatur gebürstet hat. Da führte nicht nur ein Wort zum nächsten, sondern vor allem eine Idee zu einer isolierten Episode, welche die bisherige Erzählstruktur oft für Dutzende von Seiten aufhob. Am Ende des kleinen Exkurses führte Moers mit einer weiteren, scheinbar aus dem Ärmel geschüttelten Bemerkung die Handlungsebenen wieder elegant zusammen. Auch wenn diese Art des Geschichtenerzählens leicht als Quatschen interpretiert werden könnte, geben sie den Zamoniengeschichten ihren eigenen Charme. Da lag insbesondere an dem literarischen Gehalt dieser Abschweifungen. In der Tradition der Fabel hat Walter Moers hier einige bissige, aber auch prägnante Seitenhiebe auf die Gegenwart der Leser versteckt und andere Literaten kräftig auf den Arm genommen. Zu den wenigen guten Episoden gehört die Begegnung mit einem Flaschengeist, der einige Zeit das Spiel mit dem Rückkehrtest mitmacht, um seinen Opponenten gehörig zu veralbern. Da die Handlung im Vergleich zu Moers anderen Romanen stringent konzipiert worden ist und die Hänsel & Gretel Geschichte mit dem Frankensteinhinweis nur bedingt die Aufmerksamkeit der Leser fesselt, konzentriert sich der Roman auf die beiden herausragenden Protagonisten.
Mit dem Schrecksenmeister Eißpin hat Moers nicht nur einen dreidimensionalen Antagonisten geschaffen, der schon von Berufswegen her böse zu sein hat, sondern eine Figur, in die sich der Leser erst im Verlaufe der Geschichte einfühlen kann. Zu Beginn der Opportunist und Wissenschaftler, der für die Forschung im Grunde die eigenen Gliedmaßen opfern würde, wird die Figur plastischer, wenn der Leser erfährt, wie dessen Herz versteinert worden ist und das das Schicksal auch Tyrannen und Egoisten seine Streiche spielt. Natürlich fließt neben Frankenstein auch Goethes Faust in diesen typischen Charakter des maßlosen Wissenschaftlers ein. Von Mitleid zu sprechen, wäre zu viel des Guten, aber Walter Moers versucht die Figur insbesondere gegen Ende der Geschichte sehr nuanciert und emotional überzeugend, wenn auch nicht sympathisch darzustellen. Das genaue Gegenteil ist natürlich Echo, die Kratze. Sie hat vom Wesen her sehr viel von einer Katze, diese Szenen insbesondere zu Beginn der Geschichte sind sehr emotional geschrieben worden. Aus Verzweifelung hat sie mit Eißpin einen Vertrag geschlossen, der ihr für knappe dreißig Tage der Völlerei das Leben kosten wird. Ganz bewusst hat Walter Moers die Figur sehr stark an die eigenständigen, störrischen und doch liebevollen Charaktere der Katzen angelehnt, um dem Leser erst einmal eine verständliche Basis anzubieten. Erst im Verlaufe der Geschichte wird Echo als Figur überzeugender und hebt sich insbesondere vom literarischen Bild der Katze ab. Aus dem gestiefelten Kater wird eine typische Moers- Figur, die über sich hinauswachsen muss, um zu überleben Während andere Figuren wie zum Beispiel Rumo auf eine Quest gehen, um „erwachsener“ zu werden, muss Echo nur im Haus des Schrecksenmeisters überleben. Das alleine ist schon kein leichtes Unterfangen, da Moers seine beiden elementaren Protagonisten mit einer Reihe von für ihn so typisch skurrilen, aber lesenswerten Protagonisten umgibt. Sie sind auch für die vielen phantasievollen, aber als Ganzes betrachtet nicht immer befriedigenden Ideen verantwortlich. Nicht selten hat der Leser das unbestimmte Gefühl, einige Situationen schon aus den anderen Zamonienbüchern zu kennen. Es lässt sich vielleicht nicht der Figur auf die Wunde legen, aber Walter Moers hat in seinen vorliegenden Romanen inzwischen ein breites Feld bestellt und vor allem eine Unzahl von Situationen durchgespielt und Klischees auf seine berühmte Schippe genommen. Es fehlt im Grunde der nächste, obligatorische Schritt. Mit „Die Stadt der träumenden Bücher“ hat er angedeutet, dass er nicht nur ein großartiger Szenarist und Autor ist, sondern das sich seine phantastische Welt weiterentwickelt hat. „Der Schrecksensmeister“ wirkt dagegen wie ein Rückschritt ans vertraute Ufer. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Geschichte überwiegend in Sledwaya spielt, einer skurrilen Stadt der Krankheiten, die aber die Phantasie der Leser nicht festhalten kann. Im Vergleich zu den anderen Büchern gibt sich Walter Moers zu wenig Mühe, das Umfeld seiner Geschichte mit weiteren Schauplätzen zu versehen. Der Humor ist nicht zuletzt aufgrund der Story dunkler, nicht unbedingt bösartig, aber ein wenig zynischer. Hier fehlt teilweise das für seine Bücher so bezeichnende Gegenelement, mit dem er seine Leser immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt und an der Nase herumführt.
Walter Moers konzentriert sich zu stark auf die eigentliche Geschichte, die sich vor allem nach einem sehr guten Auftakt auf den mittleren Seiten dahinschleppt. Die Dialoge sind teilweise extrem in die Länge gezogen und nicht selten hat der Leser das Gefühl, als wisse Walter Moers selbst nichts mit einigen von ihm entwickelten Subszenarien anzufangen. Er beendet diese manchmal sehr abrupt und vor allem lieblos. Dabei wäre der „Schrecksensmeister“ schon ein besseres Buch, wenn der Autor seinen Nebencharakteren bessere und vor allem überzeugendere Hintergrundgeschichten gegeben hätte. Das Buch ist ja wie ein Countdown konzipiert, Echo hat nur eine begrenzte Anzahl von Tagen zu leben, in denen er sich der Völlerei hingibt. Nicht selten hat der Leser das unbestimmte Gefühl, als spiele diese Idee teilweise ein nur untergeordnete Rolle, als wäre es eine niedere Idee, um die Walter Moers nicht zuletzt aus vertraglichen Gründen seinen Roman herumplatziert hat. Im Vergleich zu „Die Stadt der träumenden Bücher“ ist „Der Schrecksenmeister“ eine kleine Enttäuschung, alles läuft zu glatt, zwar phantasievoll, aber irgendwie distanziert ab. Zamonien als mechanisches Puppenspiel.
http://www.sf-radio.net/buchecke/fantasy/isbn3-492...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info