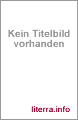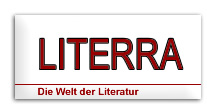
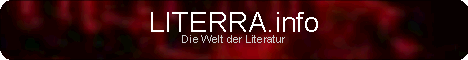
|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Phantastik > Bartleby |
Bartleby
| BARTLEBY
Buch / Phantastik |
Hermann Melville: "Bartleby"
Roman, Hardcover, 88 Seiten
Edition Büchergilde 2007
Hermann Melvilles „Bartleby, der Schreiber“ folgte unmittelbar auf seinen monumentalen Roman „Moby Dick“ und stellt gleichzeitig eine Abkehr von seinen oft autobiographischen Seefahrergeschichten dar. Rückblickend darf nicht vergessen werden, daß „Moby Dick“ im Grunde erst über sechzig Jahre später als einer der wichtigsten amerikanischen Romane des 19. Jahrhunderts entdeckt worden ist. Zu Lebzeiten hielt sich Hermann Melville mit einer Nebentätigkeit über Wasser, während er seine Romane verfasste. Auch „Bartleby, der Schreiber“ ist eine der Geschichten, die ihrer Zeit insbesondere in Hinblick auf den Protagonisten mehr als einen Schritt voraus ist. Sie lässt frühe Züge späterer kafka´scher Geschichten erkennen, auch wenn die erzählerische Perspektive durch die Nutzung eines Ich- Erzählers verzerrt wird. Dieser ältere Notar hat sich auf einträgliche, aber nicht mehr aufregende Nebentätigkeiten der Juristerei spezialisiert und beschäftigt in seinem kleinen Büro in der Nähe der Wall Street insgesamt drei Schreiber. Gleich zu Beginn beschreibt Melville das Büro als lichtlos, von Holzhäusern umstellt, im Schatten der Wall Street, die noch nicht das Mekka der Finanzwelt ist, aber zumindest als bessere Gegend in New York gilt. Fast grotesk überzeichnet der Autor die drei Schreiber, stellt sie als Karikaturen von modernen Dienern dar und macht sich ein Vergnügen daraus, ihre Schwächen bloßzustellen. Vor diesen bemitleidenswerten Kreaturen wirkt der bescheidene neue Angestellte Bartleby normal. Er beginnt seine einfachen Kopierarbeiten mit sehr viel Enthusiasmus und Fleiß. Zum Kopieren von Verträgen gehört auch die gegenseitige Kontrolle, die Bartleby schnell mit den Worten „ich möchte lieber nicht“ ablehnt. Der Anwalt lässt seinen Angestellten gewähren und fordert die anderen Schreiber auf, diese obligatorische Tätigkeit mit zu übernehmen. Schon bald möchte Bartleby auch seine normale Tätigkeit als Schreiber mit den gleichen Worten nicht mehr ausüben. Kurze Zeit später versucht der Notar Bartleby – inzwischen gänzlich unproduktiv und hinter seinem Wandschirm hockend – mit einer großzügigen Abfindung zu entlassen. Auch das funktioniert nicht. In seiner Verzweifelung und vor Gewalt zurückschreckend zieht der Notar schließlich um. Bartleby bleibt als eine Art Hausgeist in dem alten Büro zurück und erschreckt mit seiner abweisenden Art die neuen Mieter. Schließlich verhaftet ihn die Polizei und hält ihn ohne Anklage im Gefängnis fest. Den Notar rührt unnötig sein schlechtes Gewissen und er besucht seinen ehemaligen Schreiber im Gefängnis. Inzwischen verweigert Bartleby nicht nur den Kontakt mit seinen Mitmenschen, sondern jegliche Nahrung und stirbt nach wenigen Tagen im Gefängnis.
Die Ironie des Plots gipfelt schließlich in der Erkenntnis, dass Bartleby vor seiner Tätigkeit beim Notar in einer Sammelstelle für unzustellbare Briefe gearbeitet hat. Bis auf diesen Rückblick auf sein früheres Leben – die einzige Information, die Bartleby und Melville ihren Lesern gestatten – ist die kurze Novelle sehr stringent und geradlinig erzählt worden. Mit diesem Hinweis durchbricht Melville zwar die Kontinuität der Geschichte, versucht aber zum Leser und dessen Verständnis eine ironische und nicht unbedingt notwendige Brücke zu bauen. Ansonsten verfolgt man genauso staunend wie der Ich- Erzähler, dessen Motiv, die verrückte Begegnung Dritten zu erzählen nicht deutlich klar ist, den Verfall eines Menschen. Von Beginn an hat sich Bartleby von seinen Mitmenschen abgesondert und der Leser hat keine Möglichkeit, ihn direkt kennen zu lernen. Seine Antworten beschränken sich fast ausschließlich monoton auf die Worte „Ich möchte lieber nicht“, wobei offen bleibt, ob Bartleby unter echtem Druck die Aufgaben nicht doch erledigt hätte. Bartleby äußert im Grunde seine Meinung, eine Überzeugung, erst durch die Reaktion des Gesprächspartners wird aus dieser ablehnenden Haltung einer Verweigerung. Der Hintergrund der Geschichte überzeugt durch eine nicht zu leugnende Dualität. So besteht zwischen dem Gefängnis, in welchem der Schreiber schließlich durch seine inzwischen offensichtliche und aktive Verweigerung stirbt, und dem lichtlosen Büro, in dem er vorher arbeiten musste, ein Zusammenhang. Das Gefängnis konnte und durfte er nicht verlassen, das Büro wollte er nicht verlassen. Ganz bewusst ordnen Melville die Tätigkeiten der Schreiber militärischen Begriffen zu. Sie arbeiten wie Soldaten marschieren und auf ihrem Papier entstehen Kolonnen – es ist keine kreative oder intelligente Arbeit, die hier verrichtet wird. Stupide schreiben die Angestellten wie die alten Mönche die wichtigen Papiere ab. Dadurch wirkt in einer modernen Gesellschaft dieses hier beschriebene Büro wie ein Fremdkörper. In wie weit Züge von Hermann Melville in die Figur des Bartleby eingeflossen sind, lässt sich schwer erkennen. Immerhin konnte Melville neben seiner stupiden Tagestätigkeit noch Bücher veröffentlichen. Sicherlich hat er zu Lebzeiten als Autor keinen Erfolg gehabt, dieser setzte er viele Jahre nach seinem Tod ein, aber im Vergleich zu Bartlebys Leichenstarre wirkt er als Autor lebendiger. Die Kritik an der modernen Gesellschaft und insbesondere der grotesken Auswüchse des ersten Wirtschaftsboom der Wall Street könnte in einer Parabel auf die moderne Lohnsklaverei enden. Im Süden der Vereinigten Staaten schufteten die Farbigen als rechtlose Sklaven, einen großen Unterschied zu den hier beschriebenen Schreibern lässt sich kaum feststellen. Dagegen spricht allerdings, das sich insbesondere der Ich- Erzähler nicht wie ein arroganter Neureicher seinen Angestellten gegenüber verhält und Bartleby auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Gefängnis besucht. Im Grunde quartiert er sehr zum Unwillen seiner Angestellten Bartleby in einer Art Freistaat in seinem Büro ein und hebt damit die Erwartungen der kapitalistischen amerikanischen Gesellschaft weites gehend auf. Eine vernünftige Erklärung für sein außergewöhnliches Verhalten fügt der Autor seiner Geschichte nicht hinzu. Dabei ist Bartlebys Floskel „Ich möchte lieber nicht“ der Ausdruck einer freien Willenserklärung. Insbesondere in der harten Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts wirkt diese Äußerung fast grotesk, die sowohl den Arbeitergeber als auch die Kollegen verblüfft. Impliziert überspannt aber der Arbeiter Bartleby den Bogen und möchte ohne Arbeit ein Dach über dem Kopf haben und versorgt sich aus seinen Reserven selbst. Aus der freien Meinungsäußerung wird sehr schnell eine komplette Verweigerungshaltung der Gesellschaft im Allgemeinen und der Arbeitswelt im Besonderen gegenüber. Wie in einer guten Satire kann Melville den Bogen nicht überspitzen, in dem er seine Figur sich auch gegen das Leben an sich verweigern lässt. Wenn der Notar seine Ich- Erzählung mit den Worten „O Bartleby! O Menschheit`!“ beendet, ist dieser Aussagen hintergründig und doppeldeutig. Eine Menschheit bestehend nur aus Bartlebys kann und wird nicht funktionieren. In dieser Hinsicht ist der Ausruf des Notars sicherlich eine Warnung an die Welt. In anderer Hinsicht unterdrückt der Notar nicht seine Bewunderung gegenüber dem stoischen, fast autistischen Freigeist, der schließlich sein Leben selbst beendet, um in einer anderen Welt frei zu sein. Selbst der Notar – das impliziert Melville zwar nur, lässt sich aber insbesondere zu Beginn der Geschichte sehr gut ablesen, wenn der Notar von seinen unterschiedlichen Verpflichtungen selbst den höchsten Kreisen gegenüber spricht – ist nicht so frei wie Bartleby. Seine Anstellung im Büro für unzustellbare Post hat Bartleby sicherlich mit vielen menschlichen Schicksalen konfrontiert, vielleicht der Auslöser für seine Verzweifelung. Insgesamt ist „Bartleby, der Schreiber“ eine Parabel, für die es wahrscheinlich Dutzende von Interpretationsmöglichkeiten gibt. Sie gehört zu Hermann Melvilles besten Geschichten, lässt sich aber eher mit seinem Spätwerk „Masken“ als seinen Seeabenteuern vergleichen.
Die phantastischen Elemente sind gänzlich impliziert. Daher ist die Aufnahme in die Bibliothek von Babel auch eher ein Kompromiss Borges, lesenswert ist diese kleine, mit einem zynischen Ende versehene Geschichte auf jeden Fall.
http://www.sf-radio.net/buchecke/bibliothek-babel/...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info