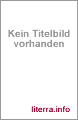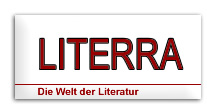
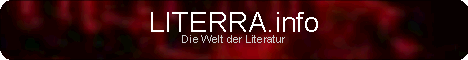
|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science Fiction > Odyssee |
Odyssee
| ODYSSEE
Buch / Science Fiction |
Jack McDevitt: "Odyssee"
Roman, Softcover, 608 Seiten
Bastei 2008
Mit “Odyssee” legt Jack McDevitt seinen inzwischen fünften Band um Priscilla Hutchins, die Raumpilotin und jetzige Leiterin der Raumflugakademie vor. Stand in den ersten Romanen wie “Gottes Maschinen” oder “Die Sanduhr Gottes” eine seit Äonen ausgestorbene technisch der Menschheit überlegene Rasse im Mittelpunkt des Geschehens, hat sich das Fokus spätestens mit dem dritten Band “Chindi” deutlich verlagert. Die Außerirdischen kommen dem Sonnensystem und der Gegenwart immer näher. Im Vergleich zu seinem zweiten Zyklus mit Romanen um den Archäologen Alex Benedict drohte Jack McDevitt im schon angesprochenen “Chindi” der plottechnische Overkill. Seine Bücher zeigen sich durch stringente Actionhandlungen aus, die im Vergleich zu anderen Autoren des Genres kaum auf kriegerischen Auseinandersetzungen basieren - bislang ist immer noch der größte Feind des Menschen der Mensch selbst gewesen -, sondern auf den Gefahren unwirtlicher Planeten und dem menschenfeindlichen All selbst. Im vorliegenden neuen Abenteuer kümmert sich McDevitt zum ersten Mal seit seinem Debütroman “Erstkontakt” um das Phänomen der UFOs. Im 23. Jahrhundert werden die fliegenden Phänomene Moonrider genannt. Gleich zu Beginn des Buches begegnet ein Vergnügungscruiser mehreren dieser dunklen Scheiben. Ein Kontakt ist nicht möglich. Wenige Augenblicke später fällt das Triebwerk des Raumschiffs aus, es muss den überlichtschnellen Raum verlassen und treibt im All. Von der Fluggeschwindigkeit her müßte das Schiff knappe einhundert Lichtjahre von der Erde weg sein, durch einen Zufall findet man es hinter der Plutoumlaufbahn. Kurze Zeit später wird ein zwei Kilometer großer Meteorit erst unmittelbar vor der Berührung der Erdatmosphäre bemerkt. Sein Einschlag hätte das Ende der Menschheit bedeutet. Anscheinend steht - der Leser ahnt diese Prämisse im Vergleich zu den teilweise sehr geschwätzigen und betriebsblinden Protagonisten mehrere hundert Seiten vorher - dieser Vorbeiflug in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Moonridern. Priscilla Hutchins wird zusammen mit einem Reporter und einigen Wissenschaftlern in die Tiefen des Alls geschickt, um das Phänomen der Moonrider zu eruieren und diese mittels Überwachungssatelliten aufzuspüren. Diese beobachten, wie die Fremden Asteroiden aus ihrem Orbit bringen. Einer wird in siebzehn Jahren eine unbewohnte Welt mit einem außerirdischen Artefakt treffen. Ein anderer wird ein neues im All gebautes Hotel in kürzerer Zeit treffen. Sollten diese Aktivitäten mit einer neuen Versuchsanordnung im All zusammenhängen, in welcher die Menschen natürlich „absolut sicher“ mit Kräften experimentieren wollen, welche die Struktur des Universums aus den Angeln heben können?
Die größte Schwäche des vorliegenden Romans ist seine im Vergleich zur Gesamtlänge schier endlose Exposition. Nach einem spannenden Auftakt verstrickt sich Jack McDevitt nicht nur in Diskussionen um Budgets und später eine mögliche Bewaffnung der Flotte, sondern fügt auf einer weiteren Handlungsebene eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen einem dogmatisch konservativen Prediger und einem inzwischen erwachsenen Schüler ein, welcher den ehemaligen Lehrer mit einem Buch von Mark Twain geschlagen hat. Diese Handlungsebene liest sich zwar solide und dem Autoren gelingt es auch, ausreichend Gesellschaftskritik zu äußern, aber in der Gesamtbetrachtung des Romans nimmt sie zu viel Raum der eigentlichen Handlung weg, die im vorliegenden Fall viel zu viele Fragen offen lässt. Ketzerisch gesprochen hat der Leser schnell das Gefühl, als könnte sich Jack McDevitt vor allem im Mittelteil nicht entscheiden, in welche Richtung sich der Plot entwickeln soll. Er deutet verschiedene Möglichkeiten an: könnte es sich bei den Moonridern um ein gigantisches Ablenkungsmanöver der Großindustrie handeln, um aussichtslose Projekte abschreiben zu können bzw. Milliardenschwere Aufträge zur Aufrüstung der Raumschiffe zu erhalten? Am Ende des Buches lässt sich diese Vorgehensweise zumindest für einen Handlungsstrang beweisen, auch wenn die Grundlage antikapitalistisch und eher im Kontext bemüht ist. Schließlich verfügen die Menschen noch nicht über die Technik, Asteroiden aus ihrem Orbit zu schieben, aber manchmal helfen ja ein wenig Mathematik und Astronomiekenntnisse. Kaum beginnt der Leser diese Prämisse zu akzeptieren, führt der Autor sie wieder auf den ursprünglichen Pfad zurück. Diese unentschlossene Haltung negiert McDevitts seine gute Absicht. So wirkt das Ende pathetisch und ein wenig kitschig, folgt aber der Tradition von McDevitts positivem Glauben und der Opferbereitschaft des Individuums für ein höheres Ziel. Man hätte seinen Figuren nur ein besseres Fundament gewünscht. Auf der anderen Seite macht er allerdings nicht den Fehler, am Ende alles erklären zu müssen. Dabei lässt er sich für eventuelle Fortsetzungen ausreichend Raum, aber im vorliegenden Band negiert er nicht weiter seinen unnötig komplizierten und verwickelten roten Faden. Im Vergleich zu vielen anderen Science Fiction Autoren sieht er im vorliegenden Roman nicht das Heil zwischen den Sternen. Kapitelweise werden die Vor- und Nachteile, die Kosten und Gewinne der Weltraumforschung diskutiert. Dabei bemüht sich der Autor, seinen Figuren eine ambivalente Haltung zu geben. Zusammen mit den Diskussionen um eine Verschwendung, Ausbeutung der Resourcen eine solide Ebene, auf der intelligent, aber fundiert analysiert wird. Das macht „Odyssee“ trotz der futuristischen Technik zu einem bodenständigen Hard Science Roman. Über diese philosophische Haltung hinaus gehört der Plot allerdings zu den schwächsten der Serie. Im Vergleich zu „Omega“ hat Hutch eine sehr viel größere, fundierte Rolle im Geschehen. Zu Beginn muss sie am Schreibtisch sich auf die radikal verändernden Szenarien einstellen. Ganz bewusst teilt McDevitt die Reaktionen ihrer Umgebung in zwei Kategorien ein: die Öffentlichkeit, vertreten durch einen befreundeten Reporter und die Kapitel einleitende Zitate sowie die innere Firmenopposition. Ihr Chef kommt aus dem politischen Lager, der sich mit Schmeicheleien, Inkompetenz und Delegation an Sündenböcke durch die Schwierigkeiten manövriert. Mit Ironie und spitzer Feder zeigt McDevitt deutlich auf, wie es ist, in einer Bürokratie zu arbeiten. Dabei sollte die Akademie auch von ihrer eindeutig kapitalistischen Ausrichtung eher einem Wirtschaftsunternehmen ähneln als einer Universität. Außer Hutch sind die anderen Protagonisten – zum Teil Widergänger aus früheren Teilen der Serie – allerdings eher eindimensional und passend gezeichnet worden. Hier fehlt teilweise das Konfliktpotential und insbesondere gegen Ende des nicht unbedingt überzeugenden Plots opfert McDevitt seine Protagonisten. Jack McDevitt ist sich nicht zu schade, die Menschen als ewige Nörgler und Grübler darzustellen, die mit Misstrauen und Furcht durch die Weiten des Alls streichen. Die größte Stärke des Romans liegt im Aufzeigen der Manipulationen der Öffentlichkeit sowohl aus politischen als auch religiösen Motiven. McDevitt macht allerdings den Fehler, diese interessante Prämisse nur ungenügend und oft fahrlässig in den eher banalen und am Ende im „Abyss“ Reich endenden Plot zu integrieren. Zusammenfassend ist „Odyssee“ ein Roman mit Stärken und Schwächen. Im Vergleich zu den letzten Hutch- Abenteuern stellt es zumindest eine kleine Verbesserung dar. Wer moderne Space Operas mit einem entsprechenden Sense of Wonder lesen möchte, ist derzeit bei seinen Alex Benedict Büchern besser aufgehoben.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info