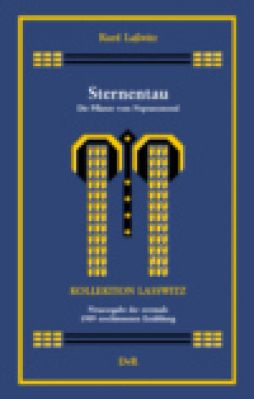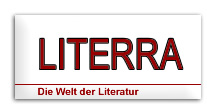
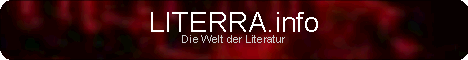
|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science Fiction > Sternentau |
Sternentau
| STERNENTAU
Dieter von Reeken-Verlag |
Mit “Sternentau- Die Pflanze vom Neptunmond” legt Dieter von Reeken als Band 8 seiner Kollektion Laßwitz eine der letzten Arbeiten des Vaters der deutschen Science Fiction ein Jahr vor seinem Tod im Jahr 1910 aufgelegt vor. Der Roman erschien nur einmal 1909 im Verlag B. Elischer Nachfolger. Obwohl er im Vergleich zu Laßwitz bekanntesten klassischen Science Fiction Roman “Auf zwei Planeten” intellektueller und in sich gekehrter wirkt, ist “Sternentau” fast ebenso populär wie das Epos. Laßwitz verbindet die Gedankenwelten Immanuel Kants mit den Theorien Gustav Theodor Fechners über beseelte Pflanzen. In erster Linie schließt sich aber mit “Sternentau” sein literarisches Werk, das er mehr als einundzwanzig Jahre vorher - zumindest nach den Veröffentlichungsdaten, welche nicht unbedingt die Entstehungszeit repräsentieren - mit “Schlangenmoos” begonnen hat. Dieser Roman ist eine von Kurd Laßwitz unter Pseudonym veröffentlichten frühen romantischen Arbeiten. Der Band ist schon in der Kollektion Laßwitz neu veröffentlicht worden. Während in dieser Geschichte die phantastischen Elemente nur latent vorhanden gewesen ist, erweitert Laßwitz die originäre Prämisse der Begegnung zwischen Menschen und “anderen Wesen” im vorliegenden Band. In Zwischenkapiteln geht der Autor näher auf die Pflanze vom Neptunmond ein. Sowohl in “Schlangenmoos” - 1884 das erste Mal erschienen - als auch “Sternentau” scheint es sich zu Beginn um eine Begegnung zwischen Menschen und vage angedeuteten Elfengeistern zu handeln. “Schlangenmoos” beginnt und endet weiterhin mit ominösen Bemerkungen über den Gott der Berge, der wohlwollend zwischen den niederen Kreaturen durch seine von ihm geschaffenen Landschaften wandelt. Wie auch bei den Elfengeistern wirken die Hinweise auf den Gott der Berge eher romantisch verklärt als handlungstechnisch wichtig. In “Sternentau” endet sich nach den ersten, bodenständigen Kapiteln die Perspektive. In einem Vorgriff auf Autoren wie Stapledon bemüht sich Laßwitz auch heute noch unbedingt lesenswert, auch die Perspektive des Fremden, des außerirdischen Wesens in die Handlung zu integrieren. Diese wechselseitige Perspektive gibt dem Roman eine ungewöhnliche Tiefe. Bevor aber näher auf Laßwitz Pflanzenschöpfung eingegangen wird, ist es wichtig, die menschlichen Protagonisten zu charakterisieren. Wie auch in “Schlangenmoos” steht im Mittelpunkt der Handlung eine insbesondere für die Zeit selbstbewusste, aber auch sensibel selbstbewusste Frau. Dieter von Reeken weißt in seinem informativen Vorwort darauf hin, dass die Fabrikantentochter Harda seine entfernte Cousine Hanna Brier ein literarisches Denkmal gesetzt. Laßwitz fühlte für die deutlich jüngere Frau eine tiefe Zuneigung und sie verehrte ihn wohl auch schwärmerisch. Zu Beginn des Romans lernen die Leser Harda kennen, als sie ihren Vater zu einer wichtigen Geschäftsreise verabschiedet. Sie übernimmt zusammen mit ihrer Schwester die gesellschaftlichen Pflichten im Fabrikantenhause, auch wenn der Vater nicht zu Hause ist. Ihre Mutter ist früh verstorben, im Hause wohnt eine Tante, welcher Hardas Vater die Hochzeit versprochen hat. Sie selbst hofft, bald das Haus verlassen zu können, um vor der großen Liebe noch studieren zu können. Sie kennt sich in Botanik sehr gut aus, ist in Bezug auf das Führen des Haushalts mit allen Wassern gewaschen und kann sich auch gegen die Dienstboten gut durchsetzen. Als Charakter betrachtet wirkt sie deutlich reifer als die noch jugendlich romantische Lilly aus Laßwitzs “Schlangenmoos”. Vielleicht ist es auch Absicht, dass Lilly einer Frühform des pflanzengebundenen überirdischen Wesens außerirdischer Herkunft begegnet, während die intellektuell reifere Harda in den Kontakt mit den kompletten Wesen treten könnte. Aber am Ende des Romans wird auch dieser Versuch eines bewussten Zusammenlebens mit den Menschen scheitern. Da “Sternentau” die letzte längere Arbeit Laßwitz ein Jahr vor seinem Tod erschienen gewesen ist, stellt sich zumindest theoretisch die Frage, ob bei einer handlungstechnisch dritten Version dieses Plotthemas der Kontakt zwischen Fremden und Menschen positiv zustande gekommen wäre. Kurd Laßwitz beschreibt nicht nur Hardas persönliche wie intellektuelle Entwicklung im Haushalt ihres Vaters, sondern versucht, auf die Gedankengänge und Zukunftsträume einer jungen, körperlich reifenden Frau einzugehen. So versteht sie sich sehr gut mit dem örtlichen Arzt Dr. Eynitz, beide verbindet eine Leidenschaft für die Botanik. Der Lenz Gradenau aus “Schlangenmoos” ist in diesem Fall eine dreidimensionalere, vor allem sympathischere Figur. Auf der anderen Seite überlegt Harda, eine Ehe mit dem sehr reichen Geschäftspartner ihres Vaters einzugehen und ihre Zukunft eher von der wirtschaftlichen als der emotionalen Seite zu sichern. Im Vergleich zu Lilly fehlt Harda allerdings der jugendliche Schalk. Sowohl die Protagonistin als auch der Autor sind deutlich reifer und damit teilweise in Hinblick auf die grenzenlose Romantik distanzierter agierend geworden. Kurd Lasswitz selbst sieht sich in verschiedenen männlichen Rollen. Zum einen in der Figur des Doktor Eynitz, den er als schüchternen, Pflicht bewussten Junggesellen beschreibt, der aber von seiner Neugierde zur Forschung getrieben wird. Während Herausgeber Dieter von Reeken noch Züge Laßwitz in dem väterlich- weisen Ratgeber Geo Solves sieht, ist das Verhältnis zwischen Harda und ihrem Vater in einigen Szenen fast gleichberechtigt. Obwohl der Fabrikant zu Beginn des Romans auf eine Reise gehen muss, um erstens die Finanzierung seiner weiteren Expansionspläne unter Dach und Fach zu bringen und zweitens nach einem Unfall in seiner Fabrik eine zweite Maschine an Land ziehen muss, wird er im Verlaufe des Romans zu einer vielschichtigen, ungemein modern denkenden Figur. So hat er seine Haushälterin die Ehe versprochen, obwohl er eine Geliebte in einer anderen Stadt hat. Er versteht, dass seine Tochter Harda gerne studieren und später ihre Frau stehen möchte. Andererseits ist es für ihn wichtig, dass sie die Repräsentation seines Haushalts in seiner Abwesenheit koordiniert. Während Lilly in “Schlangenmoos” über weite Strecken des Buches auf ihren Vater verzichten muss, beschreibt im vorliegenden Band das Verhältnis Tochter- Vater ungewöhnlich warmherzig und mit der nachsichtigen Reife des Alters. Auch die Nebenfiguren sind im Vergleich zu seinem Frühwerk deutlich dreidimensionaler charakterisiert worden. Handlungstechnisch verzichtet Laßwitz auf die klassischen Elemente der Volksunterhaltung mit ihren Verwechselungsszenarien, falschen Identitäten und schließlich vorhersehbarem Ende. Unabhängig von diesem Verzicht gehört der Epilog mit seiner absoluten “Ende gut, alles Gut” Mentalität zu den schwächsten Passagen des Buches. Hier hat der Leser das Gefühl, als entwickele sich vor allem Harda einen Schritt zurück und gliedert sich widerspruchslos nachdem sie sich emotional gebunden hat in Hinblick auf ihre Schwester in die gesellschaftliche Norm ein. Mit diesem Rückfall in die klassische Erwartungshaltung der Leser seiner Zeit negiert Laßwitz sehr viele interessante Ideen, aus der Kommunikation zwischen Harda und den Idonen. Sie diente in erster Linie als Kommunikationsbrücke zwischen Pflanze und Mensch. Bis dahin entwicklt sich das Buch sich plottechnisch sehr ruhig. Laßwitz legt viel Wert darauf, seine Figuren und ihre jeweiligen Hintergründe dem Leser nahe bringen. Zwar erfährt der Leser früh von der seltenen Pflanze “Sternentau”, die es nur in einem abgeschlossenen Garten gibt. Dieser Garten ist entweder durch einen schwer begehbaren Pfad zu erreichen oder durch ein Tor, dessen Schlüssel Harda bei sich trägt. Es ist sicherlich kein Zufall, das nur Dr. Eynitz den schweren ersten Weg findet. Nach dem ersten Drittel, welches ausschließlich als Einführung charakterisiert werden kann, beginnt Laßwitz die Perspektive zu verändern. Es beginnt eine zweite Handlungsebene, in welcher Laßwitz zu Beginn märchenhaft, dann immer stärker utopisch phantastisch die fremden Wesen beschreibt. Dabei werden sowohl ihre Entstehung, die eher unfreiwillige Reise zur Erde und schließlich die Kontaktaufnahme auch heute noch einzigartig phantasievoll beschrieben.
Harda und durch ihre Hilfe auch Dr. Eynith begegnen der seltenen Sternentaupflanze und später ihren Ablegern, die sie zuerst Elfen nennen und in ihrem Laboratorium zu Untersuchungszwecken gefangen halten, durch einen Zufall in dem Wald. Wie der Leser erst später erfährt, nehmen die fremden Wesen - Idonen genannt, die Boten einer lichten Welt - mit den umstehenden Bäumen und Pflanzen Kontakt auf. Diese Ebene wird noch märchenhaft und für die Menschheit nicht unbedingt schmeichelhaft. Die Bäume sind noch in sich zerrissen, ob sie die Menschen vor der “Bedrohung” durch die Fremden warnen sollen oder nicht. Am Ende dieser kurzen, eingefügten Kapitel überlassen sie das Schicksal seinem Lauf. Zu der Kommunikation der Pflanzen unter sich gehören die Thesen Gustav Theodor Fechners, der Sternentau mit seinem Idonenboten ist im Grunde eine phantasievolle, aber im vorliegenden Roman sehr fundiert extrapolierte These Fechners. In diversen Einschüben belehrt Laßwitz - wie auch in “Schlangenmoos” - seine Leser über eine Reihe biologischer Fakten bzw. den damaligen Erkenntnissen auf den Gebieten der Chemie, Physik und Astronomie. Dank ihrer suggestiven Beeinflussung können die Idonen fast ihre Kommunikationspartner von deren Seite unbemerkt aussaugen. Für die Idonen stellen die Pflanzen ein gleichberechtigtes Geschlecht gegenüber den Menschen/Tieren dar. Beide Geschlechter verstehen sich nicht. Wie eine Krankheit ist die Seele der Pflanzen und Menschen zerrissen und diese Krankheit muss erst langsam heilen. Das bedeutet, das beide Seiten wieder aufeinander zu gehen müssen. Eine idealisierte, phantastische Vorstellung. Während die Menschen sich inzwischen der technischen Seite zugewandt haben, propagiert Laßwitz durch seine Pflanzen die freie Seele, das natürliche Empfinden. Die außerirdische Kultur basiert ausschließlich auf einer Pflanzenbasis. Alleine das macht die Kommunikation zwischen Mensch und Pflanze schwierig, aber nicht unmöglich. Durch die verschiedenen Handlungsebenen gelingt es dem Autoren sehr überzeugend, eine wirklich fremdartige Kultur zu beschreiben. In diesem Fall ist der Leser als einziger Teilnehmer an dieser Geschichte den menschlichen Charakteren voraus. Während diese noch mit den “Elfen” in ihrem Laboratorium verschiedene Experimente veranstalten und ob der erhaltenen nicht immer aggressionslosen Reaktionen verblüfft sind, weiß der Leser, dass es sich bei den Ikonen um außerirdische Botschafter handelt, hat die Reaktionen der unmittelbar um den Sternentau befindlichen Pflanzen verfolgt und spürt die Gefahr für Harda und ihrem Dr. Eynith. Im Verlaufe des Plots greift Kurd Laßwitz aber nicht auf die Klischees der damals schon populären Invasionsstorys eines H.G. Wells oder teilweise Carl Grunerts zurück, sondern versucht mit den Ideen des Immanuel Kants eine intellektuelle Erziehung von Mensch und Pflanze. Der Autor baut zwei sehr konträre Gedankenmodelle auf, deren Grundlage aber die gegenseitige Achtung - nach einer Reihe von Missverständnissen - und der freie, friedlich orientierte Wille sind. Nur im komplexen, dem Leser zur Verfügung stehenden vollständigen Bild ergänzen sich diese Theorien. Das am Ende die Kommunikation auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner - in diesem Fall einem offenherzigen Menschen - nicht scheitert, spricht für Kurd Laßwitz Optimismus. Den Mittelteil des Romans beherrscht die immer stärker blühende romantische Liebe zwischen Harda und Dr. Eynitz. Die gemeinsame Arbeit haben sie erkennen lassen, dass sie für einander geschaffen sind. Mittels dieser emotionalen Ebene erhalten die Idonen auch den stärksten, prägenden Einblick in das Phänomen Mensch. Kurd Laßwitz beschreibt die Experimente sehr ausführlich und kümmert sich insbesondere im Mittelteil seines Buches weniger um eine tragende Struktur als alternierende Einzelsequenzen, die teilweise etwas zu lang, zu ausführlich formuliert worden sind. Hier fehlt dem Roman ein vorwärts drängendes Element, die beiden Handlungsebenen - Menschen sowie Idonen und Kommunikation der einzelnen Pflanzen untereinander - laufen parallel nebeneinander ab, weigern sich aber, wirklich entscheidend vorwärts zu kommen. Erst gegen Ende des Buches nimmt das Handlungstempo wieder rasant an Fahrt auf. Harda kann ihre emotionalen “Probleme” lösen. Sie entscheidet sich für Dr. Eynitz, den einzigen männlichen Protagonisten, den Kurd Laßwitz dreidimensional und mit sehr viel Herzblut charakterisiert hat. Mit dieser Entscheidung fällt eine Last von ihren schmalen Schultern, die zumindest kurzzeitig noch einmal eine Kommunikation mit den Idonen ermöglicht. Für symbiotisches Zusammenleben sind die Menschen aber intellektuell noch nicht bereit. Darum scheitert diese vom Zufall bestimmte Kontaktaufnahme zwischen Pflanze und Mensch. Diese Metapher lässt sich sehr gut vom Kontext dieses modernen Märchen auf die mehr und mehr im Vorwege des Ersten Weltkriegs zerrüttete europäische Kultur übertragen. Wie andere phantastische Autoren seiner Zeit kritisiert Laßwitz - im vorliegenden Band allerdings in einem sehr bescheidenen und perspektivisch verzerrten Rahmen - seine Mitmenschen und weist darauf hin, dass ihnen noch ein weiter Weg zu einem reinen Wesen bevorsteht. Diesem Weg - ein Bild für den bevorstehenden Krieg, welcher der Industrie unendlichen Reichtum, den einfachen Menschen ungezähltes Leid bringen sollte - stehen sowohl die Idonen als auch die irdischen Pflanzen sehr skeptisch gegenüber.
Auch wenn die Gesellschaftskritik nur impliziert und in ganz kleinen Dosen verabreicht wird, ist sie spürbar. So ist laut den Fremden der Weg, den dieser Planet in seiner Entwicklung eingeschlagen hat, ein unbegreiflicher Umweg zur Einheit der Kultur. Echte Alternativen präsentiert Laßwitz allerdings nicht. Der Einblick in die soziale Gesellschaft der Besucher aus dem All ist so oberflächlich und fremdartig, das eine Annäherung oder gar Übertragung auf menschliche Verhältnisse unmöglich ist. Weiterhin werden die Idonen mit Mitgliedern der deutschen Oberschicht - ein reicher Unternehmer, der zwar um die Existenz seiner Firma kämpfen muss, aber deutlich auf dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Weg in die Elite ist - konfrontiert. Nicht auszudenken, wenn sie Mitgliedern der einfachen Arbeiterklasse begegnet wären. In erster Linie lebt “Sternentau” von dem Zusammentreffen unterschiedlicher Wesen, wie sie insbesondere für die deutsche Phantastik vor dem Ersten Weltkrieg einzigartig sind. Kurd Laßwitzs Geschichte ist trotz einiger Längen und an manchen Stellen einer Reihe von provozierenden, aber in ihrem Kern eher oberflächlichen Thesen eine empfehlenswerte und vor allem ungewöhnliche Lektüre. Die Idee, das außerirdische Leben auf pflanzlicher Basis darzustellen, ist in der Science Fiction immer wieder aufgenommen worden, aber Laßwitz bemüht sich, die außerirdische Zivilisation fremdartig, aber in ihren Ansichten und ihrer Einstellung dem niederen Menschen überlegen und vor allem friedfertig zu beschreiben. Das er dabei auf jegliche typisch bis klischeehafte Spannungskomponenten verzichtet und trotzdem einen fundiert sowie solide bis teilweise inspiriert geschriebenen Roman vorlegt, spricht für Laßwitz schriftstellerische Fähigkeiten. “Sternentau- die Pflanze vom Neptunmond” ist ein zeitloses modernes Märchen, dessen Neuveröffentlichung im Verlag Dieter von Reeken zu den Höhepunkten des Buchjahres 2008 gezählt werden muss.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
April 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info