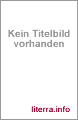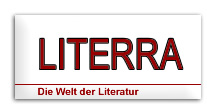
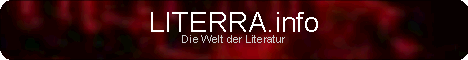
|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Mystery > Das Buch, in dem die Welt verschwand |
Das Buch, in dem die Welt verschwand
| DAS BUCH, IN DEM DIE WELT VERSCHWAND
Buch / Mystery |
Mit „Das Buch, in dem die Welt verschwand“ legt Wolfram Fleischhauer den vierten und letzten Band seiner Spannungstetralogie um die Künste vor. Die einzelnen Romane sind nicht miteinander verbunden. Wer jetzt aber trockene philosophische Ergüsse in Buchform erwartet, wird angenehm überrascht. „Das Buch…“ ist ein handfester historischer Krimi mit phantastischen Ansätzen. Der 1961 in Karlsruhe geborene Fleischhauer studierte nach seinem Abitur in Deutschland, Frankreich, Spanien und schließlich den USA Literatur. Dann kehrte er nach Brüssel zurück und arbeitete viele Jahre als Konferenzdolmetscher bei der EU- Kommission. 1987 während seines Studiums in Frankreich besuchte er den Louve und entdeckte für sich das Gemälde „Gabrielle d`Estrees und eine ihrer Schwestern“. Er begann den Hintergrund des Bildes zu recherchieren und in einer Bibliothek in Brüssel entdeckte er inzwischen in Vergessenheit geratenes Material zu diesem Bild. Aus dieser Faszination entwickelte er seinen ersten historischen Krimi: „Die Pupurlinie“, der 1996 das Licht der Welt erblickte. Es folgte drei Jahre später „Die Frau mit den Regenhänden“. Der Roman basierte er auf einer realen Geschichte. „Drei Minuten mit der Wirklichkeit“ ist eine Synthese aus Mystik des Tangos und seinem sozialpolitischen Umfeld. Liebe und Verrat wechseln sich in der sehr unterhaltsam geschriebenen und spannenden inszenierten Geschichte ab. Mit „Das Buch, in dem die Welt verschwand“ kehrt er in das Krimimilieu seines ersten Romans zurück und verbindet einen rätselhaften Fall mit der oft verbohrten, unaufgeklärten Gesellschaft des achtzehnten Jahrhunderts im Schatten der heraufdämmernden Revolution Frankreichs, sowie der an Alchemie anstelle von wissenschaftlicher Recherche erinnernden, in den Kinderschuhen steckenden Medizin.
Eines Wintertages wird der junge Arzt Nicolai Röschlaub aus Nürnberg in der Schloss des Grafen Alldorf gerufen, weil dieser seit längerer Zeit unpässlich ist und der eigentliche Arzt – sein Arbeitgeber – kein Interesse hat, den weiten Weg durch die kalte Nacht zurückzulegen. Röschlaub kommt der Auftrag nicht unbedingt gelegen, da er insbesondere auf ein unauffälliges Exil in Nürnberg wert legt. Er hatte sich wegen seiner medizinisch modernen Theorien – er sprach von kleinen unsichtbaren Tieren als Krankheitsüberträger – in seiner Heimatstadt Fulda mit dem Fürsten, seinen Hofärzten und schließlich seinem Vater angelegt. Dieser aufklärerische Geist ermöglicht es ihm auch, die geheimnisvollen Vorgänge im Schloss Alldorf aus einer gänzlich anderen Perspektive zu betrachten. Da der Graf die Qualen seiner mysteriösen Krankheit – die vor ihm fast seine ganze Familie ausgerottet hatte – nicht mehr ertragen konnte, hat er anscheinend in seiner abgeschlossenen Bibliothek Selbstmord begangen. Aus dieser Familientragödie wird ein handfester Skandal, als sich herausstellt, dass er ganz bewusst sehr hohe Kredite aufgenommen hat und dafür sein Hab und Gut mehrmals verpfändete. Nach ersten Ermittlungen des Justizrates des Reichkammergerichts zu Wetzlar Ciancarlo Di Tassi ist das Geld einer Geheimorganisation zugeflossen, die einen Schlag gegen den Kaiser geplant hatte. Zusätzlich werden im Reichsgebiet Postkutschen überfallen, die Insassen und Kutscher in die Wälder vertrieben, die Pferde abgespannt und die Kutschen in Brand gesteckt, ohne das wirklich etwas gestohlen wird. Im Laufe seiner Ermittlungen – teilweise zusammen mit Di Tassi, der ihn mit einer Mischung aus Bewunderung wegen seiner gewagten Thesen und tiefsten Misstrauen aufgrund seiner Waghalsigkeit beobachtet – lernt er eine junge Frau, die anscheinend den Grafen Alldorf in Begleitung zweier in schwarz gekleideter Männer mehrmals besucht hat. Als einige Angestellte des Grafen eines bestialischen Todes sterben, fügen sich die einzelnen Puzzleteile langsam zu einer ungeheuren, aber zumindest für den Leser über weite Strecken des Romans überraschenden Lösung zusammen.
Ganz bewusst hat Wolfram Fleischhauer diesen Roman als klassische Krimigeschichte mit einem mysteriösen Touch angelegt. Sehr geschickt und durch seinen eleganten, aber niemals aufdringlichen Stil unterstrichen entwirft er eine detaillierte Welt im Schatten der aufkommenden französischen Revolution. So kann er die inzwischen dank Dan Browns ausufernden Verschwörungstheorien sehr gezielt entwickeln. Es finden sich Hinweise auf Geheimgesellschaften wie die Illuminaten, die Rosenkreuzler und eine Ordensschaft des Schweigens. Bis auf den manchmal hilflosen Nicolai Röschlaub führt jede Person ein doppeltes Spiel. Oft hilft Röschlaub bei seinen Ermittlungen der Zufall, einige wenige Hintergründe der verschiedenen Vorgänge kann er sich wirklich in einer Hommage an Sherlock Holmes deduktiv erarbeiten. Kaum hat er diese Erkenntnisse gewonnen, verliert er sich in einer neuen Ebene der Verschwörung. Um seine Leser weiterhin in die Irre zu führen, fügt Fleischhauer noch eine Maschine zum Sternenstaubsammeln ein. Ein erster Hinweis auf einen phantastischen Hintergrund?
Historisch nutzt er die Abenddämmerung über dem deutschen Reich – in Kleinstaaten und Kleinstaaterei zerfallen mit ihrem maßlosen Konkurrenzkampf -, um eine neue Welt erschaffen zu können. Darum ist der Titel des Romans „Das Buch, in dem die Welt verschwand“ auf der einen Seite metaphorisch zu sehen, aber auf der anderen Seite im Keim nicht nur richtig, sondern folgerichtig. Er braucht aber diesen territorialen Flickenteppich, damit seine Geschichte überhaupt funktionieren kann. Als übergeordneter Erzähler mit einer soliden Mischung aus Information und Unterhaltung konzipiert Fleischhauer eine farbenprächtige Geschichte. Dabei vermittelt er ein überraschend solides, sehr kompaktes Bild vom Stand der politischen Situation, der wissenschaftlichen Entwicklungen und der religiös- fanatischen Thesen. Kaum hat er diese Welt über mehr als vierhundert Seiten hinweg etabliert, versucht er sie auf den letzten vierzig Seiten zu destabilisieren. Er setzt an der Nahtstelle zwischen Absolutismus und Aufklärung an. Die katholische Kirche kann ihre Position nicht mehr gegen die vordringenden Protestanten, aber vor allem gegen die Freidenker halten. Ohne den Plot zu verraten, sucht Fleischhauer die Lösung in der These eines deutschen Philosophen. Mit aller Macht versucht man, sein Werk zu unterdrücken. Aufgeklärte Kräfte versuchen ihn zu schützen. In klassischer Manier setzt sich aber sein Gedankengut durch, verändert die Welt – die Rahmenerzählung spielt knapp zwei Generationen später und Deutschland/ die Welt hat sich nicht nur wegen dieser Thesen, sondern auch der französischen Revolution, Napoleons Eroberungskriegen und der Notwendigkeit, sich gegen diese Bedrohung zu verbünden – und erschafft eine neue. Mit dieser intellektuellen Spielerei könnte Fleischhauer einige Leser auf den letzten Seiten seines Buches verprellen. Im Gegensatz zu den oft unangenehm detaillierten Szenen in der ersten Hälfte beschränkt sich der Autor hier auf vage Andeutungen und interessante Ideenspielereien. Die Puzzlesteine müssen sich in der Phantasie der Leser zusammensetzen und mit ein wenig Schulwissen über deutsche Philosophen wird „Das Buch, in dem die Welt verschwand“ zu einer wirklich interessanten und markanten These. Da sich Fleischhauer als Protagonisten einen ambitionierten, aber oft naiv handelnden Toren – er kombiniert das beste aus beiden Welten, gefährliches Halbwissen und einen Hang, der Obrigkeit unwidersprochen Folge zu leisten – in Nicolai Röschlaub erschaffen hat, kann er nach Herzenslust die Folgen der anstehenden Veränderung an ihm ausprobieren. Dabei ist er weder stur noch begriffsstutzig. Es ist immer wieder überraschend, wie effektiv er auf die veränderten Umstände reagiert. Eine klassische Aktion ist ihm aber weiterhin fremd. Ihm zur Seite stellte Fleischhauer mit Magdalena keine klassische Frauenfigur, sondern eine religiöse Fanatikern und schließlich eine Verfechterin der alten Ordnung. Zu den besten Passagen des Romans gehört ihre These, man kann einen Gedanken aus der Welt schweigen. Insbesondere in der heutigen Zeit immer noch eine beängstigende Vision. Di Tassi als Verfechter der alten Ordnung ist Opportunist. Er muss nicht zuletzt aufgrund seiner Tätigkeit vielen Hüten dienen. Jeglicher Fortschritt gefährdet seine Position. Ihm Grunde kommt dieser ehrgeizige, nicht unbedingt unsympathische Mann aber zu spät. Und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Er kann schließlich nicht mehr mit den Veränderungen mithalten und entschwindet als Randnotiz in der Geschichte. Manchmal ein wenig holzschnittartig charakterisiert, gewöhnt sich der Leser schnell an die einzelnen, sehr individuell gestalteten, aber in ihrer Komplexität und Zielführung deutlich auf die Verkündigung einzelner politischer, kultureller und wissenschaftlicher Standpunkte ausgerichteten Figuren.
Der Leser muss bei der Lektüre dieses Romans akzeptieren, dass gute zwei Drittel des Buches in einem realistischen Stil geschrieben worden sind. Sie zeigen ein sehr authentisches Bild des achtzehnten Jahrhunderts. Die Lösung des Buches ist allerdings gänzlich abstrakt. Eine übersteigerte Fiktion der historischen Realität. Um wirklich gut unterhalten zu sein, muss der Leser diesen augenscheinlichen Bruch akzeptieren. Nur so kann er dem neuen Gedankengut folgen, Fleischhauer übersteigert das Szenario plakativ, aber nicht profan. Dichters Freiheit gibt ihm das Recht zu dieser ungewöhnlichen Interpretation. Mit diesem sehr intellektuellen Schluss bricht er auch mit den Konventionen klassischer Krimis. Es gibt keinen Täter, es gibt nur Opfer, es gibt kein Motiv, es gibt nur eine Idee. Und diese Idee gebiert „Das Buch, in dem die Welt verschwand.“
Wolfram Fleischhauer: "Das Buch, in dem die Welt verschwand"
Roman, Softcover, 492 Seiten
Knaur 2005
ISBN 3-4266-3315-9
http://www.sf-radio.net/buchecke/mystery/isbn3-426...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info