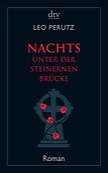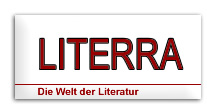
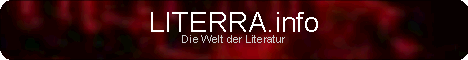
|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Mystery > Nachts unter der steinernen Brücke |
Nachts unter der steinernen Brücke
| NACHTS UNTER DER STEINERNEN BRÜCKE
Leo Perutz DTV |
Mit „Nachts unter der steinernen Brücken“ legt der DTV Verlag im Rahmen seiner kleinen sechsteiligen Reihe mit Klassikern der Phantastik einen Schlüsselroman des jüdisch österreichischen Schriftstellers Leo Perutz wieder auf. Der DTV Verlag hat sich mit zahlreichen Veröffentlichung der phantastischen wie historischen Romane Leo Perutz schon einen positiven Namen erarbeitet. Nicht nur aufgrund der langen Entstehungsgeschichten, beginnend in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Fertigstellung erst knappe 25 Jahre später, ist der vorliegende Episodenroman um die Juden in der Prager Vorstadt ein zeithistorisches literarisches Dokument, sondern viel mehr ein interessanter Einstieg in die europäische jüdische Kultur, die mit den Pogromen und dem Zweiten Weltkrieg buchstäblich ausgelöscht worden ist.
Wie Leo Perutz Biograph Hans- Harald Müller in seinem Nachwort ausführlich beschreibt, begann der Autor seine Arbeit an diesem Fugenroman schon im Jahre 1924. „Meisls Gut“ – ursprünglich auch der Titel des ganzen Buches – erschien in der Literaturzeitschrift „Der neue Merkur“ 1925. Mit dem jüdischen Geldverleiher Meisl und seinen Verbindungen sowohl zum König oder Adel, die sich stil und heimlich entweder Geld liehen oder an seinen Geschäften regelmäßig partizipierten- hat Leo Perutz gleich zu Beginn der Entstehung Geschichte und Klischee miteinander verbunden. Wie viele Figuren in diesem „Schuld und Sühne“ Drama wird Meisl entweder bekehrt oder verliert sich in den Abgründen des Irrsinns. Einen echten Mittelweg scheint es für Perutzs ausgesprochen lebendige Figuren nicht zu geben. Zumindest kann Meisl nach seinem Tod wohlwollend auf die Menschen niederblicken, die ihn zu Reichtum verholfen haben und denen er eine Nase dreht.
Beginnt der Leser mit der Struktur, so ist Leo Perutz Respekt zu zollen. Nicht nur, dass er fünfundzwanzig Jahre mit einer sehr produktiven Phase ausgerechnet im Exil in Palästina während des Zweiten Weltkriegs an dem Werk gearbeitet hat, sondern „Nachts unter der steinernen Brücke“ ist mehr als ein typischer Episodenroman. Wie es sich für eine Fuge gehört, werden die auch zeitlich sehr unterschiedlichen Geschichten in einer Art mystisch provokanten Epilog am Ende in den zeitlich zuletzt entstandenen Kapiteln zusammengefasst. Obwohl sich der Autor scheut, auf alle Fragen entsprechende Antworten zu geben, ist es erstaunlich, wie abgerundet das vorliegende Werk trotzdem wirkt. Um eine weitere Distanz zwischen den Lesern, der Handlungen und der Geschichte aufzubauen, sind viele Texte in Form von verbalen Überlieferungen eines Lehrers an seine Schüler angeordnet, was Perutz auf der einen Seite ermöglicht, eine spürbare moralische Botschaft in die Handlung einzubauen, auf der anderen Seite aber auch mit den logischen Erzählperspektiven zu spielen und relevantes „Wissen“ in wenigen Sätzen zusammenzufassen, ohne das es seine zahlreichen Protagonisten erst eruieren müssen. Diese Vorgehensweise erinnert stellenweise an ein Märchen, wird aber durch die teilweise sehr dunklen Hintergründe der Geschichte negiert.
Zu unterscheiden ist dabei zwischen natürlichen Ereignissen wie der in Prag einfallenden Pest – „Die Pest in der Judenstadt“ – und mystischen Geschichten, in denen entweder der Alchemie folgend nach der Formel zur Entstehung von Gold zu Gunsten des Kaisers geforscht wird oder ein Unglücksrabe im wahrsten Sinne des Wortes durch eine falsche Anwendung einer Zauberformel plötzlich die Hunde sprechen hören kann. Nur sitzt er zusammen mit zwei Straßenkötern in einer Zelle und soll als abschreckendes Beispiel für ein im Gunde nichtiges Verbrechen am nächsten Morgen mit den aufgegriffenen Tieren gehängt werden. „Das Gespräch der Hunde“ symbolisiert Leo Perutz teilweise zynischen Humor, denn ausgerechnet einer der Hunde sucht den armen Kerl, um ihm das Versteckt von ihm zustehenden Goldmünzen zu verraten. In „Des Kaisers Tisch“ greift der Autor auf eine der tschechischen bzw. böhmischen Volkslegenden zurück, die als Ausrede für die zahllosen gescheiterten Volksaufstände in erster Linie gegen die verhassten Österreicher dienen soll. Dabei wirkt das Ende ein wenig konstruiert, da der im Grunde tragische Protagonist nicht direkt an, sondern nur von des Kaisers Tisch speist, aber alleine der getragene, in diesem Fall passend antiquierte Stil macht die Geschichte zu einem der literarischen Höhepunkte der Sammlung, in der sich die melancholische Atmosphäre der an der Moldau gelegenen Stadt mit dem Organisationstalent ihrer Einwohner perfekt mischt.
Durch viele Geschichte beginnend mit „Die Pest in der Judenstadt“ zieht sich die heimliche Liebe des Kaisers zu der schönen wie bürgerlich jüdischen Esther. Rückblickend vielleicht das schwächste Element der Sammlung, da sich Leo Perutz beim einfachen Volk im Allgemeinen und den in der Judenstadt lebenden Juden im Besonderen am wohlsten fühlt. Wenn in „Sarabande“ der Baron Juranic Rache an dem Grafen Collalto nimmt, in dem er ihn bis zu Erschöpfung durch die Straßen des nächtlichen Prags um sein Leben tanzen lässt, wirkt die „Rettung“ durch den erwürdigen Rabbi Loew zu melodramatisch. Das von ihm durch Zauberhand an die Wand gemalte Ecce Homo Zeichen präsentiert nicht Christus, den Heiland, sondern zeigt drastisch das Leiden des jüdischen Volkes über die Jahrhunderte. Darüber hinaus muss Leo Perutz die Abneigung der christlichen Bevölkerung gegen die geschäftstüchtigen Juden beschreiben, der vorherrschende Neid, der schließlich immer wieder in blanken Hass umgeschlagen ist. Diese Beschreibungen haben nichts mit den nationalsozialistischen Exzessen zu tun, sondern basierend auf Perutz eigener Recherche bzw. den Erfahrungen, die er selbst gemacht hat. Auf der anderen Seite beschreibt der Autor aber auch die Abneigung gegen die über ihre Verhältnisse lebenden Christen und die in erster Linie kapitalistisch orientierten Zweckgemeinschaften, die sich im Schmelztiegel Prags ausgebildet haben.
Mit dem Rabbi Loew und seinem eher ambivalenten Machteinfluss verfügt der Roman über eine ausgesprochen charismatische Figur, die wenig überraschend dreidimensionaler beschrieben worden ist als der eher arrogante und vom Sammeln europäischer Kunst zu Lasten der hungernden Bevölkerung besessene Kaiser.
Während die ersten Geschichten beginnend mit der „Pest in der Judenstadt“ und den beiden armen Spaßmachern Koppel-Bär und Jäckele- Narr zumindest noch chronologisiert sind – sie spielt im Jahr 1589 – verschwimmt zumindest im Verlaufe der insgesamt vierzehn am Ende miteinander verbundenen Erzählungen jegliche zeitliche Ordnung. Leo Perutz beginnt immer wilder zwischen den Zeiten hin und her zu springen, wobei sich Mystik und Historie sehr viel mehr vermischen als es anfänglich den Eindruck hat. So ist in der Titelgeschichte „Nachts unter der steinernen Brücke“ bis zum Ende nicht klar, ob die stellvertretend für den Kaiser und Esther zusammengewachsenen Rosen und Rosmarinstöcke wirklich für die sich Liebenden stehen oder ob es sich um einen Traum handelt. Mit dem Astrologen Johannes Keppler fügt Perutz in „Der Stern des Wallenstein“ dem Geschehen eine weitere historische Persönlichkeit hinzu.
Während im Vergleich zu „Der Golem“ die phantastischen Elemente der lesenswerten Geschichten eher auf dem Hören/ Sagen basieren, überzeugt Leo Perutz unglaublich farbenprächtiges Bild der Judenstadt und ihrer nicht immer liebenswerten, aber charakterlich sehr leicht voneinander zu unterscheidenden Bewohner auch mehr als zwei Generation nach der Erstveröffentlichung dieses Buches. Viele der hier in den einzelnen locker über die Charaktere miteinander verbundenen Themen hat Perutz im Laufe seiner langen Karriere als Schriftsteller schon variiert aufgegriffen und zu teilweise ergreifenden Romanen extrapoliert, aber die Konzentration der Ideen garantiert eine unterhaltsame, aber auch nachdenklich stimmende Lektüre. Auch wenn die Episodenstruktur dazu verführt, sollte „Nachts unter der steinernen Brücke“ als Roman verstanden und im Ganzen gelesen werden. Die vielen kleinen unterwegs fast belanglos eingestreuten Details runden das Gesamtbild vielleicht ein wenig konstruiert in der letzten Episode ab. An Leo Perutz aus heutiger Sicht antiquiert wirkenden, aber sehr farbenprächtigen Stil sowie die teilweise leicht gestelzten Dialoge muss sich der Leser gewöhnen, um in diese Zeit eintauchen zu können. Die wenn auch nicht angenehme Reise lohnt sich auf jeden Fall.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info