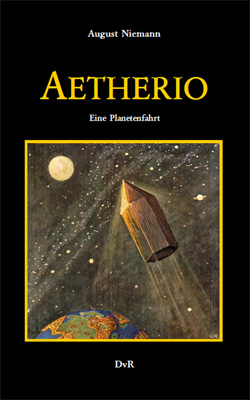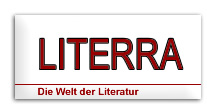
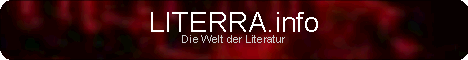
|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science Fiction > Aetherio |
Aetherio
| AETHERIO
August Niemann Dieter von Reeken |
Mit „Aetherio“ - der Stoff, der schließlich das Raumschiff antreibt – aus der Feder August Niemanns legt Dieter-von-Reeken einen weiteren vor dem Ersten Weltkrieg veröffentlichten utopischen Roman vor, der interessanterweise die wissenschaftlichen Romanzen eines Carl Grunerts in Romanform extrapoliert; Jules Verne widerspricht, die für die damalige Zeit modernen Science Fiction Erzählungen Kurd Lasswitz – Niemanns kurzzeitiger Untermieter – oder H.G. Wells ignoriert und insbesondere im ersten Drittel eine kuriose Sehnsucht nach der früheren, weniger hektischen und deswegen liebenswerteren Zeit ausstrahlt. Hinzu kommen eine Reihe von Anspielungen auf die gegenwärtige industrielle Revolution und die Großstadtsucht der preußischen Bevölkerung sowie Hinweise auf die beseelte Natur, die Fechtner und Flammarion vertreten haben.
Der 1839 geborene August Niemann diente lange Jahre als Berufssoldat im Heer Hannovers, bevor er nach seinem Ausscheiden Redakteur des gothaischen Hofkalenders geworden ist. Nach einer kurzen weiteren Einberufung ins Heer lebte Niemann ab 1902 in Dresden, wo er zwei Jahre später mit „Aetherio“ einen seiner beiden eindeutig als utopisch zu klassifizierenden Romane geschrieben hat. Das andere Werk „Der Weltkrieg. Deutsche Träume“ beschreibt den Sieg der unwahrscheinlichen Verbündeten Frankreich, Russland und Deutschland über England, in dem die deutsche Flotte die Herrschaft über die Meere erringt und die Verbündeten England zu Land besiegen. Franz Rottensteiner berichtet in seinem informativen wie ausführlichen Nachwort davon, dass Niemanns Buch nicht unbedingt der reaktionärste und am meisten patriotische Stoff einer Reihe von Siegesphantasien mit England als Hauptfeind ist, aber er zumindest eine Welle mit geprägt und im Ausland feindselige Reaktionen hervorgerufen hat. Wie bei „Mahatma“, einem theosophischen Roman, beginnt „Der Weltkrieg. Deutsche Träume“ in Indien und ist in der Theorie nicht als Alternativweltkriegsgeschichte ursprünglich konzipiert worden. Mit der Prinzessin Fantasia und ihrem märchenhaften Reichtum, die zumindest anfänglich noch auf ihren deutschen adligen Oheim hört, findet sich auch in „Aetherio“ ein Element der fernöstlichen Erzählungen, das nicht zuletzt aufgrund der geistigen Unabhängigkeit der jungen attraktiven Frau aus den Kanon anderer utopischer Texte dieser Epoche heraussticht.
Neben den zwei eindeutigen utopischen Romanen hat Niemann eine Reihe von sehr erfolgreichen Abenteuerromanen sowie militärhistorischen sekundärliterarischen Texten wie „Das Geheimnis der Mumie“ oder „Pieter Maritz, der Buerensohn von Transvaal“ (1885) verfasst. „Das Geheimnis der Mumie“ ist vom Weltbildverlag vor knapp dreißig Jahren das letzte Mal neu aufgelegt worden.
Franz Rottensteiner ist sich nicht sicher, ob August Niemann nicht zuletzt aufgrund seiner Sticheleien gegenüber den ergrauten Professoren und ihren eher weltfremden Theorien auch Kurd Laßwitz und seinen erfolgreichen Roman „Auf zwei Planeten“ – sieben Jahre vor „Aetherio“ entstanden – parodieren wollte. Dafür spricht, dass Kurd Lasswitz sich im Gegensatz zu August Niemann von der beseelten Natur mehr und mehr zurückgezogen hat. Erst in seinem Spätwerk sollte Lasswitz diese Thesen wieder aufgreifen, während Niemann diese Idee in den Mittelpunkt seiner Geschichte rücken möchte, über einige wenige philosophisch theoretische Dialoge nicht hinauskommt. Deutlich spürbar ist, dass Niemann trotz aller exzentrischen pseudowissenschaftlichen Erklärungen auf technische Entwicklungen eines H.G. Wells oder Jules Vernes verzichtet. Nicht umsonst greift er von Verne nur dessen „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ auf. Niemanns Protagonisten wollen anfänglich erst zum Mittelpunkt der Erde reisen und Vernes Thesen widerlegen. In Bezug auf seine unmittelbare Umgebung widerspricht Niemann dem drängen in die Großstädte und setzt sich dank der Erfinder perfektionierter Kunstdünger für eine Zurück-aufs-Land- Bewegung ein. Seine Deutschen werden kraft ihrer Hände und des inzwischen perfektionierten Bodens reich, während die Städte nach und nach entvölkern und die Industrie ein Schattendasein führt. In „Der Weltkrieg – Deutsche Träume“ wirft er diese Thesen wieder um, da nur eine stetige industriell getriebene Rüstung der deutschen Flotte den Vorteil bringt, um England zu schlagen. Darüber hinaus relativiert er – interessanterweise nicht auf seine wichtigste Protagonisten Fantasia bezogen – das moderne Frauenbild und impliziert, dass ausreichend und bezahlte Arbeit auf dem Land den Frauen ihre Graupen aus dem Kopf treibt. Es gibt in Niemanns Zukunft einen Unterschuss an altmodisch erscheinenden Frauen, die einem anderen Jahrhundert entstammen könnten. Die Intellektuellen werden in speziellen Vierteln „isoliert“, wo sie ohne Telefone oder Straßenverkehr in ihren Elfenbeintürmen schaffen können. Die moderne Technik soll sie in ihrer teilweise abgehobenen philosophischen Welt nicht stören. Auch hier trennt Niemann erstaunlich scharf wissenschaftlichen Fortschritt und geistige Entwicklung, die impliziert nur auf dem Niveau eines früheren Jahrhunderts erfolgen kann. Aber Niemann ärgert sich auch über Alltägliches. So rechnet er mit dem Unwillen der Deutschen zu einfachen Dienstleistung ab und lässt in Berlin ein chinesisches Restaurant neben dem anderen entstehen. Sie sind günstiger und die Qualität des Essen besser. Der Exkurs in die Welt der Weine wirkt auch eher selbst belustigend. Moderner Technik wie Luftschiffen steht Niemann angesichts der zahlreichen Verspätungen und Unglücksfälle skeptisch gegenüber. Es ist nicht die einzige Abwendung von der Realität und Hinwendung zur aus seiner Sicht besseren alten Zeit im Text.
Ausgangspunkt seiner Geschichte ist ein interessantes Dreigestirn. Die Prinzessin Fantasia, die laut dem Willen ihres Oheims unbedingt verheiratet werden soll, ist eine modern denkende, der Wissenschaft und dem eigenen Forschungsdrang unabhängig von ihrem märchenhaften Reichtum verbundene Frau. Sie wirkt wie an einem anderen Jahrhundert, im Grunde der Parallelwelt „1001 Nacht“ angehörendes und doch modernes Ideal. Ihr zur Seite steht der ältliche Wissenschaftler Meditor, der schließlich das wundervolle „Raumschiff“ in einer Kammer heimlich entwickelt hat. Meditor steht für die Kraft des Geistes und den Fortschritt. Zwischen Fantasia und Meditor herrscht es ein intellektuell dominiertes Vater- Tochterverhältnis. Der Leibarzt Pratico ist jung, gebildet und unsterblich in die Prinzessin verliebt. Erst die Reise ermöglicht es den beiden unterschiedlichen Ständen angehörenden Menschen, die sozialen Barrieren zu überwinden und aufeinander zuzugehen. Die Wahl der Namen ist wahrscheinlich kein Zufall. Sie verkörpern Phantasie, geistige wissenschaftliche Forschung und schließlich ausführende Hand, wobei Pratico sich diese Aufgabe mit dem bodenständigen italienischen Mechaniker teilen muss, der am Fuße des Vesuv an Bord genommen wird.
Schon Niemanns „Raumschiff“ ist ein Wunderwerk der Phantasie und weniger der Technik. Es ist ein kristallförmiges Gebilde aus Wasserstoffgas, das unter Druck, Wärmeentzug und schließlich Elektrizität verfestigt worden ist. Die einzelnen Kammern des Raumschiffs sind so ausgerichtet, dass sie immer in horizontaler Lage sich befinden. Flüssiger Wasser wie Sauerstoff sind an Bord. Sie dienen als Antrieb und Versorgung. Niemann widerspricht alleine bei der Entwicklung seines Raumschiffs allen Thesen der damals modernen Wissenschaft, so dass eher von einem modernen Märchen als einem ernsthaften utopischen Roman mit „Space Opera“ Charakter gesprochen werden kann. Die erste Fahrt sollte ursprünglich ins Innere der Erde erfolgen. Um die aufgeworfenen Thesen effektiver zu beweisen, entschließt man sich, zum scheibenförmigen Mond zu fliegen, der das ins All gesprengte Atlantis sein soll. Man hofft, dort Spuren dieser untergegangenen Kultur zu finden. Interessanterweise räumt Niemann wissenschaftlich nicht ganz korrekt, aber spannend extrapoliert dem Lagrandepunkt zwischen Mond und Erde sehr viel Raum ein. In „der Luftpirat und sein lenkbares Luftschiff“ wird diese Idee in mehreren Romanen wieder aufgenommen. Der Mond selbst stellt plottechnisch eine Enttäuschung dar. Die Grundideen sind grotesk: er ist eine Scheibe, die nur eine Seite der Erde gegenüber zeigt. Es finden sich Skelette von Walen, die am Abheben von Atlantis mit geschleudert worden sind. Weitere Spuren einer Hochzivilisation findet man nicht, aber zumindest primitives intelligentes Leben, das sich an das Leben auf dem atmosphärelosen Körper gewönnt hat. Es wird nicht das letzte Mal im Verlauf ihrer Reise sein, das sie den darwinschen Artenkampf hautnah mit aller Brutalität erleben werden. Das Raumschiff der vier Abenteurer ist übrigens durch einen Spalt in der Scheibe geflogen, ansonsten wäre es natürlich vom Aufprall vernichtet worden. Es ist schade, dass August Niemann seine exzentrischen Ideen in derartig kompakter und damit zu komprimierter Form präsentiert.
Anstatt zur Erde zurückzukehren, wollen die Vier nach Lösung der Sauerstoffproblematik zum Mars weiterfliegen, dem Planeten, der insbesondere deutsche utopische Autoren – Alfred Daibler, Carl Grunert und natürlich Kurd Lasswitz – am meisten fasziniert hat. Wie sehr Niemann für seine Space Opera wissenschaftliche Grundthesen ignoriert hat, unterstreicht die Tatsache, dass sie durch eine Art roten Nebel fliegen und auf der erdähnlichen Venus statt des Mars landen. Durch eines der gigantischen Meere treibend landen sie schließlich an einem Ufer, wo sie von einem Chinesen (!) begrüßt werden, der nur die alten Sprachen versteht.
Die Venus wird allerdings von eher irdischen Kulturen auf einer primitiveren Kulturstufe mit dominanten Prinzen und natürlich Rassenkämpfen bewohnt. Die Wissenschaft führt wie auf der Erde ein Schattendasein, so dass vieles zu sehr an eine Variation der Flucht vor Fantasia Oheims erinnert.
Insbesondere der Mittelteil „Ätherios“ wirkt wie eine provokante Aneinanderreihung von im Grunde sinnfreien Szenen, mit denen der Autor kontinuierlich die Erwartungshaltung einer wissenschaftlich utopischen Leserschaft torpediert, während der Autor auf der anderen Seite mit seiner umfassenden Literaturkenntnis – die Prinzessin schlicht einen streit zwischen ihren beiden männlichen Verehren mit einer Voltaire- Geschichte – deutlich herausstellt. Lässt sich heutzutage ein Leser auf diese auch auf den zweiten Blick absurd erscheinenden Prämissen ein und akzeptiert, dass Niemann im Grunde eine Geschichte erzählt, die zweihundert Jahre früher entstanden sein könnte, dann verblüffen die kleinen Seitenhiebe in jegliche Richtung mehr als der eigentliche Plot.
Auf dem Mars verhält es sich anders herum. Da der Planet seinen Meerschaum teilweise verloren hat, ist die Atmosphäre stürmisch. Die Kanäle dienen als künstliche Wasserstraßen, mit denen die ungleichmäßigen Niederschläge verteilt werden. Die wie eine Elfe aufgrund der niedrigen Schwerkraft erscheinende zierliche Königin des Mars verliebt sich in Pratico, der sich zwischen der eher platonischen Liebe zu seiner Prinzessin und der Königin des Mars entscheiden muss. Niemanns Bild vom Mars entspricht eher einer Frühform von Burroughs späteren Marsromanen. Niemann zeichnet im Gegensatz zu seinem Mond- bzw. Venusbild das Bild einer alten, streng hierarchischen und friedliebenden Kultur.
Immer wieder wird die Grundidee, das die Planeten des Sonnensystems aus dem Schweiß eines von der Sonne stammenden Kometen gebildet worden sind, wiederholt. Während Merkur als letzte Schöpfung aus wertvollen Metallen besteht und eine glatte Kugel ist, finden sich um den Eiskörper Saturn Feen gleiche Wesen, die an Schöpfungen Flammarions erinnern.
Bei der Rückkehr zur Erde prüfen die Forscher teilweise wider Willen die Theorie, dass das Innere der Äther vom mystischen wie allmächtigen Stoff Äther gebildet wird und zumindest im Inneren einen Hohlraum ausgebildet hat, während zum Beispiel der Mars aus komprimierten Gasen besteht. Das eigentliche Ende dieser Phantasie wirkt etwas überstürzt. Zumindest löst August Niemann auf eine intellektuelle Art und Weise die emotionalen Spannungen zwischen dem eifersüchtigen Pratico und dem im Grunde nur in seine Wissenschaft verliebten Meditor auf, in dem nicht zuletzt dank eines etwas übertrieben erscheinenden Fundes der Weg für eine reine geistige Forschung freigemacht wird. Mit der Prinzessin Fantasia verfügt der Autor über das Idealbild der perfekten Frau – jung und schön, intelligent und entschlossen, im positiven Sinne neugierig -, die sich am Ende gegen die damals vorherrschenden Klischees des Heimchens am Herd wehrt und sich der Wissenschaft verschreibt.
Zusammengefasst ist „Aetherio“ trotz oder gerade wegen der unwissenschaftlichen, aber zumindest überzeugend, sich manchmal aber auch widersprechenden verbalen Exkurse eine kuriose wie unterhaltsame Lektüre, die eher aus dem 18. Jahrhundert denn dem 20. Jahrhundert stammen könnte. Eine melancholische Wehmut anderen, aus Niemanns Sicht besseren Zeiten gegenüber durchzieht den Roman, während die angewandten Wissenschaften manchmal eher wie eine Extrapolation der Alchemie denn zielstrebige Forschung erscheinen. Aus den ernsten technisch utopischen Stoffen dieser Vorkriegsepoche ragt der Roman aufgrund seiner humorvollen Grundhaltung und oberflächlichen Gesellschaftskritik heraus. Stilistisch ohne Frage etwas antiquiert, aber charmant geschrieben unterhält „Aetherio“ nicht zuletzt aufgrund seiner kompakten Erzählstruktur auch heute noch.
Dieter von Reeken hat dem Band ein ausführliches Nachwort Franz Rottensteiners hinzugefügt. Franz Rottensteiner fasst August Niemanns literarisches Werk mit dem Schwerpunkt seiner beiden utopischen Romane sehr gut zusammen und fügt einige Stationen seines in erster Linie beruflich vom Militär geprägten Lebens hinzu. Beim Design des Titelbildes hat sich Dieter von Reeken an der 1909 veröffentlichten Ausgabe der kartonierten Ausgabe orientiert. Auch die weiteren Titelbilder sowie die erste Textseite sind in der gewohnten Qualität nachgedruckt worden.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info