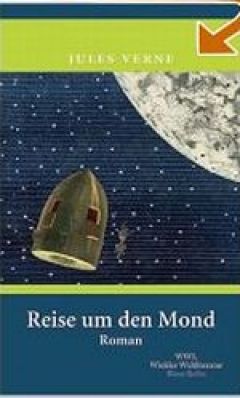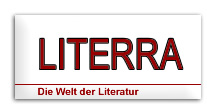
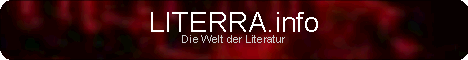
|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Abenteuer > Reise um den Mond |
Reise um den Mond
| REISE UM DEN MOND
Jules Verne Fester Einband, 381 Seiten Mar. 2007, 1. Auflage, 24.90 EUR |
Mit der Fortsetzung zu seinem Roman „Von der Erde zum Mond“ liegt dieser berühmte Doppelroman aus Jules Vernes Feder in einer neuen Übersetzung ungekürzt wieder vor. Im Rahmen seiner blauen Reihe der Winkler Weltliteratur hat Claudia Kalscheuer in Zusammenarbeit mit Volker Dehs aber nicht nur den Text sehr detailgetreu und liebevoll aus dem aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, alle Illustrationen der französischen Originalausgabe sind in den Text integriert worden. Volker Dehs als Verfasser der umfangreichen, im gleichen Verlag erschienenen Jules Verne Biographie kennt seinen Autoren, dessen Werk und vor allem das historische Umfeld. Das sich Verne weniger als utopischer Autor, sondern als Schriftsteller gesehen hat, der in seine menschlichen Geschichten mit unverkennbar satirischen Einschlägen den aktuellen Stand der Technik integriert hat, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Mit „Von der Erde zum Mond“ hat er im Gegensatz zu ihm folgenden Autoren wie H.G. Wells keine neue Technik entwickelt, sondern die Mitglieder des Baltimore Kanonenclubs nutzen eine riesige Kanone, um der Erde zu entfliehen. Nach der Veröffentlichung des Romans hat Verne der amiensische Ingenieur Albert Badoureau für sein nächstes Projekt um die Kanoniere aus den arroganten Staaten – siehe „Kein Durcheinander“ – eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen gemacht, die auf dem neueren Stand der Technik basieren. Diese Vorschläge hat Verne für die Neuauflagen seiner Bücher ignoriert, Volker Dehs hat sie aber zusätzlich zu den so bekannten Fußnoten des Franzosen dem Text ebenfalls hinzugefügt.
IN seinem ausführlichen Nachwort geht Volker Dehs über den vorliegenden Roman hinaus auf Jules Vernes Werk ein. Das dieser die Konstellation einer spektakulären Reise – seine besten Bücher basieren immer auf faszinierenden Reisen, in denen er den Menschen aber gleichzeitig einen Eulenspiegel vors Gesicht hält – mit exzentrischen, aber farbenprächtigen Charakteren verbunden hat, gehört zu seinem literarischen Markenzeichen. In keinem anderem Buch – wobei Buch sich hier zum Teil auf den ersten und zweiten Mond Roman zusammen bezieht – ist allerdings das Diskutieren von mathematischen und physikalischen Problemen so wichtig für das Überleben wie hier. In dem wenige Jahre später folgenden Roman „Kein Durcheinander“ wollen die Mitglieder des Baltimore Kanonenclubs die Erdachse verändern, um an die reichhaltigen Rohstoffe unter dem Ewigen Eis des Nordpols zu kommen, ein Vorhaben, das große Teile der Menschheit von der Erdoberfläche ausgelöscht hat. Bei den dort stattfindenden Diskussion wirkt aufgrund der unfassbaren Idee der Text abstrakter und distanzierter, hier konzentriert sich Verne wie in seinen am Beginn seiner Karriere stehenden Theaterstücken auf eine Handvoll von Charakteren in einem abgeschlossenen Raum im Inneren der Rakete auf dem Weg ins Unbekannte. Die ideale Ausgangsbasis, verschiedene Menschentypen zu untersuchen und ihre Eitelkeiten bloßzustellen. Und so beschränken sich die vielen Dialoge nicht nur auf mathematische Probleme, sondern dringen nicht immer gänzlich ernst gemeint in den Menschen per se ein. Wie Volker Dehs in seinem ausführlichen Nachwort weiter ausführt, sind Jules Vernes Charaktere oft nach einem Katalysator – die Flucht aus dem Gefängnis mit dem Heißluftballon, das Stranden an Bord der Nautilus oder in diesem Fall das Treiben/Fallen/Fliegen zum Erdtrabanten – auf ihren Reisen den kommenden Ereignissen mehr oder minder passiv ausgesetzt. Erst in dem Moment, in welchem sie wieder die Initiative ergreifen oder ergreifen können, durchbrechen sie die fast magische Faszination der Reisen und entziehen sich gleichzeitig. Mit der Flucht von der Nautilus müssen sich die Protagonisten gleichzeitig von dem Wunderwerk der Technik verabschieden. Der einzige wirklich aktive Reiseroman ist Jules Vernes großer Erfolg „In achtzig Tagen um die Welt“. Der Leser hat das Gefühl, als wenn der Autor diese Passivität einer Vielzahl seiner Werke plötzlich und willentlich auf den Kopf stellen wollte, um den Mensch gegenüber der Technik doch obsiegen zu lassen. Schaut man sich seine späteren zum sehr pessimistisch bis nihilistischen Bücher an, handelt es sich eher um einen kurzzeitigen Pyrrhussieg. Im Gegensatz zu einer Reihe von Vernes Vorgängern und Nachfolgern bleibt der Höhepunkt dieser Reise seinen Charakteren verwehrt. Sie landen nicht auf dem Mond, sondern können diesen nur umrunden. Sie begegnen auch keinen Außerirdischen. Dagegen sind auch die satirischen Elemente im Vergleich zu „Von der Erde zum Mond“ deutlich reduziert. Kein Wunder, in dem beengten Raum der Kapsel fehlt dem Autoren – und damit auch seinen Charakteren – der Resonanzkörper. Diese Enge zwingt allerdings Jules Verne auch, sich mehr auf seine liebenswert überzeichneten Figuren zu konzentrieren. Die Dialoge wirken pointierter, das stetige Pieksen mehr freundschaftlich kollegial als boshaft.
Was heute noch mehr überrascht als zur damaligen Zeit sind die Konzeptionsfehler und – schwächen, welche den Protagonisten im Verlaufe des Buches unterlaufen. „Reise um den Mond“ zeigt die ihm ersten Band schon elementaren Planungsfehler deutlich auf. Von der Abschussgeschwindigkeit über die Sichtung des Projektils bis zur Landung bzw. Notwasserung ist das Buch eine Geschichte der menschlichen Irrungen. Sie dienen dabei nicht nur als Spannungskomplexe – ansonsten wäre kein Abenteuerroman entstanden, sondern ein trockener Reisebericht -, sondern entlarven die Halbgötter der Wissenschaft als menschliche Wesen. Da Jules Verne in seinen Büchern auf den Stand der damaligen Forschung angewiesen ist, eine mitunter fragwürdige Danksagung voller Ironie bis hin zum Sarkasmus. Auf der anderen Seite hat Verne in seinen vielen Romanen die abstrakte Forschung dem einfachen Volk vermittelt, die hochtrabenden Ideen auf das Machbare, das Faszinierende reduziert und mit packenden Handlungen verbunden. Es wird sicherlich Forscher in seiner Zeit gegeben haben, die dieser Reduktion ihrer geistigen Arbeit auf profane Unterhaltung widersprochen haben. Diesen setzt Jules Verne mit seinen ironischen Seitenhieben ein unvergessliches und dank der Erfolge der Bücher zeitloses Denkmal. In der folgenden Geschichte um die Kanoniere aus Baltimore – „Kein Durcheinander“ – ist der Fehler inzwischen zu einem elementaren Bestandteil der Romane geworden, der Leser ahnt ihr Scheitern bei der grotesk übertriebenen Aufgabe, die Erdachse zu verändern, alleine weiß er noch nicht, wie sie scheitern werden. Auch wenn die einzelnen Protagonisten nicht immer sonderlich volksnah oder sympathisch charakterisiert worden sind, gibt ihnen Jules Verne impliziert das liebevolle Image des ewigen Verlierers, welcher diese Schwäche hinter seinem pompösen Wesen und einer nicht zu leugnenden Arroganz zu tarnen sucht. Selbst sein aufrichtiger Held – Michael Strogoff, der Kurier des Zaren – wird als blinder Erfüllungsgehilfe charakterisiert, der mit stoischer Besessenheit seinen Auftrag ausführt, unabhängig von der Tatsache, dass er eine schwächelnde Diktatur eine kurze Zeit länger am Leben erhält. In diesem Fall hat Jules Verne allerdings auch keine Alternativen zur Hand, denn die Tartaren sind noch grausamer als die zaristischen Truppen. Aber an Strogoff kann der Leser sehr gut erkennen, dass es für Verne keine klassischen Helden mehr gibt, sondern Abenteurer aus Luft – Philias Fogg – oder Zufall, die dank eines einzigen Moments ihres Lebens aus der Bahn geworfen, eine abenteuerliche außergewöhnliche Reise erleben müssen und manchmal geläutert werden.
Der Höhepunkt – wenn auch nach den Anmerkungen und Hinweisen platziert – ist der
Ausschnittweise Abdruck eines der Verne´schen Theaterstücke, das auf seinen außerordentlichen Reisen basiert. „Die Reise durch das Unmögliche“ aus dem Jahr 1882. Verne hat dieses Stück zusammen mit seinem erfahrenen Kollegen Adolphe d`Enery geschrieben. Das Stück stellt im Grunde eine Zusammenfassung seiner unglaublichen Reisen dar. Im ersten Akt geht es ins Erdinnere, im zweiten Akt in die Tiefsee und natürlich im Letzten zu den Sternen. Im Gegensatz zu einer Reihe seiner sehr interessanten Romane wie „Der Kurier des Zaren“, welcher ebenfalls zuerst für die Bühne geschrieben worden ist, erfolgt hier die Umsetzung für die Bretter, welche die Welt bedeuten, erst nach der Veröffentlichung der originären Stoffe. Die Reise geht allerdings nicht zum Mond, sondern zum Planeten Altor, der ein Spiegelbild unserer Erde in ferner Zukunft sein könnte. Hier kommen die pessimistischen Vorstellungen Jules Vernes aus seinem Roman „Paris im 20. Jahrhundert“ wieder zum Tragen, denn Altor steht trotz materieller Reichtümer vor dem durch den Menschen ausgelösten Untergang. Im Gegensatz zum vorherrschenden Atheismus im Roman selbst bleibt die einzige Hoffnung auf eine glückliche Zukunft in einem starken religiösen Element begründet, das die profane und destruktive Wissenschaft wieder in die Schranken weißt. Wie Volker Dehs in seinem ausführlichen Nachwort schon herausstellt, beginnt dieser dritte Akte als gelungene Parodie auf einige von Jules Vernes markanten Werken, um im Verlaufe der sehr komprimierten Handlung auf das Niveau einer billigen Burleske zurückzufallen. Die pessimistischen Zukunftsaussichten sollten zumindest einer fürs einfache Volk nachvollziehbaren Auflösung zugeführt werden. Unabhängig von diesen Schwächen gibt dieser Nachdruck dem Jules Verne interessierten die Möglichkeiten, den Schriftsteller Verne mit dem Theaterautoren Verne zumindest ansatzweise zu vergleichen. Die Dialoge sind deutlich überzogen und die Botschaften simplifiziert. Was einem jeden Theaterstück durch die Beschränkung des Hintergrunds fehlt sind die exotischen Reisebeschreibungen, die einen auch heute noch elementaren und faszinierenden Bestandteil seiner Bücher ausmachen.
In der gelungenen Neuübersetzung und Neuauflage von Jules Vernes „Reise um den Mond“ lernt der Leser wie auch in den vorangegangenen Bänden der „Winkler Weltliteratur“ Reihe nach ungezählten gekürzten oder bearbeiteten Übersetzungen, einer Reduktion auf eine einfache Jugendgeschichte oder gar eine textliche Entstellung für billige Taschenbuchausgaben Jules Verne so authentisch wie möglich kennen. Volker Dehs hat sich Mühe gegeben, die anfänglich ein wenig gewöhnungsbedürftige - im Vergleich zu bisherigen Fehlinterpretationen - Übersetzung von Claudia Kalscheuer mit guten Kommentaren und Hintergrundinformationen zu begleiten.
http://www.sf-radio.net/buchecke/science_fiction/i...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info