Anonymouth
Über die Stilometrie der nächsten Literatur
Style [...] is identified with fate.
(Guy Davenport)
Im Jahr 2011 versuchte der Journalist Joshua Davis für die amerikanische Zeitschrift The New Yorker herauszufinden, wer sich hinter dem geheimnisvollen Namen Satoshi Nakamoto verbirgt, jenem Programmierergenie, das im Januar 2009 eine neue digitale, sich selbst regulierende Währung namens Bitcoin erfand, ins Netz stellte und sich wenige Zeit später in Luft auflöste. Nakamoto ist ein Phantom. Seine Bitcoin-Idee machte seit ihrer Erfindung Berg- und Talfahrten mit, und es wird vielleicht noch eine Weile dauern, bis sie „hinreichend langweilig“ (Gavin Andresen, Mitarbeiter im Bitcoin-Projekt) und einfach zu nutzen ist, dass sie eine stabile Stufe der Produktivität erreicht; ob sie wirkliche Währungen wie Euro oder Dollar irgendwann ganz ersetzen wird, weiß heute niemand. Im Deep Web bezahlt man praktisch ausschließlich mit ihr, aber das muss noch nichts bedeuten. Mit ihrem Erfinder Satoshi Nakamoto zu sprechen und ihn zumindest ein wenig in die Diskussion einzubinden, wäre mit Sicherheit ein Gewinn, aber mehr als einige Postings „in perfektem Englisch“ (Joshua Davis), die von ihm veröffentlicht wurden und in denen es um Wirtschaftstheorie, Kryptographie und Peer-to-peer-Netzwerke ging, gibt es nicht. Im April 2011 hatte Nakamoto geschrieben, er beschäftige sich nun mit anderen Dingen, und tauchte seitdem nie wieder auf. Seine E-Mail-Adresse und seine Webseite erwiesen sich als „untraceable“.
Stilometrie
Joshua Davis wandte nun bei seinen Recherchen sozusagen das letzte verbleibende Mittel an, um ihn aufzuspüren: Stilometrie. Er las alle Postings durch und achtete auf sprachliche Feinheiten, amerikanische oder britische Schreibweisen usw. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass es sich um einen Briten oder Iren handeln müsse. Bei einer Kryptographie-Konferenz in Santa Barbara, Kalifornien, achtete er auf Übereinstimmungen der Nakamoto-Postings mit dem Stil der Vortragenden, und grenzte die möglichen Kandidaten in dem ziemlich überschaubaren Kryptographieexperten-Universum nach und nach ein. Schließlich fiel sein Verdacht auf einen dreiundzwanzigjährigen irischen Programmierer mit dem sehr passenden, ja beinahe schon DeLillo-esken Namen Michael Clear. Als Davis ihn konfrontierte, bestritt dieser jedoch, Nakamoto zu sein. Aber: „But even if I was I wouldn’t tell you.“
Ein zweiter Identifikationsversuch durch einen Journalistik-Professor der New York University, Adam L. Penenberg, fand einen anderen Verdächtigen, genauer gesagt drei, und auch hier führte Stilometrie (beinahe) bis ans Ziel. „Sehr sauber. Keine Rechtschreibfehler. Seine Sätze sind elegant, aber es gibt keine überzähligen Wörter“, so das Urteil des Experten über den Schreibstil des Bitcoin-Phantoms. Doch auch Penenberg kam, obwohl seine Analyse um einiges tiefer in die Materie ging als die von Davis, nicht hinter die Identität jenes begabten Programmierers, der den Code seiner Software so einzigartig dicht gestaltet hatte, dass selbst der weltberühmte Sicherheitslücken-Finder Dan Kaminsky zugeben musste, noch nie zuvor einen so gegen jeden Eindringling abgesicherten Code gesehen zu haben.
Der unsichtbare Autor
Der in der Literaturtheorie des 20. Jahrhunderts an einigen Stellen postulierte „Tod des Autors“ hatte bislang noch nie so konkrete Formen angenommen. In der rundum anonymisierten Welt der kryptographiebewehrten Aktivisten ist die bisher nur von theoriebegeisterten Menschen verstandene Sage, dass die Rede vom Autor sich überholt habe und die Sprache sich in gewisser Weise selbst schreibe, einfach nachvollziehbare und sehr konkrete Wirklichkeit geworden. Ihre Motivation ist, so wie im Fall von Nakamoto, Unzufriedenheit mit der Art, wie die Welt läuft, und sie finden bisweilen brillante, ja revolutionäre Lösungskonzepte dafür. Wikileaks. Das TOR-Netzwerk. Off-the-Record-Messaging. Aber sie selbst treten nicht immer in Erscheinung. Natürlich sind sie nicht so vollkommen unsichtbar wie Satoshi Nakamoto, aber sie lassen oft einfach die Arbeit für sich sprechen und sich weiterverwandeln, wie die (vermutlich) sehr wenig an ihrem geistigen Eigentum festhaltenden Epiker des europäischen Mittelalters. Bei Demonstrationen tragen ihre zahlreichen Sympathisanten Guy-Fawkes-Masken, die sie zur weltweiten Gemeinde der Anonymen zählen – selbst unter der realen Gefahr, dass ein gewaltbereiter Polizist leichter auf eine im Grunde gesichtslose Figur einschlagen wird als auf ein echtes, mit Mimik versehenes menschliches Antlitz. Immerhin herrscht ein gewisser Gleichstand. Gesichtslose Polizisten mit heruntergeklappten Visieren auf der einen, Guy-Fawkes-Gestalten auf der anderen Seite.
Nicht zurückverfolgbar zu sein, ist zu einer der Tugenden des Schriftführer-Teils dieser bedeutenden Unterströmung der Gesellschaft geworden. Und das ist verständlich, denn sie sind ja auch realer Überwachung ausgesetzt, ihre Reisemöglichkeiten werden eingeschränkt, ihre Paranoia erhält laufend Bestätigung aus der Wirklichkeit. So wurde zum Beispiel der Privatsphären-Aktivist und Programmierer Jacob Appelbaum bei jeder Rückkehr in die USA, obwohl er amerikanischer Staatsbürger ist, über viele Stunden festgehalten und alle seine elektronischen Geräte wurden konfisziert. Es gibt einen Grund, den Urheber bestimmter weltweit lesbarer Meldungen zu verschleiern. Und daher geht jetzt ein Gespenst um – das Gespenst der Stilometrie. Zugegeben, es ist ein ziemlich junges Gespenst, fast existiert es noch ausschließlich in Gesprächen, Gerüchten und Meinungen über die ganze Angelegenheit.
Wer hat diesen Text geschrieben?
Die Formel, auf die sich Stilometrie im Kontext von Überwachung bringen lässt, lautet: Jemand, der Interesse an der Kontrolle von verbreiteter Rhetorik und Information hat, stellt sich die Frage: Wer hat diesen Text geschrieben?
Und an dieser Stelle betritt eine Software die Bühne. ANONYMOUTH. Sie verspricht den Autoren der politischen Untergrundliteratur dieses Zeitalters das, wovor frühere Autoren unter entsetzlichen Identitätsverlustschmerzen zurückgeschreckt wären: vollkommen untraceable zu sein. „We help you to anonymize your writing style.“
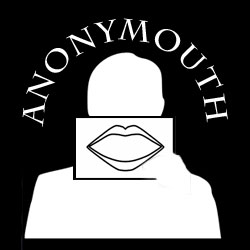
Anonymouth by Stylo
Die Anonymisierung scheint notwendig, denn überall drohen Überwachung, Verfolgung, Identifikation. Namen stehen in Akten, Listen sozialer Kontakte werden angefertigt, lawful interception schiebt sich, ohne dass die Zielperson davon in Kenntnis gesetzt werden muss, unsichtbar zwischen sie und dem Rest des weltweiten Netzes. Und wenn die direkte Identifikation nicht funktioniert, bleibt nur noch die Analyse der anonym hinterlassenen Spur. Schließlich hinterlassen wir alle Hinweise auf uns selbst in Geschriebnem. Manche verlieren sogar, wie die Literaturgeschichte gern beweist, ihr gesamtes Innenleben in Texten. Anonymouth ist genau für solche Fälle erarbeitet worden, von Programmierern der Drexel University in Philadelphia. Das Prinzip, das dem Programm zugrunde liegt, ist “adversarial stylometry” – das Vortäuschen einer völlig anderen stilistischen Identität, um die eigene Privatsphäre zu schützen. „Authorship regognition can be a legitimate threat to privacy and anonymity“, sagen sie.
Das Gespenst der Stilometrie negiert in gewisser Weise den postmodernen „Tod des Autors“. Diese Idee, dass alles nur Palimpsest sei, Sprache schreibe von sich selbst ab, das Interferenzspiel im Gehege der Diskurse, und so weiter – alles Unfug: Du bist du! Ein für alle mal! Als Autor wird einfach jenes Ding definiert, das Angst haben muss, hinter dem Textcorpus erkannt zu werden, weil es eine Spur hinterlassen hat.
Im komplexen Denken des Philosophen Jacques Derrida bezeichnet „trace“, also Spur, eine Simulation von Präsenz von Bedeutung. Die „trace“ gestikuliert in Richtung eines beim Zeitpunkt des Lesens naturgemäß abwesenden Autors mitsamt seiner von ihm angeblich (ein abendländischer Glaubensartikel:) intendierten Bedeutung seiner Schrift. Derrida allerdings argumentiert, dass dieser Verweischarakter eines Textes auf ein irgendwann außerhalb von ihm stattgefundenes Bedeutungs-Ereignis, sozusagen eine Verschwörung der Zeichen zu einer metaphysischen Einheit, tatsächlich niemals in einem Text vorhanden war. Das Konzept der Derrida’schen Spur beschreibt diese ewig-zuspätkommende Suche nach angeblich in den voneinander differenten Zeichen verschütteter Bedeutung. Bullshit!, wird ihm von den Rängen der neuen digitalen Identifikations-Wunderwaffen zugerufen: Bedeutung eines Textes ist einfach das, was später gegen eine bestimmte targeted person verwendet werden wird!
Der Tod des Autors, diese letzte große Fantasie von Anonymität und Unbehelligtsein, scheint verloren, aber immerhin ist der Umkehrschluss mit einem Mal erlaubt: Es ist möglich geworden, sich selbst zum Verschwinden zu bringen, einfach indem man ein Autor wird – das heißt: indem man bewusster schreibt. Indem man auf Stil achtet, zum Beispiel mit der Hilfe von Anonymouth. Denn das Programm entfernt die von ihm als charakteristisch identifizierten stilistischen Merkmale nicht automatisch, das kann es nicht, sondern es präsentiert dem Anwender eine Liste mit Ergebnissen: dies wendest du sehr häufig an; dieses Merkmal fehlt fast in jeder Textprobe; du verwendest Semikola; die durchschnittliche Silbenzahl deiner Wörter und die durchschnittliche Länge deiner Sätze beträgt x und y; du verwendest manchmal englische Fremdwörter; du beginnst auffallend viele Sätze mit einer Konjunktion; du streust gelegentlich Auslassungspunkte ein… Und so weiter. Die künstliche Intelligenz des Programms ersetzt nicht die menschliche Intelligenz, sondern ergänzt sie nur, gibt ihr Tipps.
Wie funktioniert Anonymouth?
Zuerst machten die Entwickler einige Versuchsreihen. Eine bestand etwa darin, dass Freiwillige Texte über ihre Morgenstimmung oder das Tagesgeschehen verfassen und dabei versuchten sollten, in stilistischer Hinsicht möglichst obskur und zweideutig zu klingen. Dann versuchten sie, Cormac McCarthy zu imitieren und Texte in diesem Stil zu schreiben (die Wahl fiel deshalb auf McCarthy, weil er – man höre – einen sehr einprägsamen Stil besitze, der einem sofort wie ein Ohrwurm ins Gehirn gehe…).
Und schließlich wurde etwas versucht, bei dem der Verfasser dieses Aufsatzes hier sich, als er davon hörte, ertappt fühlte: Google-Hin-und-her-Translate. Man nehme einen Text, übersetze ihn ins Portugiesische, von da ins Russische, und dann zurück in die Ausgangssprache. Schon hat man einen völlig stillosen Text. Ertappt fühlte ich mich deshalb, weil ich diese Technik vor einigen Jahren allen Ernstes für meine glorreiche Erfindung hielt. Ich wandte sie auf berühmte deutsche Gedichte an. Hier ein Beispiel:
Johann Wolfgang v. Goethe: Dasselbe
Über alle Spitzen
Wenn Stille,
In allen Spitzen
Wenn Sie sich fühlten
Jeder Rauch;
Vöglein sind im Holz still.
Meteorologische Station nur, balde
Wenn Sie auch still.
An dem „Warte“ des Originalgedichts, das zur „Meteorologischen Station“ wurde, sieht man das grundlegende Problem dieser Technik. Auch an dem etwas altertümlichen Wort „balde“, für das die Software keine Entsprechung fand und das daher völlig unverwandelt – und obendrein noch absolut traceable – blieb. Der bizarre Poesiegewinn dieser Technik ist in bestimmten Fällen enorm, aber die Anonymisierung geht hier, so könnte man argumentieren, eindeutig zu weit und betritt den Nonsens (wir werden auf diesen letzten Punkt allerdings später noch einmal genauer eingehen).
Auch die Imitations-Verschleierung des eigenen Stils durch den abfärbenden Sound von Cormac McCarthy stellte sich als angreifbar heraus. Zwar war sie als Vernebelungsprinzip erfolgreicher als die mechanische Übersetzung, aber bei bestimmten stilometrischen Algorithmen versagt auch sie.
Stellenweise noch ein wenig besser, aber gleichzeitig weniger verlässlich und in der Gesamtheit ebenfalls nicht wirklich nachahmenswert ist die Technik des unstetigen zweideutigen Formulierens, in der Fachsprache Obfuscation genannt, das heißt: man schreibt mal so, mal so, verwendet verschiedene Schreibweisen für dasselbe Wort, ein ständiges stilistisches Hakenschlagen. Aber auch in dieser Technik fanden moderne Stilometrie-Programme bestimmte Punkte, an denen sie ihre Fanghaken einsetzen konnten.
Ist der Verfasser eines Textes also dazu verdammt, seine Identität darin zu konservieren? Wird man irgendwann die Spruchlyrik in der berühmten Anonymous-Botschaft an Scientology und andere Organisationen identifizieren können? Sie erinnern sich, jenes düstere Video auf YouTube mit den wandernden Wolken und der unmenschlich-entschlossenen Stimme des Sprachsynthesizers, das hatte doch Stil – so wie die 1788 anonym veröffentlichten Federalist Papers Stil hatten, so viel Stil, dass ihre Autoren inzwischen durch Computeranalysen relativ eindeutig festgestellt werden konnten…
Der untote Autor
Anonymouth bietet eine Möglichkeit, sich selbst in stilistischer Hinsicht kennen zu lernen, und das auf teilweise fast schon mikroskopischem Niveau. Dinge, die einem nie im Leben aufgefallen wären, stellen sich als Signaturen heraus! Manches erscheint auch regelrecht unheimlich, wie z.B. der trigram part-of-speech tagger – ein Algorithmus, der in einem bestimmten Textcorpus das nächste Wort durch statistische Analysen großer, einem bestimmten Autor zugeschriebener Textmengen vorherzusagen versucht. Der Tod des Autors innerhalb des untoten Autors! Du schreibst von selbst weiter, auch wenn du selbst fehlst! Wir wissen, wie du klingst! Noch einmal, zum Auf-der-Zunge-Zergehenlassen: der Autor-Diskurs schreibt sich selbst, innerhalb seiner selbst, und braucht keinen realen Menschen dahinter. (Sherlock Holmes himself hätte sich vor dieser Software in den Staub geworfen und hätte gerufen: Ich bin unwürdig!)
Die Existenz von Anonymouth suggeriert mir, dass ich ein Dinosaurier bin, ein primitiver Lungenfisch, der mit einem Bein noch im Urzeittümpel steht. Ich will tatsächlich noch für meine stilistischen Merkmale erkannt werden. Das heißt, ich hoffe es. Und ich erfreue mich am Stil anderer, an den trotz ihres vor Jahrhunderten erfolgten Todes immer noch nachfahrbaren Spurrillen ihres Denkens. Heute wird, angesichts der Bedrohung der freien Meinungsäußerung durch Überwachung nicht mehr das Individuum mit seiner Würde hochgehalten, sondern farblose Masse. Nicht mehr Hier sind doch Menschen! sondern: Hier ist Text!
Die abwesende Präsenz des Urhebers ist die neue Signatur der Subversion. Es wird in seine Richtung nur gestikuliert, aber die unendliche Impulskugel-Reihe von spurlosen Signifikanten erreicht ihn nicht mehr.
Und nein, ich beklage ja auch nicht, dass es, ach, nicht mehr so romantisch zugeht wie früher, als die Seele des Autors noch in den stilistischen Schaumkronen eines Textes aufblitzte, aber der Lungenfisch in mir betrauert die Notwendigkeit dieser historischen Entwicklung. Sie lässt vermuten, dass in dem winzigen Bezirk der Literaten, in dem ich mich aufhalte und in dem man sich noch gegenseitig zu seinem Stil gratuliert, möglicherweise nur noch ein kleiner Bruchteil der wirklich wichtigen, eine Veränderung darstellenden Aussagen gemacht werden. Ja, möglicherweise werden die relevanten Dinge dieses Zeitalters bald nur noch anonym gesagt. Und das virale Potenzial des Gesagten ist der einzige Indikator für dessen Langlebigkeit. Doch: anonym gesagt, das heißt auch, in gewisser Weise: von jedem. Denn jeder Mensch, den man auf der Straße vorbeigehen sieht, könnte der Urheber sein – was die Welt wiederum etwas heller und mysteriöser macht – und somit auch die anachronistische Trauer des Lungenfisches ein wenig lindert.
Im Anschluss an eine Präsentation der Anonymouth-Software beim 28. Chaos Communication Congress in Berlin, Ende Dezember 2011, fragte einer der Zuhörer in der Q&A-Phase des Vortrags, was passieren würde, wenn alle Leute nur noch anonymisierte Texte verwenden würden? Bestimmt war diese Frage den Herstellern schon öfter gestellt worden und produzierte deshalb Gelächter. Die Antwort lautete: das komme selbstverständlich auf den Kontext an. Das Szenario, dass alle schriftlichen Äußerungen der Menschen allmählich zu einem anonymisierten, tonlosen Null-Stil zusammenwachsen würden, hielt der Vortragende allerdings für möglich, wenn auch für nicht sehr wahrscheinlich.
Irgendwas Lebendiges, Geiles, Zartes
Daran anschließend könnte man eine kleine situationistische Fantasie spinnen… Die Theoretiker und Praktiker der Situationistischen Internationale entwickelten in den 60er Jahren einige ungewöhnliche Gegenkonzepte zu den Gleichschaltungsphänomenen in der Gesellschaft. Wenn wir schon in einer Stadt, einem Netzwerk aus Verboten und Wänden und Transportwegen wohnen müssen, sagten sie sich, warum sie dann nicht verwandeln in etwas Genießbares? Zum Beispiel in ein Labyrinth, in dem Privatsphäre und öffentliche Plätze nahtlos ineinander übergehen. Die herrlichen körperlichen Jazzimprovisationen heutiger Parkour-Läufer können als Erbe des Situationismus angesehen werden. Und eine mögliche situationistische Belebung des anonymisierten Schreibens wäre nun, jeden Text, in dem es um einen Inhalt geht, wegen dem man Überwachung, Belästigung oder sogar Verfolgung befürchten muss, in… sagen wir: gereimten Alexandrinern zu verfassen. Oder im Stil von Jorge Luis Borges. Oder in dem von James Ellroy. Oder in dem von – was für eine herrliche Vorstellung – Edward Gorey. Oder was auch immer – so lange die formale Vorgabe noch einen erotischen Freudengesang auf die Sprachfähigkeit unserer Spezies zulässt. Irgendwas Lebendiges, Geiles, Zartes. Irgendwas mit Zähnen.
Der schon erwähnte Jacob Appelbaum erzählte bei einem Vortrag vor Occupy-Wall-Street-Aktivisten in New York eine Anekdote über einen Bekannten, der, ähnlich wie er selbst, häufigen vorübergehenden Festnahmen auf Flughäfen ausgesetzt ist. Dieser Mann wurde von den Behörden festgehalten und eingeschüchtert, man fragte ihn alle möglichen Dinge über seine politische Gesinnung und so weiter. Aber er schwieg. Mehrere Stunden lang. Er sagte kein Wort, reagierte auf gar nichts. Nach einiger Zeit bettelten die entnervten Beamten ihn beinahe an: „Können Sie nicht zumindest zugeben, dass wir im selben Raum sind?“ Und als er immer noch nichts sagte: „Ah, fuck this guy!“ Da sie ihn ohnehin irgendwann gehen lassen mussten, ließen sie ihn gehen. Schweigen klingt, in gewisser Weise, immer wie anderes Schweigen. Aber es gibt natürlich auch davon verschiedene Stile. Ein vollkommen anonymisiertes Schweigen wäre in dieser Situation vielleicht fatal gewesen, eine Einladung, noch mehr belästigt und noch mehr eingeschüchtert zu werden. Aber dieses Schweigen… nun, am besten hat es der vor kurzem verstorbene Gore Vidal ausgedruckt, in seiner – möglicherweise – unnachahmlichen Art: „Style is knowing who you are, what you want to say, and not giving a damn.“

Clemens J. Setz – © Paul Schirnhofer
Clemens J. Setz wurde 1982 in Graz geboren. Er studierte Mathematik und Germanistik und lebt als Übersetzer und freier Schriftsteller in Graz. Für seinen Erzählband “Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes” wurde er 2011 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Für seinen neuen Roman “Indigo” ist er für den Deutschen Buchpreis 2012 nominiert.





Großartiger Text. Vielen Dank! Den Umkehrschluss machen ja bereits Seiten wie diese hier, http://blog.oxforddictionaries.com/2011/08/how-shakespearean-are-you/, wo man schauen kann, wie viel Shakespeare in dem eigenen Schreiben steckt. “Shakespeare” ist also nicht mehr die eine Autorfigurfiktion, sondern eine bestimmte Stilistik, etwas Sprachimmanentes, eine bestimmte Geschmacksnote der neutralen Grundsubstanz Sprache.
[...] Website der Veranstaltung stehen einige interessante Texte zum Thema, darunter ein großartiger Essay von Clemens J. Setz, der es hinkriegt, über eine tatsächlich existerende Software – [...]
[...] Clemens Setz über Anonymouth: der Autor-Diskurs schreibt sich selbst, innerhalb seiner selbst, und braucht keinen realen Menschen dahinter….Das Gespenst der Stilometrie negiert in gewisser Weise den postmodernen „Tod des Autors“. Diese Idee, dass alles nur Palimpsest sei, Sprache schreibe von sich selbst ab, das Interferenzspiel im Gehege der Diskurse, und so weiter – alles Unfug: Du bist du! Ein für alle mal! Als Autor wird einfach jenes Ding definiert, das Angst haben muss, hinter dem Textcorpus erkannt zu werden, weil es eine Spur hinterlassen hat.Im komplexen Denken des Philosophen Jacques Derrida bezeichnet „trace“, also Spur, eine Simulation von Präsenz von Bedeutung. Die „trace“ gestikuliert in Richtung eines beim Zeitpunkt des Lesens naturgemäß abwesenden Autors mitsamt seiner von ihm angeblich (ein abendländischer Glaubensartikel:) intendierten Bedeutung seiner Schrift. Derrida allerdings argumentiert, dass dieser Verweischarakter eines Textes auf ein irgendwann außerhalb von ihm stattgefundenes Bedeutungs-Ereignis, sozusagen eine Verschwörung der Zeichen zu einer metaphysischen Einheit, tatsächlich niemals in einem Text vorhanden war. Das Konzept der Derrida’schen Spur beschreibt diese ewig-zuspätkommende Suche nach angeblich in den voneinander differenten Zeichen verschütteter Bedeutung. Bullshit!, wird ihm von den Rängen der neuen digitalen Identifikations-Wunderwaffen zugerufen: Bedeutung eines Textes ist einfach das, was später gegen eine bestimmte targeted person verwendet werden wird!Der Tod des Autors, diese letzte große Fantasie von Anonymität und Unbehelligtsein, scheint verloren, aber immerhin ist der Umkehrschluss mit einem Mal erlaubt: Es ist möglich geworden, sich selbst zum Verschwinden zu bringen, einfach indem man ein Autor wird – das heißt: indem man bewusster schreibt. Indem man auf Stil achtet, zum Beispiel mit der Hilfe von Anonymouth. Denn das Programm entfernt die von ihm als charakteristisch identifizierten stilistischen Merkmale nicht automatisch, das kann es nicht, sondern es präsentiert dem Anwender eine Liste mit Ergebnissen: dies wendest du sehr häufig an; dieses Merkmal fehlt fast in jeder Textprobe; du verwendest Semikola; die durchschnittliche Silbenzahl deiner Wörter und die durchschnittliche Länge deiner Sätze beträgt x und y; du verwendest manchmal englische Fremdwörter; du beginnst auffallend viele Sätze mit einer Konjunktion; du streust gelegentlich Auslassungspunkte ein… Und so weiter. Die künstliche Intelligenz des Programms ersetzt nicht die menschliche Intelligenz, sondern ergänzt sie nur, gibt ihr Tipps. [...]
[...] Litflow: Anonymouth. Über die Stilometrie der nächsten Literatur [...]
[...] kein Text aus INDIGO, dafür aber nicht minder spannend: Clemens J. Setz’ Essay Anonymouth, veröffentlicht auf LitFlow.de, über die »Stilometrie der nächsten Literatur« – absolut [...]
[...] J. Setz: Anoymouth. Posted by Marc at 20:23 Tagged with: Essay, Geschichte, Literatur, Literatur + [...]
Naja, der Tod des Autors, wenn ich mal auf das nicht-literarischen verweisen darf, der ist schon älter. Im Französischen heißt eine AG (Aktiengesellschaft) societé anonyme. Alles, was so eine Deutsche Bank oder sonst eine “juristische Person” den lieben langen Tag treibt oder unterlässt, das kann man nicht mehr , oder kaum noch, an spezifischen Autoren festmachen. Der Vorstand weist auf seine Aktionäre, und diese zu recherchieren, gelingt nur, insofern sie Anteile über 3% halten.