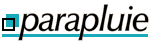
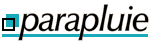 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 25: Übertragungen
|
Zwischen Skylla und CharybdisLiterarische Übersetzung aus dem Koreanischen ins Deutsche |
||
von Birgit Mersmann |
|
Zwischen koreanischem Ausgangstext und deutscher Übertragung liegt ein breites und unberechenbares Gewässer sprachlicher und kultureller Distanz, das der literarische Übersetzer sicher durchschiffen muß. Auf dieser Fährfahrt vermittelt er nicht nur zwischen zwei ganz unterschiedlichen Sprachsystemen und Textstrukturen, er leistet auch kulturelle Vermittlungsarbeit und hilft, die kulturelle Kompetenz der Leser weiter zu entwickeln. |
||||
Der literarische Übersetzer als Fährmann | ||||
Der literarische Übersetzer ist ein Über-Setzer: Er setzt etwas von einem zum anderen Ufer über, und wird für diese Transferleistung entlohnt, wenn auch zumeist ungenügend in Anbetracht der Gefahren, die mit diesem Übersetzen verbunden sind: Er kann vom eingeschlagenen Kurs abtreiben, von den Stromschnellen der fremden und von den Strudeln der eigenen Sprache mitgerissen werden, auf Riff oder auf Grund gehen. Das Gewässer, das zwischen Ausgangs- und Zielpunkt liegt, ist unberechenbar, es kann sich zur Flut aufbäumen, ihn überwältigen, ertränken, oder aber so seicht sein, daß sein Fluß stockt und das Übersetzen zum Aussetzen verurteilt ist. In beiden Situationen verschlägt es dem Übersetzer die Sprache. Ist er ein guter Fähr- und Steuermann, dann kennt er die Tücken des zu überquerenden Gewässers und navigiert sicher zwischen ihnen hindurch. |
||||
Als Fährmann ist der Übersetzer immer auch Hermes und Charon in einer Person: In der Figur des Charon sorgt er dafür, daß die Seele ans jenseitige Ufer gelangt, um weiterzuleben. Überführt werden jedoch nur die Seelen der Toten, nicht die der Unbestatteten. Um reinkarnieren zu können, müssen sie ihre Hülle, d.h. ihren materiellen Körper vollständig abgelegt haben. Anders gesprochen: Wenn der Übersetzer die Seele, die aus dem zu übersetzenden Text spricht, ans andere Ufer, nämlich in den übersetzten, anderssprachigen Text hinüberretten will, muß sie vom Sprachkörper, seiner Materialstruktur, völlig losgelöst sein. Nur dann wird ein lebendiges Fortleben des Textes am anderen Ufer garantiert sein. |
||||
Als Leiter ins Jenseits ist der Übersetzter aber auch Hermes: geflügelter Botschafter und Zwischenhändler. Er soll für den reibungslosen Transitverkehr, die zuverlässige Auslieferung des Versandten diesseits und jenseits der Grenze sorgen. In dieser Funktion kann er jedoch unfreiwillig oder willentlich leicht zum Schleuser, Schlepper und Schmuggler werden, aber auch als Spion und Geheimagent mißbraucht werden. Gerade weil der Übersetzer ein erfahrener Grenzgänger ist, agiert er nicht nur als Fluchthelfer und Retter, sondern auch als Verräter. Im Französischen spielt die häufig hervorgehobene begriffliche Nähe zwischen traduction (Übersetzung) und trahision (Verrat) auf diese Verschiebungs- und Entgleisungsgefahr an. |
||||
|
||||
Es ist ein Charakteristikum der literarischen Übersetzung aus dem Koreanischen ins Deutsche, daß in der Regel zwei Fährmänner dafür sorgen, daß der Ausgangstext wohlbehalten ans gegenüberliegende Ufer gelangt. Koreanische Germanisten arbeiten mit deutschsprachigen Germanisten oder Autoren zusammen, um den schwer beladenen Fährkahn sicher zum Ziel zu navigieren. Dieser Übersetzerzusammenschluß ist nicht in erster Linie der Tatsache geschuldet, daß das Deutsche und Koreanische gefährlich weit auseinander liegen und daß die schwierige Überfahrt überhaupt nur mit vereinten Kräften zu leisten ist. Er ist schlichtweg aus eben der Not geboren, daß es (bisher noch) zu wenige qualifizierte deutsche Übersetzer für das Koreanische, insbesondere für die koreanische Literatur, gibt. |
||||
Was sich zunächst als nachteiliges Defizit darstellt, muß jedoch in der Praxis keines sein. So lassen sich dem Gespann aus Erstübersetzer und Überarbeiter auch positive Seiten zum Wohle der Übersetzung abgewinnen. Gerade weil der Zweitüberträger nicht direkt am koreanischen Original, sondern bereits an einer übersetzten Textfassung arbeitet, sind sein Kopf und seine Zunge von der schweren Last der Fremdsprache, dem Zwang zur Sprachkonvertierung befreit. Der Denkraum seiner eigenen Sprache wird nicht direkt tangiert und affiziert, weshalb er sich sprachlich ungebundener -- und damit auch künstlerisch freier -- entfalten kann, was natürlich der Poetik des literarischen Textes, seinem schriftstellerischen Anspruch zugute kommt. Indem also eine personale Aufgabenteilung stattfindet, steigen in gewisser Hinsicht die Chancen, die "Seele" des Textes ans andere Ufer hinüber zu retten. Weil der Zweitüberträger vom linguistischen Interferenzdruck befreit ist, kann er leichter in die Rolle des verlängerten "zweiten" Autors schlüpfen und den Text fortschreiben, ohne an den Folgen des Bruchs zu leiden, den das direkte Übersetzen notwendigerweise markiert. Umgekehrt ist der literarische Erstübersetzer von dem Druck befreit, neben sprachlichen zugleich auktoriale Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Er kann es sich erlauben, wörtlich zu übersetzen, einen unausgefeilten Rohtext zu liefern, und nur dann, wenn er wörtlich übersetzt, wenn er den Originaltext nicht bereits auf eine höhere sprachliche Ebene transponiert, kann der Zweitüberträger diesen so nah und unverfälscht wie möglich in seine Sprache "übersetzen". Indem sich der Erst- als Direktübersetzer so wörtlich, d.h. semantisch und syntagmatisch genau wie möglich an das Original hält, entsteht ein translingualer, quasi pidginsprachlicher Text, in dem der Widerstand des Koreanischen gegen seine Einverleibung ins Deutsche noch spürbar ist. Die Aufgabe des Zweitüberträgers besteht anschließend darin, das vorliegende Textrohmaterial zu bearbeiten, es umzuschreiben, umzustellen, neu zu verbinden, ihm Ton und Rhythmus zu geben, es wenn notwendig auch zu schneiden -- niemals aber künstlich zu glätten. Er übernimmt damit weniger die Aufgabe eines Nachdichters, als vielmehr die eines Postproduzenten. |
||||
1. Hauptfracht: Kulturwissen | ||||
Trotz prägender westlicher Einflüsse ist die koreanische Kultur eine stark hermetische Kultur. Die Literatur, die sie hervorgebracht hat, setzt daher ein enormes Hintergrundwissen über die koreanische Kultur und Geschichte voraus, das ein westlicher, hier: deutscher Leser nicht besitzen kann. Eine Übertragung koreanischer Literatur ins Deutsche muß diesen Aspekt mitreflektieren, ansonsten wird sie eine Minoritätenliteratur für eingeweihte Koreainteressierte bleiben. Das bedeutet, daß die Übersetzungsarbeit immer auch kulturelle Vermittlungsarbeit einschließen muß. Wie sich diese gestaltet, kann nur für den Einzelfall beantwortet werden. So existieren sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Hintergrundwissen als Zusatzwissen in die Übersetzung einzubauen. Dies kann in Form von Anmerkungen, textinternen Erklärungseinschüben oder einem Glossar geschehen. Entscheidend ist, daß die Erklärungen und Kommentierungen so unauffällig wie möglich vorgenommen werden, daß sie den Lesefluß, die Satzmelodie und den Ereignisablauf nicht unterbrechen, geschweige denn torpedieren. |
||||
Ein paar Beispiele aus meiner Übertragungserfahrung. Beginnen wir mit der Welt des Essens und Trinkens, die das Sozialleben der Koreaner so ungemein prägt. Kimchi ist inzwischen wohl weltweit so bekannt, daß es keiner Erklärung mehr bedarf. Mit Kimbab, Bulgogi und Bibimbab sieht dies aber schon völlig anders aus, ganz zu schweigen davon, daß sich ein deutscher Leser unter Naengmyon, Mandu und Maeuntang oder unter Makkoli und Soju wohl kaum etwas Konkretes vorstellen könnte. Wenn der Übersetzer Glück hat, liefert der Autor gleich die entsprechende Erklärung mit, so geschehen in Jo Kyung-Rans Erzählung Mein purpurnes Sofa. Dort heißt es: "Der Stand, zu dem ich oft ging, bot als Hauptmenü Kimbab an. Sie kennen doch die mit Algenblättern und Rührei umwickelten Reisröllchen, die fliegende Händlerinnen auf Bahnhöfen und am Eingang von Parkanlagen verkaufen. In eine erhitzte Pfanne wird Rührei gegossen. Darauf legt man die algenumwickelten Klebreisrollen und wickelt dann das Ganze noch einmal." |
||||
Gibt der Autor keine Erklärung, was natürlich eher die Regel ist, kann der Übersetzer eine solche in den Text einschleusen oder eine Fußnote bzw. Anmerkung einfügen. Dabei sollte er jedoch nicht auf die Nennung des Eigennamens verzichten. Man kann, darf und sollte vom deutschen Leser ein Interesse an der koreanischen Kultur erwarten und die Bereitschaft, das Fremde beim Namen zu nennen, es in der Fremdsprache bezeichnen zu können. Die Übernahme von koreanischen Eigennamen ins Deutsche bietet die Möglichkeit, (inter)kulturelle Kompetenz weiter zu entwickeln, eine Fähigkeit, die in einer globalisierten Welt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sake ist inzwischen in der deutschen Sprache ein feststehender Begriff, warum sollten nicht auch Soju und Makkoli in Zukunft im Deutschen zum festen Wortinventar zählen? Eindeutschungen von koreanischen Eigennamen, die zu Neologismen wie "Reisbier" führen, oder aber die Verwendung von Begriffen, die im Deutschen vergleichbare Produkte bezeichnen, sind höchst zweifelhaft, um nicht zu sagen mißverständlich und irreführend. So stellt auch die Eindeutschung der Reihenfolge von Vor- und Familienname ein falsches Zugeständnis an die Kultur der Zielsprache dar. Warum sollte ein deutscher Leser nicht mit der Tatsache konfrontiert werden, daß im Koreanischen immer erst der Familienname und dann der Vorname genannt wird? Ein eigenes Kapitel wäre da noch die Bedeutung der Namen. Diese kann unter Umständen für das Verständnis entscheidend sein. Ähnlich schwierig wie Eigennamen gestalten sich gewisse Verwandtschaftsbezeichnungen und Höflichkeitsformen im Koreanischen; auch sie können im Grunde nicht ins Deutsche übertragen werden, da es für sie dort keine analogen Bezeichnungen gibt. Zwar existieren natürlich auch in Deutschland "ältere Schwestern" und "jüngere Brüder", jedoch würde niemand auf die Idee verfallen, seinen/ihren älteren Bruder im Gespräch mit "Älterer Bruder" anzusprechen. Deutscht der Übersetzer koreanische Verwandtschaftsbezeichnungen wie oni (ältere Schwester) ein, so macht er sich leicht eines altmodischen Stils oder aber eines Karl Mayschen indianischen Umgangstons verdächtig. Das Gleiche gilt für das Höflichkeitssuffix yang, denn das gute alte Fräulein wurde inzwischen aus emanzipatorischen Gründen aus dem modernen deutschen Wortschatz getilgt. Solche unzeitgemäßen, beim deutschen Leser auf Unbehagen stoßenden Rückfälle kann der Übersetzer meiden, indem er, wie bereits vorgeschlagen, entweder die koreanischen Bezeichnungen übernimmt und diese in einem Glossar erläutert, oder aber eine deutsche Variante wählt, die keine Eindeutschung des Begriffs, wohl aber eine situationsbezogene Einbettung in den deutschen Anrede- und Höflichkeitsdiskurs vornimmt. |
||||
Ein ganz eigener hermetischer Bereich ist die Metaphorizität einer Sprachkultur. Da sie in der Lyrik ihre höchste Steigerung und Verdichtung erfährt, gilt die Übersetzung von Gedichten gemeinhin als höchste übersetzerische Leistung. Viele Sprachbilder entziehen sich einer direkten Übersetzung, sie verlangen die Findung neuer oder vergleichbarer Sprachbilder in der Zielsprache. Betrachten wir einen Beispielfall aus Yi Chong-Juns Erzählung Die Gerüchtemauer. Daß ein Mann, der zu tief ins Glas geschaut hat, "nach einer überreifen Kakifeige riecht", dieser bildhafte oder vielmehr olfaktorische Vergleich ist vermutlich auch für einen deutschen Leser noch verständlich, obwohl er im Grunde Kenntnisse über das Land voraussetzt. Heikel wird es im Bereich der Symbolik von Tieren und Pflanzen, die im Koreanischen und Deutschen oft sehr unterschiedlichen Assoziationen wecken. Ganz besonders schwer zu übertragen sind aber jene Metaphern, die sich allein aus der Kenntnis der koreanischen Kulturtradition heraus erschließen lassen. Das Tröstliche für einen Lyriküberträger ist, daß Gedichte immer auch neue Bilder prägen, daß sie das Unvorstellbare als Vorstellung neu erfinden. Der Überträger hat daher die Freiheit der Entscheidung, er kann die Direktübersetzung wählen, um den Reiz der fremden Bildprägung zu wahren, er kann aber genauso gut ein neues Bild, eine neue Konfiguration wagen, ohne notgedrungen den Autor verraten und den Leser vor den Kopf stoßen zu müssen. |
||||
2. Hauptfracht: Sprachstrukturwissen | ||||
1. Unterfracht: Das Sprachsystem | ||||
Nicht nur das Text- und Bildverstehen, sondern auch das koreanische Sprachverständnis setzt ein nicht zu unterschätzendes Kontextwissen voraus. Im Gegensatz zum Deutschen ist das Koreanische ein hochgradig offenes Sprachsystem, das einerseits auf ein unausgesprochenes, kollektiv tradiertes Vorwissen baut, andererseits nicht alles im Detail sprachlich determiniert. Es gibt sozusagen Leerstellen, die je nach Kontext korrelativ vom Rezipienten gefüllt werden. Dies ist kein Manko, sondern spricht für die Flexibilität der Sprache und die Freiheit des Umgangs mit ihr. Stellvertretend für die stete Opposition zwischen Indeterminiertheit und Determiniertheit, mit welcher der Übersetzer, der aus dem Koreanischen ins Deutsche übersetzt, auf mikro- wie makrosprachlicher Ebene konfrontiert ist, möche ich einige wichtige Sprachdifferenzen nennen, die zu Konflikten führen können. |
||||
Während in indoeuropäischen Sprachen wie dem Deutschen durch den Gebrauch des sogenannten bestimmten und unbestimmten Artikels die Opposition von determinierter und indeterminierter Bedeutung des Substantivs gekennzeichnet wird, fehlt im Koreanischen ein formal vergleichbares Ausdrucksmittel. Die koreanische Sprache zählt zu den artikellosen Sprachen; die Funktion der deutschen Artikel wird gegebenenfalls von Demonstrativpronomen oder Zahlwörtern übernommen. Auch die Unterscheidung zwischen Singular und Plural ist im Koreanischen keine näher differenzierte. Oft fällt die Pluralendung sogar weg. Im Gegensatz zum Deutschen, das mehrere Pluralmarkierungen kennt, gibt es im Koreanischen lediglich eine einfache Pluralform, die mit dem Suffix tul für Mehrzahl gebildet wird. Erschwerend kommt hinzu, daß man im Koreanischen sich und andere nur ungern mit den Singularformen (ich/er/sie/es) als Individuum bezeichnet, da man sich über kollektive Zugehörigkeit definiert. Im Deutschen hingegen ist die personale Identität eine unhintergehbare Größe. Dies zeigt sich u.a. auch daran, daß es immer eine explizite Subjektmarkierung geben muß. Im Deutschen kann kein grammatikalisch korrekter und logisch schlüssiger Satz ohne ausdrückliche Nennung des Subjekts gebildet werden. Im Koreanischen hingegen ist dies möglich, es kennt die Subjektellipse. Wenn aus dem Kontext klar hervorgeht, auf welche Person sich der Satz bezieht, kann das Subjekt weggelassen werden -- was in der Sprachpraxis, insbesondere in der mündlichen, häufig der Fall ist. In der Berücksichtigung von kontextuellen Referenzen liegt aber auch ein Grund, warum das Koreanische auf den Gebrauch von Personalpronomina weitgehend verzichtet. An die Stelle derjenigen lexikalischen Elemente, die den deutschen Personalpronomen entsprechen, rückt im Koreanischen in der Regel ein Null-Morphem. Was als bekannt vorausgesetzt wird, braucht nicht noch einmal genannt zu werden. Wenn aber die gemeinsame Ausgangs- und Referenzbasis einem Perspektivwechsel unterzogen wird, wenn dem Bekannten neue, unbekannte Aspekte hinzugefügt werden sollen, dann muß das Bekannte in seiner bekannten Form wieder aufgenommen werden; die Möglichkeit einer Substitution durch verschiedene Pronomina wie im Deutschen (z.B. durch Personal-, Demonstrativ-, Relativ-, Indefinitpronomina etc.), die dazu dient, Wiederholungen zu vermeiden, besteht im Koreanischen nicht. Das bedeutet, daß Rekurrenzformen in koreanischen Texten eine wichtige Rolle spielen. So notwendig sie für Referenz und Kohärenz im Koreanischen sind, so redundant sind sie, wenn sie eins zu eins ins Deutsche übertragen werden, denn das Deutsche scheut die explizite Wiederaufnahme, die in der Referenzidentität bzw. Koreferenz, d.h. Bezeichnungsgleichheit bestimmter sprachlicher Ausdrücke in aufeinanderfolgenden Sätzen besteht. Für den Übersetzer folgt daraus, daß er die koreanischen Koreferenzen, so weit dies möglich ist, im Deutschen durch Substitutionsformen ersetzen sollte. |
||||
2. Unterfracht: Die sprachlich gesteuerte Textstruktur | ||||
Die Wiederholungsstrukturen, die der koreanischen Sprache inhärent sind, wirken sich auch auf die Gesamtstruktur des Textes aus. Als deutscher Leser begegnet man in der koreanischen Literatur häufig Rekurrenzen und Wiederholungsschleifen. Eine koreanische Kollegin, die Dolmetscherin für Deutsch und Koreanisch ist, hat im Gespräch mit mir einmal die These aufgestellt, dies rühre daher, daß ein Großteil der koreanischen Belletristik als Fortsetzungsgeschichten in Printmedien und Literaturzeitschriften entstanden sei. Dieses schriftstellerische Format, das für viele Autoren eine der wichtigsten Einnahmequellen darstelle, erzwinge quasi die Struktur der expliziten Wiederaufnahme. So verlockend die These auch klingen mag, sie bedenkt nicht, daß auch in Europa, und hier vor allem im 18. und 19. Jahrhundert, ganze Romane zunächst als Fortsetzungsgeschichten abgedruckt wurden, bevor sie dann als Gesamtwerk veröffentlicht wurden, und daß sie trotz dieser Publikationsform nicht maßgeblich von internen Rekurrenzen geprägt sind, sondern von inneren wie äußeren Progressionen, von der linearen Weiterentwicklung des Geschehens. Meines Erachtens gibt es im Koreanischen eine zirkuläre Sprach-, Argumentations- und Denkbewegung, die dem linearen, vorwärts treibenden Duktus des Deutschen entgegensteht. Natürlich können Wiederholungen auch ein bewußt eingesetztes Stilmittel sein, siehe die iterativen, der Rhythmisierung dienenden und das Um-sich-selbst-Kreisen versinnbildlichenden Strukturen im Werk von Thomas Bernhard. Jedoch müssen sie als solche kenntlich sein, sonst setzt die Rekurrenz den Autor (und den Übersetzer) dem Vorwurf aus, in schlechtem Stil zu schreiben oder aber an beschränktem Ausdrucksvermögen zu leiden. Für einen Übersetzer ist es selbstverständlich nicht einfach zu entscheiden, wo die Wiederholung überflüssig und wo sie ein gewünschtes, willkommenes Stilmittel ist. Hierzu bedarf es eines feinen Sprachgefühls und eines umfassenden Literaturverständnisses. Wo jedoch die Wiederholung weder stilistisch, noch rhythmisch, noch inhaltlich motiviert erscheint, da sollte sie gestrichen werden, sonst läuft sie Gefahr, den Leser zu langweilen. Von Übersetzungskommissionen wird eine solche Tat nur in seltenen Fällen goutiert werden, denn sie setzt sich dem Vorwurf aus, ein Stück des Originaltextes, dessen Wort heilig und daher unauslöschbar ist, einfach unter den Tisch zu kehren. Verlust kann jedoch Gewinn für die andere Seite bedeuten. Geringfügige Verzichte auf das Original können solange geduldet werden, wie sie der Übersetzung nützen! Der deutsche Übersetzungstext kann von der Streichung bzw. Raffung enorm profitieren, ein Gewinn, der auch auf die Bewertung des Ausgangstextes und das Ansehen des Schriftstellers zurückschlägt. |
||||
3. Unterfracht: Sprechweise und Darstellungsform | ||||
Daß sich das zyklische koreanische Denken besonders schwer mit deutscher Geradlinigkeit vereinbaren läßt, davon kann die literarische Übersetzung ein Lied singen. Die Unvereinbarkeit schließt immer auch die Differenz zwischen Direktheit und Indirektheit ein. Der einflußreiche französische Sinologe und Philosoph François Jullien, der in Paris lehrt, hat die chinesische Poesie einmal als eine "Ideologie des Indirekten" charakterisiert. Der chinesische Poet bzw. Literat verstehe sich auf die Kunst des Umwegs, er vermittle seine Meinungen mit Hilfe von Andeutungen, spreche "durch die Blume". Wiederholt betont Jullien den allusiven Charakter der chinesischen Literatur, die zu verstehen gibt, aber zu sagen vermeidet, die impliziert und dadurch vom Leser ein Lesen zwischen den Zeilen verlangt. Ähnliches gilt für die koreanische Literatur: Sie umkreist das zu Sagende, ohne es direkt auszudrücken, sie kalkuliert Umwege ein, vollzieht Warte- und Wiederholungsschleifen, sie setzt bewußt Distanz ein, um diskret vorzudringen. Tendenziell haftet ihr dadurch der Charakter des Monologisierens an. Es ist müßig, eine Diskussion darüber zu entfachen, worin dieser Hang zur Indirektheit begründet liegt und was man sich von einer impliziten und allusiven Zugangsweise verspricht. Vielleicht verbirgt sich dahinter die Vorstellung, daß die Welt kein Objekt der Repräsentation ist und deshalb auch nicht direkt abgebildet werden kann. Jedenfalls führt kein Weg am Indirekten vorbei, was wiederum dem Übersetzer großes Kopfzerbrechen bereitet, denn das Deutsche verlangt eine Direktheit im Ausdruck und in der Argumentation, die schwerlich dazu geeignet ist, Indirektheit wiederzugeben. Hier haben wir es also nicht nur mit einem sprachlichen, sondern auch mit einem kulturellen Konflikt zu tun. |
||||
Die Übersetzung von Lee Cheong-Juns Erzählung Die Gerüchtemauer ins Deutsche stellt in dieser Hinsicht eine ganz besondere Herausforderung dar. Der deutsche Text ist zum Besten überspannt vom inneren Monologisieren des personalen Erzählers, von seinen vielsagenden Andeutungen. Das Konjunktivische des Erahnens und Mutmaßens ist allgegenwärtig, die indirekte Rede, die zum Teil nur noch zur Beantwortung von rhetorisch gestellten Fragen bzw. zur Darstellung von Selbstgesprächen dient, dominiert. Markiert wird sie häufig durch einen Gedankenstrich am Anfang des Satzes anstelle von Anführungszeichen. Direkte Gespräche werden permanent durch innere Reflexionen unterbrochen. Ein deutscher Leser wird sich mit dieser allusiven Indirektheit nicht leicht tun. Auch wenn er an modernen westlichen Literaturformen des inneren Monologs und der indirekten Rede geschult ist, besteht die Gefahr, daß er sich in der Grenzenlosigkeit des Andeutungshaften, Vermeintlichen und Übermittelten verliert. Er kann sich aber auch auf das Spiel mit den Andeutungen einlassen, der Indirektheit seinen Reiz abgewinnen. Wenn der Übersetzer es schafft, den Leser dorthin zu bringen, dann hat er die schwierige Fährfahrt zwischen Literatur- und Kulturübersetzung erfolgreich gemeistert. |
||||
|
autoreninfo

Birgit Mersmann ist seit 2005 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) "Bildkritik. Macht und Bedeutung der Bilder" an der Universität Basel. 2002-2004 Postdoc-Stipendiatin des Graduiertenkollegs "Bild-Körper-Medium. Eine anthropologische Perspektive" an der HfG Karlsruhe. 1998-2002 DAAD-Lektorin am Department of German Language & Literature an der Seoul National University in Südkorea. Forschungsschwerpunkte: Literatur- und Kunsttheorie, Visualität und Narration, Hypertextualität, visuelle Kultur, Postkolonialismus, Bildwissenschaft, moderne und zeitgenössische westliche und asiatische Kunst, Inter- und Transkulturalität, Übersetzung.
Veröffentlichungen:
Das Bild als Spur. Transgressionen und Animationen, in: Hans Belting (Hg.): Bildfragen. Die Bildwissenschaften im Aufbruch, München 2007 -- dies./Martin Schulz (Hg.): Kulturen des Bildes, München 2006 -- Ikonoskripturen. Mediale Symbiosen zwischen Bild und Schrift in Roland Barthes' L'empire des signes, in: Silke Horstkotte/Karin Leonhard (Hg.): Sehen ist wie Lesen, Köln/Weimar 2006 -- Bild-Fortpflanzungen. Multiplikationen und Modulationen als iterative Kulturpraktiken in Ostasien, in: Gisela Fehrmann/Erika Linz/Eckhard Schumacher/Brigitte Weingart (Hg.): OriginalKopie. Praktiken des Sekundären, Köln 2004.
|
||||
|
|