Literatur als geschichtliche Erkenntnisquelle
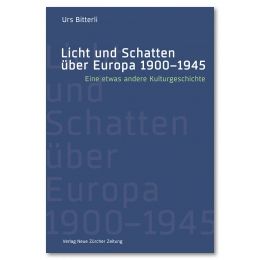
Dieses Buch ist eine Fundgrube für den literaturhistorisch interessierten Zeitgenossen und eine politische Bildungserfahrung erster Güte. Der Historiker Urs Bitterli, manchen Lesern bekannt auch als Autor einer profunden Biografie über Golo Mann, hat in den vergangenen Jahren im „Journal 21“ in seiner Rubrik „Alte Bücher – neu besprochen“ insgesamt fünfzig Romane und literarische Zeugnisse aus dem Umfeld der europäischen Geschichte während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts analysiert. Der Verlag der „Neuen Zürcher Zeitung“ hat diese Betrachtungen nun in Buchform herausgebracht. Jedes der thematisch und chronologisch gegliederten Kapitel wird eingeleitet durch einen erhellenden Essay des Autors.
Hilfreich zur Vergegenwärtigung von Vergangenem
Bitterli argumentiert in der Einleitung überzeugend, dass die von ihm ausgewählten Texte auch als „Quellen der Geschichte“ wahrzunehmen sind, die dem Historiker über eine „bestimmte Zeitperiode Auskunft geben“ und „bei der Vergegenwärtigung von Vergangenem behilflich sein können“. Ausserdem interessierten ihn die verschiedenen Bezüge zwischen den vorgestellten Werken, die es ermöglichten, „einen historischen Tatbestand klarer zu erkennen“. Natürlich, erläutert der Autor weiter, machten solche literarischen Zeugnisse „immer nur einen kleinen Teil des schriftlichen Materials“ aus, das es für den Historiker brauche, „um der geschichtlichen Wahrheit möglichst nahezukommen“.
Im Übrigen weiss jeder erfahrene Journalist, dass gut gesetzte literarische Zitate zu den Qualitätsmerkmalen und Leckerbissen eines anspruchsvollen Textes zählen – allein schon deshalb, weil Literatur, vor allem wenn sie sich über einen längeren Zeitraum hinweg bewährt hat, nun einmal einen höheren Stellenwert geniesst als die meist kurzlebige journalistische Produktion.
„Radetzkymarsch“ und „Schweizerspiegel“ zum Beispiel
Als markante Beispiele literarischer Werke, die eine Gesellschaftsstimmung aus einer bestimmten Perspektive besonders einprägsam widerspiegeln, nennt Bitterli etwa Joseph Roths „Radetzkymarsch“, der in der Endzeit der Donaumonarchie handelt. Oder Meinrad Inglins „Schweizerspiegel“, der gesellschaftspolitische Verhältnisse und zum Teil höchst konfliktive Denkweisen im helvetischen Kleinstaat während des Ersten Weltkrieges vor Augen führt.
Zu letzterem Werk erfährt der Leser, dass Inglin sich für seinen Roman auch von Tolstois „Krieg und Frieden“ inspirieren liess. Dabei habe er sich für sein helvetisches Panorama in der Zeit des Ersten Weltkrieges klugerweise für ein wesentlich kleineres Format entschieden als Tolstoi für sein russisches Monumentalgemälde. So sei, meint Bitterli, Meinrad Inglin „ein kleines Meisterwerk“ gelungen, „dessen Bedeutung für die Schweizer Geistesgeschichte derjenigen von Tolstois „Krieg und Frieden für die russische Sicht nicht nachsteht“.
„Untergang des Abendlandes“ – kein neues Thema
Im Kapitel „Kulturpessimismus“ wird man als heutiger Leser daran erinnert, dass düstere Zeitstimmungen und deprimierende Prognosen auch im vergangenen Jahrhundert von namhaften Autoren verbreitet wurden und ein starkes Echo fanden. Das gilt etwa für Oswald Spenglers „Der Untergang des Abendlandes“, das in den 1920er Jahren erschien. Verfasst hatte er es in den Jahren des Ersten Weltkrieges. Bitterli weist darauf hin, dass Thomas Mann in seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“, bei denen er sich selbstquälerisch auf einem deutschnationalen, antiwestlichen Irrweg verstieg, Spenglers Werk lobend zitierte. Erst später, als er sich zur Weimarer Republik bekannte, wendete er sich von ihm ab.
Aufschlussreich ist auch die Besprechung von „Der Aufstand der Massen“ des spanischen Intellektuellen Ortega y Gasset, das heute nahezu vergessen ist. Doch meint Bitterli mit Grund, dass dieses Thema auch für die Gegenwart durchaus aktuell geblieben ist. Er unterstreicht dies mit einem eindringlichen Zitat des grossen Historikers Jacob Burckhardt, der schon 1845 an seinen liberalen Freund Gottfried Kinkel geschrieben hatte: „Das Wort Freiheit klingt schön und rund, aber nur der sollte darüber mitreden, der die Sklaverei unter der Brüllmasse, Volk genannt, mit Augen angesehen und in bürgerlichen Unruhen duldend und zuschauend mitgelebt hat… Ich weiss zuviel, um von diesem Massendespotismus etwas anderes zu erwarten als künftige Gewaltherrschaft.“
Das Volk als „Brüllmasse“ und „Brave New World“
Wer denkt bei solchen Sätzen nicht an die spätere Machtübernahme der nationalsozialistischen „Brüllmasse“ in Deutschland? Und wen beschleichen bei diesen skeptischen Überlegungen zum Thema „Volk“, das nach Ansicht gewisser Ideologen immer recht hat, nicht unheimliche Gefühle beim Gedanken an die krude Rhetorik eines „Volkstribuns“ wie Donald Trump?
Auch Bitterlis Neubesprechung von Aldous Huxleys „Brave New World“, erschienen 1932, bietet anregenden Stoff zum Nachdenken über hochaktuelle Fragen der Gentechnik, des sogenannten Genetic engineering. Huxley verpflanzte seine pessimistische Utopie in das 7. Jahrhundert nach der Geburt des Automobilherstellers Henry Ford, also in das Jahr 2600 nach Christus. Er beschreibt ein „Brut- und Normierungscenter“ in London, in dem nach einem komplexen gentechnischen Verfahren Säuglinge ausgebrütet werden, die „genau auf ihre künftige Rolle in einer arbeitsteiligen, nach Kasten gegliederten Gemeinschaft vorprogrammiert sind“. Heute ist jedem Zeitgenossen bewusst, dass biologische Züchtungsmöglichkeiten solcher oder ähnlicher Art schon in der Gegenwart zu greifbaren Optionen geworden sind.
Hesses „Steppenwolf“ und die Hippie-Bewegung
Dem Kapitel über die „zerrissenen Jahre“ nach dem Ersten Weltkrieg hat Bitterli eine Rezension von Hermann Hesses „Steppenwolf“ zugeordnet. Hesse war bereits fünfzig Jahre alt und Schweizer Bürger, als dieses Werk erschien. Es ist, wie Bitterli festhält, „Ausdruck einer tiefen Lebenskrise“. Die Hauptfigur, Harry Haller, leidet an seiner Zeit und er leidet an sich selbst. Er fühlt sich als gesellschaftlicher Aussenseiter und ihn quält die scheinbar einseitig rational definierte Welt der Moderne.
Man erfährt aus Bitterlis Rezension weiter, dass Hesse 1942 – also mitten im Zweiten Weltkrieg – ein Nachwort zum „Steppenwolf“ verfasste, in dem er dessen Krise als Katharsis darstellte, die schliesslich zur „Heilung“ führe. Hesse wurde in den 1960er Jahren unerwartet zu einem Vordenker und sein „Steppenwolf“ zu einem Kultbuch der Hippie-Bewegung in den USA und weit darüber hinaus. Sie rebellierte gegen das Establishment, gegen den fragwürdigen Kriegseinsatz in Vietnam und gegen unglaubwürdig gewordene gesellschaftliche Moralansprüche.
Max Frischs Tagebücher als geschichtliche Quelle
Viele weitere Werke wären zu nennen, die Urs Bitterli in seinem Buch neu bespricht und in flüssigem Stil in erhellende historische oder literarische Zusammenhänge einordnet. Manche dieser Titel sind halb vergessen oder der Leser kann sich nur schwach an deren Lektüre in jüngeren Jahren erinnern. Erwähnt seien hier George Orwells „Hommage zu Catalonia“, ein scharfsinniger Erlebnisbericht aus dem Spanischen Bürgerkrieg, „The Seven Pillars of Wisdom“ von T.E. Lawrence (der britischen Hauptfigur im Klassikerfilm „Lawrence of Arabia“), „Leben und Schicksal“, dem vielleicht aufwühlendsten Roman über den Zweiten Weltkrieg des russisch-jüdischen Autors Wassilij Grossman oder der Essay über den grossen holländischen Historiker Johan Huizinga und dessen Klassiker „Herbst des Mittelalters“ sowie dessen kulturkritische Schrift „Im Schatten von morgen“.
Hervorgehoben sei zum Schluss Bitterlis Analyse von Max Frischs „Tagebuch 1946-1949“, das er ebenfalls als wichtige geschichtliche Quelle wertet. Es zeige, „wie ein junger Mann, Bürger der kriegsverschonten Schweiz, die Realität des vom Krieg betroffenen Nachbarlandes Deutschland nach 1945 wahrgenommen und reflektiert hat“. Der Autor untermauert seine Besprechung mit verschiedenen inhaltlich und stilistisch packenden Zitaten aus Frischs erstem literarischem Tagebuch. Mit diesem Werk sei Frisch „zum politischen Schriftsteller geworden, der er bis zu seinem Tod war“. Bitterli fügt hinzu, dass er als Historiker die Meinung jener Kenner teilt, die Frischs Tagebücher von 1946-1949 und von 1966 -1971 „zu den bedeutendsten Werken deutscher Literatur im 20. Jahrhundert zählen“.
Die Besprechung weckt Lust, sich wieder einmal – oder vielleicht zum ersten Mal – in das Originalwerk zu vertiefen. Aber das gilt für fast alle Titel, die Bitterli für seine „etwas andere Kulturgeschichte“ neu gelesen und kommentiert hat.
Urs Bitterli: Licht und Schatten über Europa 1900-1945. Eine etwas andere Kulturgeschichte. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2016, 350 Seiten



