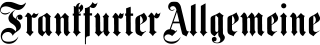Dieser Roman aus Belgien ist ein Buch zum Staunen. Es führt uns tief in den Alltag des Ersten Weltkriegs hinein, und dies so eindrucksvoll, als habe der Autor Erwin Mortier jene Zeit selbst erlebt. Aber er kam erst Jahrzehnte später zur Welt, nämlich 1965. Die Kriegsgeschichten wiederum werden aus der Vita einer weiblichen Hauptperson entwickelt, und zwar mit einem derartigen Einfühlungsvermögen, dass man sich verblüfft fragt, wie ein männlicher Erzähler dazu kommt. Haben wir es vielleicht mit einem ausgebildeten Psychologen zu tun? Offenbar nicht, denn die Hinweise im Klappentext des Verlages ordnen ihm die Qualifikationen Kunsthistoriker, Schriftsteller und Journalist zu. Da bleibt uns nichts als die beglückende Einsicht, dass manche Literaten sich ebenso intensiv wie erfolgreich um die Anforderungen zu kümmern wissen, die ihr Stoff und dessen Hintergründe an sie stellen.
Wacher Geist
Die Romanheldin, die von sich und von jenem ersten europäischen Wahnsinn des zwanzigsten Jahrhunderts berichtet, heißt Helena und ist teils flämischer, teils französischer Abstammung, hat also alles Wesentliche zu bieten, was eine Belgierin ausmacht. Wenn wir ihr zum ersten Mal begegnen, hat sie schon neunzig Lebensjahre hinter sich und ist bettlägerig, denn ihr Körper gehorcht ihr nicht mehr. Ihr Geist aber durchaus, wie man den Aufzeichnungen entnehmen kann, die sie einer Fülle von Schreibheften anvertraut. Es ist nicht immer genau zu unterscheiden, ob ihre Mitteilungen im gegebenen Moment aus dem Text dieser Hefte kommen oder Teil der Gespräche sind, die sie mit ihrer marokkanischen Pflegerin Rachida führt. Doch das stört überhaupt nicht. Was die alte Dame auch äußert und in welchem Zusammenhang sie es jeweils tut, stets antwortet sie auf Fragen, die nicht nur ihr Leben aufgeworfen hat, sondern auch das unsrige. Denn wo in Europas Ländern gibt es Menschen, deren Dasein nicht irgendwie beeinflusst wurde von dem Stück Weltgeschichte, das für Helena einst Gegenwart war?
Dabei ist die Hauptfigur alles andere als eine Oberlehrerin. Sie denkt sich zurück in ihre Vergangenheit, um jene Zeit und alles, was daraus erwuchs, besser verstehen zu können. Ein Ziel, das sie nur unvollkommen erreicht. Das an ihrer Stelle auch wir vermutlich weitgehend verfehlen würden. Dennoch lohnt der Gewinn, den Helena erzielt, die Mühen der superlangen Lebensbeichte: Von Seite zu Seite kommt sie sich näher und endet im Einverständnis mit sich und dem, was sie tat oder was ihr zugefügt wurde. Wenn sie uns adieu sagt – und das wird, wie jedem einleuchten muss, ein endgültiger Abschied sein –, dann hat sie ihr Ich, ihr Dasein und dessen besondere Umstände akzeptiert. Kann es einen größeren Sieg geben nach all den Kämpfen eines Menschenlebens?
Im Korsett der Zeit
Uns aber, ihrem Publikum, hinterlässt sie Geschichten, die wir mit Anteilnahme und wachsender Einfühlung lesen. Wir begegnen zunächst einem jungen Mädchen, hübsch und gescheit, aber eingeengt von den Anforderungen einer Gesellschaft, die jedem seinen Platz zuweist und keinem erlaubt, sich über die herrschenden Sitten und Meinungen hinwegzusetzen. Das gilt auch für die übrige Familie: Helenas Mutter, die nicht nur körperlich eingeschnürt ist vom Korsett der damaligen Damenmode; den Vater, der die Seinen zwar liebt, seine männlichen Vorrechte aber nie auf Frau und Tochter übertragen würde; einen Bruder, der sich am Vater orientieren darf, es aber nicht so recht schafft, weil er seine Homosexualität vor jedermann verbergen muss.