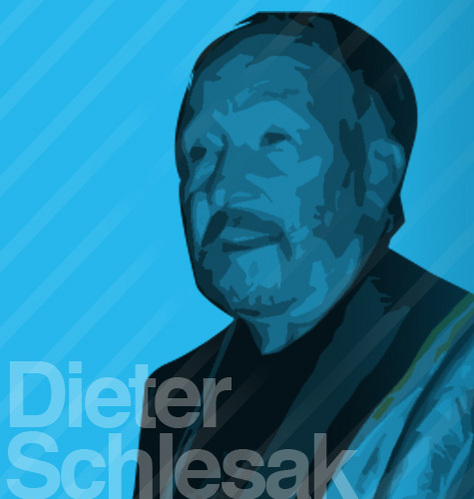Gewählter Autor: Dieter Schlesak
Dieter Schlesak
Bibliographie
2010
Der Tod ist nicht bei Trost
»Hier ist, um mit Musil zu reden, nicht nur eine neue Seele da, sondern auch der dazugehörige Stil. Das vitale Sprach- und Erfahrungsmaterial ist in großräumige Rhythmen übersetzt, die in der Ferne die Zentnerschwere einer lyrischen Tradition von Gryphius bis Günther und Klopstock ahnen lassen, bei denen die Form gerade noch die alles sprengende Erfahrung fasst... Man moechte auf die formale und sprachliche Kunstleistung hinweisen, auf die Vielfalt der Themen – und könnte doch nur sagen: Ecce Poeta. Viele dieser Gedichte lassen den Leser nicht los, sie greifen seine Erfahrung, sein Bewusstsein an.« Walter Hinderer, Frankfurter Allgemeine Zeitung
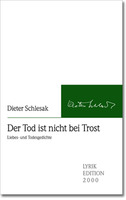
2009
Ich liebe, also bin ich
22 Gedichte

2007
VLAD. Die Draculakorrektur
Roman

2006
Capesius, der Auschwitzapotheker
Viktor Capesius war Apotheker in Schäßburg und Vertreter der Firma Bayer, bevor er als SS-Offizier nach Auschwitz kam. Als eines Tages ein Transport mit Juden aus seiner siebenbürgischen Heimat eintraf, standen sich plötzlich Täter und Opfer, seit Jahren bekannt, an der Rampe des Lagers gegenüber. Capesius schickte sie kaltblütig ins Gas und bereicherte sich an ihrer Habe. Dieter Schlesak schrieb diese wahre Geschichte auf als komplexe Kollage aus Dokumentation, Rückblende und Erzählung: ein historisches Werk, das sich literarischer Mittel bedient, von enormer sprachlicher Kraft und Authentizität, ein erschütterndes zeitgeschichtliches Zeugnis.
Seit 30 Jahren ist Dieter Schlesak dem Auschwitzapotheker auf der Spur. Vom Täter und seinen Opfern sammelte er Dokumente, Interviews, Briefe und Aufzeichnungen. Damit kreiste er den SS-Offizier Capesius wie in einem Prozess ein und ließ die Menschen in ihren Worten schildern, was mit ihnen, ihren Angehörigen und Kindern geschah. Wohl einmalig in der Auschwitzliteratur ist die persönliche Begegnung zwischen Opfern und Tätern aus der gleichen Stadt, dem gutbürgerlichen Massenmörder und seinen früheren Bekannten, Nachbarn, Kunden. Der Erzähler im Buch ist der jüdische Häftling Adam. Er ist die einzige fiktionale Figur. Doch was er berichtet und wie er es berichtet, entstammt bis in die Sprache der Opfer, die »Lagerszpracha« hinein den historischen Quellen. 1965, im Auschwitzprozess, wurde Capesius zu 9 Jahren Haft verurteilt. Nach Verbüßung seiner Strafe lebte er bis zu seinem Tod unbehelligt und ohne jedes Gefühl von Reue in Göppingen.

2006
Herbst Zeit Lose.
»Jeder Versuch einer Zuordnung scheitert als Ettikettenschwindel, ist ebenso irreführend wie die Versuchung, das große barocke Thema Tod und Eros auf den Ausschnitt einer ›poesia erotica‹ zu begrenzen«, schreibt Wolf Peter Schnetz im Magazin »lichtung« über diese Liebesgedichte. »Beides ist bei Schlesak gegenwärtig: Höchste Lust und Todesnähe, schmerzliches Entzücken in Liebeshass und Todeslust, wenn Tod, Liebe, Leben, Licht und Schatten zur ›unio mystica‹ verschmelzen.«

2006
Settanta volte sette. Grenzen Los. Oltre limite.
Gedichte, Edizioni ETSISBN 88-467-1455-5
2002
Der Verweser
Der Erzähler, Alter ego des Autors, hat auf einer Reise nach Italien ein seltsames Déjà-vu-Erlebnis: Er meint ein Haus »wiederzuerkennen«, als hätte er hier schon einmal gelebt. In diesem Haus, so erfährt er später, hatte im 16. Jahrhundert der Arzt, Magier und Schriftsteller Nicolao Granucci gelebt. In der Stadtbibliothek findet er die hochdramatische Biografie und die Schriften Granuccis, entdeckt auch die Biografie von Granuccis Geliebter Lucrezia Malpiglio. Nach Lucrezias erzwungener Einheirat in die reiche Familie Buonvisi geschehen rätselhafte Morde – die grausame Renaissance-Frau und der als Komplize verdächtigte Granucci werden zum Tod verurteilt. Durch Flucht in ein Kloster entzieht sich Lucrezia der Strafe, wird aber später als Hexe gerichtet. Nicolao Granucci kann fliehen, hetzt vor seinen Verfolgern durch ganz Europa und kehrt nach zwanzig Jahren aus seiner letzten Exilstation Transsylvanien wieder nach Lucca zurück. Er wird gefoltert und in Viareggio in der klobigen Torre Matilda eingemauert, wo er vierzehn Jahre lebendig begraben zwischen Leben und Tod dahinvegetiert.

2002
LOS. Reisegedichte
LOS. Reisegedichte. Nach dem Verlassen des festen Bodens tun sich im Exil Abgründe auf, doch die Fremde wird eine Chance im Verlust, ein Weg zu neuen Erkenntnissen in vielen Ländern und Landschaften Europas und Amerikas; eine besondere Art von Reisegedichten ist hier entstanden: Mit geschärftem Blick öffnet das verletzliche lyrische Ich diese zu inneren Ereignissen gewordenen Landschaften neu auch für den Leser. »Die vorgefassten Denkweisen haben immer Sehen verhindert und Leben geraubt. Der Fassungs-Lose versucht, ohne Vorbehalt zu sehen, den Wahrnehmungsprozess als gelernten zu entlarven. Jungsein heißt nach Nietzsche: noch Chaos in sich haben. Freisein heißt: sich dem Augenblick hingeben können (…) Vertrauen in die Kräfte, die uns tragen, Kräfte, die größer sind als wir.« Hermann Kurzke, FAZ

2000
Lippe Lust. Poesia erotica
Dieter Schlesaks Grundthema ist die Erfahrung der Grenze – und zwar in jedem Bereich menschlicher Existenz. »Lippe Lust« ist hocherotische, oft riskante Grenzüberschreitung: Nachtvögellust, Ekstase als uraltes und immer neues Lebens- und Erkenntniselixier entflammter Körper und Seelen; schmerzhafte Liebe, Ironie und Enttäuschung; Trennung, aber auch Reife und Wachstum durch Liebesleid; ein Bogen vom ersten »Blitzen«, dem Überschwang des Glücks im verwandten Gleichklang: jauchzendes »Ewigdein«, Flug der ersten Vögel-Nacht, die heute immer am Anfang, nicht am Ende steht, bis zur Schwere des Liebesprozesses, der glückhaft, dann schmerzhaft an Welt und Realität gewinnt, bis hin zu Abschied und Tod.
Pressestimmen:
» [...] alle Nuancen der Liebe zwischen Willkommen und Abschied, Lust und Verzweiflung an der Liebe machen Sog und Reiz der erotischen Gedichte Schlesaks aus. Es ist von daher aber eher weniger die Lippe-Lust-Tendenz als wiederum das Umspielen und Verschweigen, was immer noch ein gutes (erotisches) Liebesgedicht auszeichnet.«
Hans-Jürgen Schmitt, Süddeutsche Zeitung 1.5.2006

2000
Weiße Gegend
Dieter Schlesak suchte nach seiner Ankunft in Deutschland Zuflucht in der Toskana. Er lebt »das komplizierte Drama eines Schriftstellers, der einerseits in der deutschen Sprache und Kultur verwurzelt ist, beides jedoch von seiner Alltagsbiographie fernhalten muß, um überleben zu können; und der andererseits gerade in der fürs persönliche Überlegen notwendigen Isolation sich fast ausschließlich damit beschäftigen muß, die Verbindung mit dem Kulturraum aufrecht zu erhalten, in dem er nicht leben darf.« (Werner Söllner). Das Deutsche, das in ihm mehrfach gebrochen ist, auch von außen und aus der Distanz sehen, die verinnerlichten Mauern zerstören – das ist die historische Landschaft der »Weißen Gegend«.