weitere Infos zum Beitrag
Essay
Papierwohnungen
Januar 2013
»Woher kommt eigentlich die Poesie? Entsteht sie diesseitig im Kopf des Dichters und als Ergebnis seiner Arbeit oder erwählt sie sich den Dichter zum Medium ihrer Materialisierung?« paraphrasiert a.j. weigoni in einem brief. wenn es gut geht, geschieht beides. als ich einmal bilder vom ausbruch des vulkans stromboli sah, die unterirdische schmiede des göttlichen künstlers hephaistos, den die römer mit vulcanus gleichsetzten, wurde nicht weit davon entfernt lokalisiert, dachte ich, ähnlich entstehen gedichte. man muß erst, am kraterrand der seele, das vulkanische innere freisetzen und es dann abkühlend bearbeiten und sublimieren.
dichtung lebt nicht allein von plötzlicher inspiration, sondern ebenso durch kontinuierliche arbeit. in seinem essay ´VerDichtung – Über das Verfertigen von Poesie` läßt weigoni, der betont, daß sprache werkzeug sei, bereits im titel die ursprüngliche bedeutung des worts poet als verfertiger und macher anklingen. mircea eliade schrieb in ´Schmiede und Alchemisten / Mythos und Magie der Machbarkeit`: »Das sanskritische taksh, "verfertigen", wird gebraucht, um die Komposition der Gesänge im Rig-Veda zu bezeichnen ... das alt-skandinavische lotha-smithr, "Gesangs-Schmied", und das deutsche Wort Reimschmied, "poetaster", zeigen noch deutlicher die engen Beziehungen zwischen dem Beruf des Schmiedes und der Kunst des Dichters und des Musikers ... Nach Snorri nannten sich Odin und seine Priester "Schmiede von Liedern".« noch zu beginn der neuzeit waren handwerk und (dicht)kunst eng verbunden, siehe hans sachs.
im altertum verglich man das dichten mit der webkunst. marcus terentius varro sprach vom flechten der verse. auch kirchenslawisch und arabisch gab es die tradition des verseflechtens. in der dichtung der veden wurde die zungenspitze des dichters, der sein gedicht rezitiert, mit einem weberschiffchen verglichen. im althochdeutschen waren spinnen und weben synonyme für dichten. bei novalis webt die fabel geschichten. der text ist das gewebe der wörter, der sprache und der schrift. verwandt mit text sind lateinisch texere=weben, flechten, zusammenfügen, verfertigen, bauen, errichten, eigentlich kunstvoll verfertigen, textus=gewebe, geflecht, zusammenhang der rede, fortlaufende darstellung, gewebe der schrift, textūra=das weben, gewebe, zusammenfügung, verbindung, textor=weber und textile=gewebe, zeug, tuch, leinwand.
»Möglicherweise liegt darin der Sinn von Poesie, zu beschwören, was abhanden gekommen ist oder was wir erforschen wollen. Schreiben ist, so besehen, eine Art Wiederaneignung der Welt.« sagt Matthias Hagedorn in ´Porträt eines Ohryeurs – A.J. Weigoni zum 50.` man könnte auch sagen, poesie entstehe durch wiedergeburten. und tatsächlich muß sich ja der mensch, und zumal der kreative und geistige, ständig selbst gebären. bei philosophen, mystikern, dichtern und künstlern ist das motiv der geistigen, literarischen und künstlerischen (selbst)geburt oft mit dem der auferstehung verbunden, die jedes originäre werk verlangt. c.g. jung schrieb in ´Symbole der Wandlung`: »Die Vertiefung in sich selbst (Introversion) ist ein Eingehen in das Unbewusste und zugleich Askese. Aus dieser Handlung entsteht für die Philosophie der Brâhmanas die Welt, für die Mystiker die Erneuerung und geistige Wiedergeburt des Individuums, das in eine neue geistige Welt geboren wird.«
weigoni verbindet das profane mit metaphysischem, um heimzukommen »in die Ewigkeit der Gegenwart« (´Start up` in ´Dichterloh`) und eine gegenwart zu überwinden, die bloß der hauswart der wirklichkeit ist. »Gesucht wird ein Mythos – zu finden sind viele einzelne Gedichte.« (´VerDichtung`). immerhin kann dichtung magische substanz individuell bewahren, während die kollektive magie zerfällt und verflacht. so erhält das entfremdete individuum, die zentrale ich-figur moderner lyrik, manches, das sonst verloren geht, noch am leben, wenngleich vom rande der gesellschaft her. nicht zuletzt deshalb hat der schreibprozeß auch einen therapeutischen sinn. »Nur wenn man ein Talent auslebt / kann man die Narben schützen.« heißt es in ´Unbehaust`, »Einsamkeit ist auch nur eine Form / vor sich selbst zu flüchten.« in ´Dichterloh`.
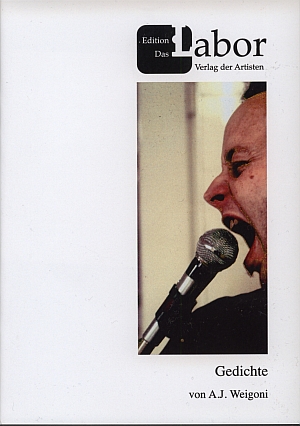
literaturmarkt und literaturbetrieb begegnet weigoni mit distanz. in ´Verweisungszeichen zur Poesie` und ´Verdichtung` konstatiert er: »Die heutige Marktliteratur ist realistisch, optimistisch, fröhlich, sexy und didaktisch ... Die meisten SchriftstellerInnen haben die künstlerische Kontrolle über die Resultate ihrer Arbeit verloren und lassen sich vermarkten ... Vom utopischen Surplus der Literatur bleibt nicht mehr viel. Statt dieses Mehrwerts liefert die Literatur das, was den Waren zu mehr Wert verhilft ... Die Zielgruppe ist an die Stelle der Öffentlichkeit getreten.«, und gibt zu bedenken: »Das Bedürfnis nach Subjektwerdung kann niemals wirklich durch den personalisierten Konsum standardisierter symbolischer Güter gedeckt werden ... Als Notwehr dagegen bleibt, eine VerDichtung zu betreiben, ohne sich Illusionen über Kommerzialität und Zeitgeist-Kompatibilität zu machen ... Gedichte müssen aus Not und Notwendigkeit entstehen und nicht als Geschäftsgrundlage. Lyrik ist eine Kunstdisziplin, die ihren Weg von unten nach oben antreten muss.«
wenigstens in einigen bereichen der gesellschaft, und dazu gehören kultur, bildung, medien, kinderbetreuung, gesundheitswesen und sport, sollten geldmechanismen, mit denen der ideelle wert einer arbeit nur unzureichend erfaßt wird, nicht bestimmen, da sie sonst verwerfungen anrichten und unrecht verursachen. denn natürlich beschädigt und deformiert die geldgelenkte verwertung literatur und künste. wo die kunst zum nur noch kommerziellen faktor wird, entsteht häufig eher kunstgewerbe. auch der literaturbetrieb gerät so leicht zur bloßen begleitmusik einer strukturellen entwertung der eigentlichen literatur. wenn es allein um die popularität beim publikum ginge, wären iffland und kotzebue die wichtigsten dramatiker der ´Goethe-Zeit` gewesen, die man dann besser ´Iffland-Ära` oder ´Kotzebue-Epoche` nennen sollte.
literarische oder künstlerische wirkungen und erfolge basieren ohnehin häufig auf projektionen, illusionen, mißverständnissen, irrtümern, inszenierungen, manipulationen, vereinnahmungen und mißbräuchen. denn die motivationen, antriebe, ambitionen und intentionen im schreibprozeß, die der künstlerische autor selber bewußt oft gar nicht wahrnimmt oder nicht einmal kennt, und die erwartungen der leser, das sind zwei völlig verschiedene wirklichkeiten. manche können die produkte der literatur interpretieren, die spezifik ihrer entstehung verstehen schon viel weniger und eigentlich bloß winzige minderheiten.


