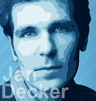Erzählung
Über die Kunst aufzuhören
Da beginnt der zweite Satz von Rachmaninovs Klavierkonzert. Getragene Streicher erklingen, bis ein ganz und gar leichtes und hüpfendes Klaviermotiv einsetzt, eine Blätterteigkomposition, das exakte Gegenteil eines plumpen und unförmigen Tonbreis. Mein Magen, der Kleinbürger in mir, kommentiert das Klavierkonzert mit knurrender Ungeduld. Soll er doch. Ich lege Wert darauf, während des Kochens nicht gestört zu werden und Fantasiearbeit zu erledigen. Ich denke an das Café Ravic, unser Stammlokal in der kleinen Hafenstadt an der Ostsee, das keine Uhrzeit kannte und jede Nacht die letzten Nachteulen aufsammelte. Es war so groß wie ein Handtuch, und doch passten alle hinein, die nach und nach kamen und mitfeierten. Ein viel bewundertes Rätsel. Und erst die Karte. Eine Handvoll Speisen waren auf dem unteren Ende eines kleinen laminierten Kartons zu finden. Sauerfleisch oder Bockwürste, die aber köstlich für die nächsten Gesprächsrunden stärkten. Auch Oliven gab es, in einer kleinen Schale gereicht, schnell und unkompliziert zubereitet. Ob ich meiner Freundin schon einmal vom Café Ravic erzählt habe?
Ich rolle die Teigplatten und schneide sie in fingerdicke Scheiben, fingerdick, das Wort hat meine Freundin unterstrichen. Lilya Zilberstein begleitet mich auf dem Klavier mit einer hypnotischen Spieluhrmelodie. Es geht auf das Finale zu. Das Einfache kann mehr sättigen als das Komplizierte, auch wenn es immer mit dem Dünkel des Kunstlosen behaftet ist. Ich könnte in dem weißen Bändchen weiterblättern. Doch ein plötzlicher Tusch des Orchesters hält mich davon ab. Stattdessen bestreiche ich die Scheiben mit verquirltem Eigelb und bestreue sie mit Mandelstiften. Ich bin bei der Sache, wie man so sagt. Ich forme die Scheiben zu Schnecken, die ich auf dem mit Backpapier versehenen Blech anordne. Mir wird klar, warum mir das Kochen keine Freude bereitet. Ich verausgabe mich an Nebenschauplätzen. Immer wieder rücke ich die Schnecken zurecht, bis sie im gleichmäßigen Abstand auf dem Backblech liegen. Noch einmal sammelt sich das ganze Orchester zu einer schwermütigen orientalischen Melodie, dann ist nur noch das gleichmäßige Summen des Backofens zu hören. Mit Rachmaninovs zweitem Klavierkonzert sind die Oliven-Schnecken im vorgeheizten Backofen verschwunden. In die Stille dringt ein Magenknurren. Seit meine Freundin auf ihrem Kongress in Übersee ist, habe ich keine warme Mahlzeit zu mir genommen. Es ist der größte Kongress ihrer Forschungsrichtung, deshalb dauert er zehn Tage.
3 Auskühlen
Die Stille, denke ich, eine verlässliche Begleiterin. Auch sie ist ein Geräusch. Zeit und Stille, die großen Verführer. Aber da ist noch ein anderes Geräusch, das aus dem Rahmen der Kontemplation fällt. Alle zehn Sekunden knurrt mein Magen periodisch. Er erwartet die Mahlzeit, die sich im leise summenden Backofen ankündigt. Ich lenke mich mit den Meldungen des Tages im Internet ab, die so unergiebig wie das Kochen sind. Dann schlage ich mit eiserner Härte zurück. Ich gehe provozierend langsam zum Buchregal. Mein Magen, der Kettenhund, liegt geschlagen und schwach an der Kette.
Die Oliven-Schnecken liegen schwarz verbrannt und hässlich verformt auf dem Balkon. Sie dampfen aus, bevor sie zu Staub verfallen werden. Ich stehe vor einem Rätsel, das weiße Bändchen in der Hand. Wollte ich es nicht einfach nur schnell gegen ein anderes Lyrikbändchen austauschen? Dabei muss ich mich verlesen haben.
Ich beginne mit dem Notfallprogramm. In Windeseile falle ich über den Kühlschrank her. Ich verdrücke eine komplette Mahlzeit. Salami und Tomaten, Salatblätter und Käsestücke, Fruchtjoghurt und Schokolade, rohe Milch und wieder Salami und Tomaten. Ich mache die Runde dreimal. Mein Magen gluckst fröhlich. Was für ein dummes Organ er ist. Immerhin kann ich weiterlesen. Ein Aufsatz von Wieland aus dem Jahr 1775. Da war ich stehengeblieben, als der Geruch nach verbranntem Teig aus der Küche kam. Die Kunst aufzuhören, zu fühlen was genug ist, und nicht ein Wort mehr zu sagen, nicht einen Strich mehr zu thun, als nöthig ist damit die abgezielte Wirkung erfolge – o meine jungen Freunde, ist für den Dichter wie für den Maler (und warum nicht für jeden Schriftsteller?) eine große und schwere Kunst! Ich nicke begeistert. Wieland stellt meine misslungenen Oliven-Schnecken neben die Schale Oliven im Café Ravic und sagt vertrauensvoll: Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das Verrühren von Quark, Öl und Salz, das Mischen und Verkneten von Mehl und Backpulver, das Ausrollen des Teigs zu zwei Rechtecken, das Bestreichen der Teigplatten mit verquirltem Eiweiß. Du hättest dir auch einfach ein paar Oliven in eine Schale legen können.
Da kommt meine Freundin. Ich höre ihren Rollkoffer und husche in Windeseile auf die Couch, um eine schlafende Haltung zu imitieren. Das ist meine einzige Chance. In wenigen Sekunden wird sie die Blamage riechen. Sie hat eine im Kochen geübte Nase, die ihr untrüglich verrät, was hier schiefgelaufen ist. Ab und zu gluckst mein Magen, dem ich wie einem Spielkameraden zuflüstere, dass er endlich ruhig sein soll. So überlasse ich mich meinem Schicksal. In Gedanken liege ich auf derselben Couch, zwischen Decken und Kissen eingegraben, nicht hier, sondern in der kleinen Hafenstadt an der Ostsee, drei blonde Engel in meinen Armen, die mich bekochen und dann zärtlich verwöhnen, während ich ihnen Zitate von Meister Fourier zum Besten gebe.
Ich sage meiner Freundin, dass ich aufhören will. Aufhören ist nicht einfach, sondern eine Kunst für sich. Aufhören mit dem Kochen will ich. Was sonst? Ob ich mit dem Kochen überhaupt angefangen habe, fragt sie mich. Welche spitzfindigen Worte sie gebraucht. Dann hält sie mir die zu Ruß erstarrten Oliven-Schnecken unter die Nase. Sie fragt mich, was ich mir dabei gedacht habe. Einen Beweis führen, antworte ich ihr. Wie ein Wissenschaftler auf ihrem Kongress. Die Oliven-Schnecken sind mein empirisches Material. Ja, sage ich. Sie beweisen in aller Deutlichkeit, dass ich ein geborener Nichtkoch bin.
Schließlich versöhnen wir uns. Sie kocht mir in atemberaubender Geschwindigkeit mein Lieblingsgericht, Spaghetti bolognese. Sie selbst hat keinen Hunger. Seit Jahren habe ich mich nicht mehr so frei gefühlt. Ich beschließe, ihr eines Tages ein Souper spectaculaire zu kochen, ein gewaltiges Festmahl, das Meister Fourier als Auftakt eines glänzenden Fests sehen würde, mit anschließendem Ball, dem Auftritt von Feuerschluckern, Zwergen und Elefanten, ein Festmahl, bei dem die Oliven-Schnecken nur ein Gang unter vielen wären. Oder vielleicht auch nur Oliven, in einer Schale gereicht, als appetitliche Zutat. Ich stelle ihr gern ein opulentes Festprogramm zusammen. Es kostet mich keine Mühe. Ich kann gleich damit beginnen.