weitere Infos zum Beitrag
[Journal et lettres de prison 1941–1942, 1988]
Vildés Denken
07.09.2012 | Hamburg
Der wahre Stolz schert sich wenig um die öffentliche Meinung und nicht mal um die der Nächsten. Der wahre Stolz ist der, welcher fortdauert auf einer Einzelzelle oder auf einer abgelegenen Insel.
Das Zitierte findet sich als Reflexion auf eine Sentenz Pascals in einem der letzten Einträge des Tagebuchs von Boris Vildé. Es wurde am 5. Januar 1942 notiert. Ein faschistisches Gericht wird den russisch/französischen Widerstandskämpfer kurz darauf zum Tode verurteilen.
Unter dem Titel „Der Trost der Philosophie“ sind im Verlag Matthes und Seitz nun das Tagebuch und Briefe aus der Haft von Boris Vildé erschienen. Die Wahl des Titels, der von Boetius herrührt, passt dahingehend, dass auch in diesem Buch sich ein Mensch denkend gegen die Barbarei seiner Peiniger und die Tristesse der Gefängnishaft stemmt. Augustinus, Pascal, Nietzsche, eine Reihe anderer Autoren. Bergson vor allem. Seneca. Baudelaire. Lektüren, Momente, in denen es gelingt, wenn nicht den Tod, so doch die Angst zu bezwingen. Anfangs findet sich noch eine längere und widerkehrende Auseinandersetzung mit dem Gedanken an Selbstmord. Ähnlich dem Denkenden aus Brechts Texten aus den dreißiger Jahren entwickelt Vildé ein Einverständnis mit dem Tod, welches ihn in die Lage versetzt, aus dem Gedanken Stärke zu ziehen. Entsprechend befreien sich auch seine Gedanken und Vildé reflektiert über die veschiedensten Themen, auch wenn er auf den Tod immer wieder zurückkommt.
Man kann die Veröffentlichung seiner Texte, übersetzt und herausgegeben von Felix Philipp Ingold, mit gutem Gewissen als literarisches Ereignis erster Güte bezeichnen, und das gute Gewissen funktioniert dabei in zweierlei Richtung, sowohl politisch als auch ästhetisch. Und das aus vielerlei Gründen.
Es handelt sich bei diesem Buch um ein literarisches Dokument von größter Eindringlichkeit und sprachlicher Qualität. Diese in den deutschen Text gerettet zu haben, ist zweifellos ein Verdienst des Übersetzers. Ingold geht mit der genau richtigen Mischung aus Empfindsamkeit, Wagemut und Einfühlungsvermögen ans Werk und entwickelt dabei eine Sprache, die dem ursprünglichen Gestus der Texte nahe kommt, soweit ich das einzuschätzen vermag.
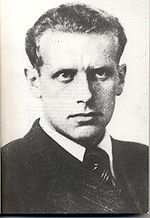
Vildé hat seinen Text auf Französisch verfasst, wie wohl es nicht seine Muttersprache war, diese war russisch. Er verließ Russland in den zwanziger Jahren, lebte eine Zeitlang in Berlin, bevor er 1932 Franzose wurde. Doch ist dieser Text in Russland wie in Frankreich gleichermaßen rezipiert worden, entstammt er doch einer Zeit, in der beide Länder im faschistischen Deutschland einen gemeinsamen Feind hatten.
In Frankreich studierte Vildé Ethnologie und erhielt eine Stelle am Musée de l´Homme, das 1937 von Paul Rivet zur Pariser Weltausstellung neu gegründet wurde und neben bedeutenden Sammlungen auch eine Bibliothek mit 500000 Bänden enthielt. Entsprechend breit auch war das Interesse Vildés gefasst, wenn man die Lektüreliste seines Gefängnistagebuches betrachtet, und reichte von religionswissenschaftlichen über soziologische Texte bis hin zur Philosophie. Besonders die von Bergson scheint ihn beschäftigt und beeinflusst zu haben.
Seine Liebe indes gehörte der Dichtung, sowohl der russischen als auch der französischen.
Und es scheint sich bei diesem Autor um einen außergewöhnlich sprachbegabten Menschen gehandelt zu haben, denn er berichtet auch davon, wie er mit Hilfe einer Grammatik Altgriechisch lernt, und wie er sich zugleich mit originalsprachlichen Texten befasst. Außerdem liest er Englische und deutsche Texte im Original und kann deren inhaltliche und ästhetische Besonderheiten auf eine treffende Weise analysieren. Ein europäischer Intellektueller, genial würde ich ihn nennen, wenn ich diesem Wort nicht misstrauen würde.
Wahrscheinlich ist das emphatische Moment der Übersetzung Ingolds schweizerischer Herkunft geschuldet, ein Deutsch, das nicht in jenem Masse korrumpiert ist wie das in Deutschland selbst gesprochene. Und wenn ich an die Analysen Klemperers zur LTI (der Sprache im Dritten Reich) denke, scheint es mir so, dass nur ein Schweizer Vildé hat angemessen übersetzen können. Mental, fürchte ich, sind wir Deutschen noch lange nicht in Europa angekommen.
Boris Vildé gehörte zu den Begründern der Résistance während der deutschen Besetzung Frankreichs. Er war wie erwähnt im Pariser Musée de l´Homme tätig und begründete dort mit Kollegen eine Widerstandszelle, die jene Untergrundzeitung herausgaben, die der Französischen Widerstandsbewegung den Namen gab. Auch der Text dieser Untergrundzeitung ist im Buch abgedruckt.
Im März 1941 wird Vildé von der SS gefangen genommen und im Februar 1942 hingerichtet. Er wurde gerade einmal 33 Jahre alt. Während des Jahres Haft entsteht jenes Tagebuch, welches nach Vildés Hinrichtung seiner Frau ausgehändigt wird. Dieses Tagebuch ist ein einzigartiges Dokument eines inneren und intellektuellen Widerstands gegen die von Deutschen ausgeübte Barbarei und zugleich eines des unbedingten Willens zum Leben, was für Vildé Bildung heißt.
Vildé weigert sich beharrlich, das an sich zu vollziehen, was die Nazis ihm zugedacht haben. Das Opfer wird nicht zum Lamm. Bis zum letzten Tag seines Lebens arbeitet er an sich, an seiner Vervollkommnung, wohl wissend, dass er sie nicht erreichen wird.
Am 1. Januar 1942 liest er sein Tagebuch noch einmal durch und notiert:
Ich fand dabei eine leise Erregung, ähnlich der, die ich vor zwei Monaten hatte, als man mir meinen Taschenspiegel aushändigte und ich mich nach sechs Monaten im Glas betrachten konnte.
Dem Leser geht es ähnlich.
Warum hatte ich von Vildé vor diesem Buch noch nie etwas gehört? Es ist die Art und Weise, wie hierzulande mit Geschichte umgegangen wird. Immer wieder wird Deutschland in einen Opferzusammenhang gestellt. Einerseits als Opfer der Nationalsozialisten, als ob sie gar keine Deutschen gewesen wären, und andererseits als Opfer der Alliierten. Mag sein dass das so von offizieller Stelle nicht ausgesprochen wird, aber das Klima in dem ich aufwuchs, war ein solches.
Umso wichtiger scheinen mir Bücher wie das vorliegende zu sein, nicht, um zum tausendsten Mal bekannte Stereotypen herunterzubeten, sondern um eine Haltung zu lernen, mit der man dem Tod und der Barbarei begegnen kann, aber auch um zu lernen, wie viel Stärke man aus dem eigenen Denken und dem Denken der anderen ziehen kann, soweit es auf Vervollkommnung und nicht auf Vernichtung zielt. Zumal in höchster sprachlicher Qualität.
Alle drei Monate darf Vildé aus der Haft an seine Frau schreiben. Er beschließt den letzten Brief vom 23. Februar 1942 folgendermaßen:
Meine Geliebteste, ich bin bereit, ich gehe hin. Ich verlasse Sie, um Ihnen in der Ewigkeit erneut zu begegnen.
Ich segne das Leben, das mich überschüttet hat mit all seinen Gaben.
Stets der Ihre
Boris
Exklusivbeitrag
Boris Vildé: Trost der Philosophie. Tagebuch und Briefe aus der Haft. Herausgegeben von Felix Philipp Ingold. ISBN 978-3-88221-598-4 € 19,90 Matthes & Seitz Berlin 2012

