Die Macht der Vorurteile über Frau und Mann
Vom Stillstand durch Fortschritt
31.10.2012 | Hamburg
Es kommt nicht häufig vor, dass ein Buch, als unterhaltsam und fundiert angepriesen wird, und dieses Versprechen tatsächlich einhält. Cordelia Fine ist Neurowissenschaftlerin und lebt und lehrt derzeit in Australien. Offensichtlich hat sie sich so sehr über die Vorurteile geärgert, die die Neurowissenschaften nicht relativieren, sondern vielmehr [ohne Basis] verhärten, dass ihr das seltene Kunststück gelungen ist, tatsächlich diese Art von Buch zu schreiben: unterhaltsam und fundiert.
Vermutlich hat jeder von Bestellern gehört, mit Namen wie: Warum Frauen nicht einparken und Männer nicht zuhören können. Aber nicht nur derartige populärwissenschaftliche Bücher, auch Artikel in der Tagespresse, Features in Radio und Fernsehen berufen sich immer wieder auf biologische „Beweise“, warum Frauen und Männer sich grundsätzlich unterscheiden. Und niemandem fällt auf, wie unreflektiert bei derartigen Behauptungen kulturelle Rahmenbedingungen ausgeblendet werden.
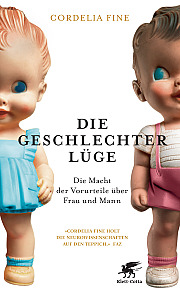
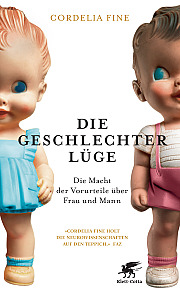
Cordelia Fine zeigt in ihrem Buch, dass das nicht nur ärgerlich, sondern überaus folgenreich ist. Gerade weil soziale Rollen sich flexibel an Umweltbedingungen anpassen, und eben nicht biologischen Veranlagungen entstammen.
Fine weist zum Beispiel an einer Reihe von Experimenten nach, wie sehr allein die Art der Fragestellung, oder ein simples Ankreuzen der Geschlechtskategorie auf einem Fragebogen, Antworten und Ergebnisse beeinflusst. Und zwar weil dadurch Geschlechtsstereotypen aktiviert werden, nicht weil sich der Körper seiner biologischen Veranlagung erinnert.
Auf diese Art und Weise befördert die Neurowissenschaft eine neue Phase der Geschlechterungleichheit, eine Benachteiligung und Ausgrenzung aufgrund des Geschlechtes, die umso nachhaltiger wirkt, weil sie nicht einmal bewusst wahrgenommen wird.
Als Bereich der empirischen Forschung gibt es die neurowissenschaftliche Untersuchung zu Geschlechtsunterschieden seit dem 20. Jahrhundert. Ursprünglich lieferte die Wissenschaft hier handfeste Argumente gegen das Frauenwahlrecht, indem sie nachwies, dass das Rückenmark der Frau zu kurz für politische Betätigung ist, oder dass sich zu viel geistige Arbeit ungünstig auf die Entwicklung der Eierstöcke auswirkt. Wie Fine zeigt, sind wir leider nicht so weit entfernt von einer dermaßen absurden Argumentation, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag.
So wird zum Beispiel die unterschiedliche Lateralisation (Die Aufteilung von Prozessen auf die rechte und linke Hälfte wird als Lateralisation bezeichnet) bei Frauen und Männern, als biologischer Beweis für ein besseres Sprachgefühl bei Frauen und ein besseres Systematisierungstalent bei Männern angeführt. Allerdings konnte keine einzige der diesbezüglich von Fine untersuchten Studien einer näheren Überprüfung standhalten. Vielmehr wird bei der Interpretation von Daten reflexhaft davon ausgegangen, biologische Unterschiede würden geschlechtsspezifische Verhaltensweisen begründen, dabei könnten die Unterschiede in Aufbau- und Funktionsweise männlicher und weiblicher Gehirne, „womöglich das genaue Gegenteil bewirken, das heißt, dass sie Geschlechtsunterschieden bei offensichtlichen Funktionen und Verhaltensweise entgegenwirken, indem sie physiologische Unterschiede ausgleichen [¡K] Weder strukturelle noch funktionale Bildgebungsverfahren können uns heute schon sehr viel Aufschluss über die Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Fühlen und Denken geben.“
Letztendlich führen derartige Fehl- und Kurzschlüsse dazu, dass gut gemeinte Bildungsreformen schlechte Auswirkungen haben, beispielsweise wenn angenommen wird, es wäre eine Verbesserung der schulischen Bedingungen, wenn Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet werden. Was daraus resultiert, ist die Verfestigung von Geschlechtsstereotypen.
Den auf soziale Einflüsse fixierten Denkern der 1950er, 1960er und 1970er Jahren standen PET- Scans, Magnetresonanztomographie, SPECT ¨C Einzelphotonen-Emissions-Tomografie Scans u.a. biologische Forschungsapparaturen nicht zur Verfügung. Weil sie den Menschen nicht in die Köpfe schauen konnten und daher auch nicht die grundlegenden Unterschiede zwischen den Gehirnen von Männern und Frauen kannten, mussten sie eine Theorie formulieren, die mit soziologischen und nicht mit naturgegebenen Faktoren argumentierte. Sie mussten in Genderstudien den Einfluss der Erziehung und des sozialen Umfelds über Gebühr herausstreichen, weil sie nicht die Möglichkeiten hatten, die wahre Natur der Männer und Frauen zu studieren.“
Klingt erst einmal fortschrittlich überzeugend und wissenschaftlich objektiv, oder? Laut Fine gehört diese Aussage jedoch in den Bereich des Neurononsense. „Belegbar ist vielmehr, dass Reportagen über Genderfragen in den Massenmedien, die die Relevanz biologischer Faktoren betonen, in uns die Neigung verstärken, Genderstereotype zu übernehmen und uns selbst entsprechend dieser Stereotype zu verhalten; sogar unsere Leistung kann sich dementsprechend verändern.“
„Neurosexismus begünstigt schädliche, diskriminierende, potentiell sich selbst erfüllende Stereotype.“
Tatsache ist, dass die Gehirnentwicklung in einem hochkomplexen Zusammenhang, einer ständigen Interaktion zwischen Genen, Gehirn und Umgebung erfolgt.
Die Vorstellung einer genderneutralen Erziehung entlarvt Fine als unrealisierbare Wunschvorstellung. Eine genderspezifische Sozialisation beginnt schon pränatal. So beeinflusst das Wissen um das Geschlecht des Kindes die Art und Weise, wie Mütter die Bewegungen des Ungeborenen wahrnehmen.
Unmittelbar nach der Geburt, befinden sich die Säuglinge in einer Welt, die durch Genderstereotypen strukturiert sind (rosa und blaue Bändchen und Kleidung). Babys verfügen über ein großes Gespür, Unterschiede zu erkennen und sich Muster anzueignen. Bereits im Alter von drei oder vier Monaten können sie Männer von Frauen unterscheiden und sind im Alter von zehn Monaten irritiert, wenn ihre Erwartungen bezüglich der Genderstereotype nicht erfüllt werden. Im Alter von zwei Jahren wissen sie, welchem Geschlecht sie selbst angehören.
Um herauszufinden, was für Vorlieben und Verhaltensweisen ihrem eigenen Geschlecht entsprechen, entwickeln sich Kinder in diesem Alter zu „Genderdetektiven“. Ihre Umwelt macht es ihnen nicht schwer, eine Vielzahl von Hinweisen zu finden. „Die genderstereotypen Muster unseres Alltags können so selbstverständlich sein, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen.“
Darüber hinaus dienen „die Reaktionen der Peergruppe [¡K] Kindern als Erinnerung daran, dass ihr Verhalten nicht den Genderregeln folgt, und sie unterbinden genderübergreifendes Verhalten mit besonderer Wirksamkeit.“
Auch in Medien und Literatur für Kinder halten sich die Genderstereotype hartnäckig. [keine Pippi Langstrumpf weit und breit]. Was gar nicht vorkommt, sind „mädchenhafte Jungen“. Die Werbung bedient und verhärtet Stereotype, wer mit welchem Spielzeug spielt.
„Weil sich Gendervorlieben immer wieder trotz der gutgemeinten Bemühungen der Eltern entwickeln, nehmen diese häufig an, dass ihr Kind doch wohl irgendwie so veranlagt sein müsse.“ Also bleibt als letzte verbleibende Erklärungsmöglichkeit die Biologie, während in Wahrheit die Vorlieben auf dem Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit beruhen.
Emily Kane bezeichnet gebildete, privilegierteEltern, die diesen Umstand ignorieren und vorschnell auf biologische Erklärungsmuster zurückgreifen, als „Avantgarde eines beschränkten soziologischen Vorstellungsvermögens.“
Welche Auswirkungen das hat, liegt auf der Hand, denn die soziologischen Bedingungen sind im Gegensatz zu biologischen Tatsachen, veränderbar.
„Und gleichzeitig wird nun die Neurowissenschaft von gewissen Autoren für Zwecke eingespannt, für die sie schon in der Vergangenheit immer wieder herhalten musste: überkommene Stereotype und Rollen mit der ganzen einschüchternden Autorität der Wissenschaftlichkeit zu untermauern.“ Problematisch ist, wie diese neurowissenschaftlichen Halbwahrheiten soziale Einstellungen beeinflussen.
"Unser Denken, unsere Gesellschaft und der Neurosexismus generieren Unterschiede. Zusammengenommen entsteht aus ihnen das Konstrukt Gender. Doch ist dieses Konstrukt kein ehernes Gebilde; die Verdrahtung ist nicht unauflöslich. Sie ist flexibel, sie ist formbar, wir können sie verändern. Und wenn wir darauf fest vertrauen, dann wird sie sich immer weiter auflösen.“
Und zwar auf einem Weg kritischen Hinterfragens, auf dem dieses Buch nicht den ersten, aber einen hoffentlich folgenreichen Schritt darstellt.
Exklusivbeitrag
Cordelia Fine. Die Geschlechterlüge. Die Macht der Vorurteile über Frau und Mann. Aus dem Englischen von Susanne Held. ISBN: 978 3 608 94735 9. 21,95 €. Klett Cotta, Stuttgart, 2012.

