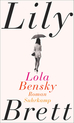weitere Infos zum Beitrag
Roman
Mit Hendrix, Joplin, Jagger und Co in die Arche
25.11.2012 | Hamburg
Lily Brett, 1946 in Deutschland in einem Lager für Displaced Persons geboren, will nicht Lola Bensky sein. Verständlich, denn welcher seriöse Autor möchte schon die Etiketten „Autobiographie“ und „Roman“ verwechselt haben. Und tatsächlich hat die Autorin für Unterschiede im Detail gesorgt. Andererseits: Wie unpassend in Bezug auf Lily Bretts neues Buch Lola Bensky ein Ausspruch wie der von John Irving über seine Romane, an seine Leserschaft gerichtet: „Ich denke mir Leute aus, die Ihnen sympathisch sind. Dann überlege ich, was Ihnen alles Schlimmes passieren könnte.“ (FR, 10./11.11.12)
Wir sind in den sechziger Jahren. Lola Bensky war mit 15 Beatnik gewesen, jetzt aber ist sie 19 und arbeitet als Musikjournalistin für eine australische Musikzeitschrift, genau wie die Autorin es tat. Lola ist sich ihrer Emanzipiertheit bewusst: „Die Welt war nicht für Frauen geschaffen. Es war eine Männerwelt. Lola war eine der wenigen Frauen, die im Rockjournalismus arbeiteten.“ Sie erhält, märchenhaft leicht offensichtlich, Interviewtermine und spontane Gesprächsgelegenheiten in London, New York, Los Angeles, Monterey, Ca. mit sehr vielen, man möchte fast sagen: allen Popgrößen der Zeit, die ihre Namen im Roman beibehalten dürfen, darunter Jimi Hendrix, Mick Jagger, Cher, The Kinks, The Hollies, The Small Faces, Janis Joplin, Cat Stevens, Manfred Mann, The Walker Brothers, Jim Morrison, Brian Jones, Mama Cass.
Nur plaudert man kaum über Musiktechnisches, sondern Lola stellt bevorzugt Fragen zum Privat-, zum Familienleben der Stars so (bewusst oder unbewusst, lässt sich nicht sagen), dass deren Antworten für sie Impulse darstellen, über ihr eigenes Leben zu sprechen, beinahe Beichte abzulegen. Immer trifft sie auf offene Ohren, obwohl sie anfangs gar nicht erwartet, dass ein Mick Jagger Bescheid weiß: „Lola war überrascht, dass Mick Jagger wusste, was Auschwitz war. Viele Menschen wussten es nicht.“ Wie ihre jüdischen Eltern zwar Auschwitz überlebt hatten, ansonsten aber die meisten Verwandten umgekommen waren. Wie ihre Mutter gedanklich dann kaum bei der Familie sondern bei „ihren Toten“ war; wie auch der Vater nach der täglichen Doppelschicht in der Wahlheimat Australien „zu müde zum Sprechen“ war, höchstens einmal depressive Sätze in seiner jiddischen Diktion herausbringt: „Mit solchem Spielen ich bin fertig“, als er, ganz Schlemihl, wie immer beim Tennis verliert. Es sind dies Passagen im Buch, in jedes der acht Kapitel eingearbeitet, die an die Plastizität der Maus-Cartoons von Art Spiegelman erinnern. Und wenn wir schon bei der Holocaust-Thematik sind:
Lily Brett lässt Lola Bensky Details zum Ghetto- (Lodz) und Lagerleben anführen, die uns bei aller (eingebildeten) Informiertheit noch einmal neue Schauerkeller der Scham aufschließen.
Lola Bensky startet ihre Interviewserie in der Erwartung, dass die Popstars privat auch so urgewaltig kräftig erscheinen, so unjüdisch gleichsam in Lolas Augen, wie auf der Bühne. Doch Mick Jagger wirkt im Interview „schmächiger“, während Jimi Hendrix im Off gar das „Gesicht eines Chorknaben“ aufweist, „friedvoll und nahezu sündenfrei“. (Im Interview sagte Lily Brett über Hendrix, er sei einzigartig „sexual“ gewesen: „I almost couldn`t look.“)
Janis Joplin wiederum, mit der Lola leicht Intimes besprechen kann, „hatte etwas Ernsthaftes an sich“. Mit solch lieben, mitfühlenden Stars kann Lola ihre beklemmende Sozialisation aufarbeiten. Deren Entspanntheit im Privaten ermöglicht der Autorin konzeptionell leichter auch humorvolle Aspekte aus Lolas Leben und sogar dem Ghetto- und Lagerleben anzuführen, natürlich immer mit bitterem Beigeschmack: Dass Lola – neben Popgeschichte und den Holocaustauswirkungen überhaupt ein beherrschendes Thema im Buch, s. vor allem das Interview mit Mama Cass - jetzt gerade wieder eine neue Diät ausheckt („Auf ihrer neuen Liste stand die Eier-Gurken-Diät ganz oben.“) Wobei der Leser schon weiß, dass sie als Kind von ihrer Mutter, ein molliger Lagerinsasse hätte sich ja damals der Kooperation mit dem Lagerpersonal verdächtig gemacht, zur Zwangsdiät in ein australisches Krankenhaus geschickt worden war. Und dass im Ghetto einmal viel zu viel Kohl angeliefert worden war, so dass statt leerem Magen ein übervoller Darm quälte.
Zwischendrin ist Lola dann 30, Ehefrau in erster Ehe und Mutter, doch auch sie verbleibt als junge Erwachsene in kollektiven neurotischen Fesseln, „mit doppelter Naht an die Toten gebunden“ (141)“. Und da ist dann wohl auch der zweifache Schmerz von Lola Bensky wie auch der Autorin Lily Brett ausgesprochen: Dass nämlich nicht nur die meisten ihrer Familie umgekommen waren, sondern dass mittlerweile (im abschließenden Kapitel ist Lola 63, lebt mit ihrem zweiten Mann in New York) auch viele der Rockstars, die sie interviewte und lieb gewonnen hatte, seit dem Monterey International Pop Festival (1967), dem Sinnbild für Frieden und Freude, jung gestorben sind: „Die Liste der Toten war endlos.“ Trotzdem, hier die hoffnungsstiftenden letzten Sätze des Romans: „Lola stellte fest, dass Mick Jagger sie immer noch ansah. Sie lächelte ihm zu. Er lächelte und nickte.“
Brigitte Heinrich, die Übersetzerin hat ihren gebührenden Anteil an dem neuen Lily-Brett-Leseerlebnis, denn sie hat sowohl dem Bitterbösen als auch dem Laxen angemessenen deutschen Ausdruck verliehen.
Lilly Brett ist mit Lola Bensky ein Roman gelungen, der die Thematiken Initiation, Identität, langes gefährdetes Wachsen vs. schneller Tod behandelt. Wer zudem um die 60 ist, fühlt sich ohnehin ernsthaft und humorvoll zugleich aufgenommen in diese schaurig-schöne literarische Arche.
Exklusivbeitrag
Lily Brett: Lola Bensky. Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Brigitte Heinrich. 303 S., Hardcover, ISBN 978-3-518-42330-1, € 19,95 Suhrkamp, Berlin 2012