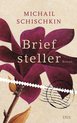weitere Infos zum Beitrag
Roman
Am Anfang wird wieder das Wort sein
29.11.2012 | Hamburg
„Wie ich die Zeitung von gestern aufschlage, steht da etwas über Dich und mich.
Da steht: Am Anfang wird wieder das Wort sein.“ So beginnt der erste Brief des Romans Briefsteller, und so muss wohl jedes Buch von Michail Schischkin beginnen, mit einer Huldigung an das Wort. In Venushaar, dem vorhergehenden Roman, für den Schischkin nicht nur in Russland, wo er ohnehin schon lange ein Star ist, gefeiert wurde, sondern endlich auch in Deutschland einige Beachtung fand, heißt es im vorangestellten Zitat aus dem Buch der Offenbarung Baruchs: „Denn durch das Wort ward die Welt erschaffen, und durch das Wort werden wir einst auferstehen.“
Michail Pawlowitsch Schischkin Foto: Elke Engelhardt
Schischkin, der die russische Literaturgeschichte mit einem Baum vergleicht, dessen Stamm von der slawischen Bibelübersetzung über mittelalterliche Chroniken in die Romane von Turgenjew, Dostojewski und Tolstoi wächst, sieht sich als Traditionalisten. Und was könnte traditioneller sein, als ein Briefroman? Und zudem so viele Entfaltungsmöglichkeiten für die Sprache und die Protagonisten bieten?
Man hat Schischkin einen lebenden Klassiker genannt, einen neuen Tolstoi, weil man wohl immer Vergleiche braucht, um auszudrücken, wie einzigartig einer ist. „Die Kunst des Schreibens“, sagt Schischkin selbst, „liegt in der Abweichung von der Norm.“ Deswegen schreibe er auch niemals in einer anderen Sprache als seiner Muttersprache, denn in den Fremdsprachen muss man „richtig schreiben.“ Zum Glück gibt es Andreas Tretner. Übersetzen ist das Unmögliche versuchen, sagte er anlässlich der Verleihung des Preises der Kulturen, den er gemeinsam mit Michail Schischkin für Venushaar erhielt. Das Unmögliche ist ihm bei Briefsteller erneut gelungen.
Seit 1995 lebt Michail Schischkin in der Schweiz, Moskau und Berlin. Seine Romane wurden national und international vielfach ausgezeichnet, u.a. erhielt er als Einziger alle drei wichtigsten Literaturpreise Russlands. Dennoch dauerte es Jahre, bis die erste Übersetzung eines seiner Romane auf Deutsch erschien. Jahrelang lehnten die Verlage eine Übersetzung ab, der Stoff sei zu schwierig für deutsche Leser.
Briefsteller waren Handbücher zum Verfassen von Briefen. Neben Anleitungen, wie Briefe mit amtlichem Charakter verfasst sein sollten, entstanden auch Muster für Liebesbriefe. Und auch Sascha und Wolodja könnte man als Stellvertreter für mustergültige Lebensläufe ansehen, ihr Leben eine exemplarische Wiederholung von Freud und Leid, Hoffnung und Enttäuschung, beispielhaft wie die Zeitung, die Sascha in der Straßenbahn aufschlägt; „erste Seite Krieg. Letzte Seite Kreuzworträtsel.“
Wolodja und Sascha schreiben einander Briefe, Liebesbriefe. Der Krieg hat sie nach einem kurzen Liebesglück getrennt. Wolodja schreibt von seinen Erfahrungen im Boxeraufstand 1901 und Sascha davon, wie sie ihn vermisst, wie ihr Leben zu Hause ohne ihn weitergeht. Sie erinnern sich in ihren Briefen an die schönen gemeinsamen Momente, und erzählen einander ihre Lebensgeschichten. Die Briefe sind voller Auflehnung gegen das was ist, voller philosophischer Einsichten: „Ich tigerte sinnlos umher. Und dachte auf einmal: Wer bin ich denn? Wo bin ich? Und ging die Latrine putzen. Und die Welt wurde gewissermaßen schwerelos. Ich musste erst hier herkommen, um die einfachsten Dinge verstehen zu lernen. Scheiße ist überhaupt nicht schmutzig, verstehst Du?“
Jeder der Briefe ist voller Vertrauen darauf, vom anderen verstanden zu werden, während um die Liebenden herum das Unverständnis wuchert. Auch als Wolodja fällt, treffen seine Briefe weiterhin ein, und auch Sascha hört nicht auf, ihm zu schreiben, von einer neuen Beziehung, einer Fehlgeburt, von ihrer Arbeit als Ärztin, dem Tod der Eltern und immer wieder von der Sehnsucht danach, verstanden zu werden. Beide glauben mindestens genauso fest an die Macht der Sprache, wie an die Macht ihrer Liebe. „Ich beschreibe es Dir nicht, so ist es gewissermaßen nicht vorhanden“, schreibt Wolodja über die grässlichen Szenen, die er während des Krieges mitansehen muss. Immer wieder ist dieses Buch, neben Liebesgeschichte und Kriegsbericht, ein Buch über die Bedeutung der Worte. „Irgendwann bist du soweit und merkst: Wenn sich das Erlebte in Worte fassen lässt, dann heißt das, es war nicht der Rede wert. [¡K] Ich spreche von der Vergeblichkeit der Worte. Wer die nicht spürt, wird nichts von ihrem Wesen verstehen.“
Mit dem Tod Wolodjas gerät die Zeit aus den Fugen. Zwischen den Schreibern liegen nun nicht nur Tausende von Kilometern, sondern außerdem Jahrzehnte. Während Sascha altert und den Wechsel der Zeiten erlebt, bleibt Wolodja im Jahr 1901 und im Boxeraufstand gefangen. Über Entfernung, Zeit und letztendlich sogar über den Tod hinaus, reicht das Wort, reichen diese Briefe, die zur Weltliteratur gehören, so dass am Ende alles möglich scheint.
Am Anfang war das Wort und am Ende schließt sich ein Kreis, in dem nichts mehr so ist, wie es nicht sein sollte.
Exklusivbeitrag
Michail Schischkin. Briefsteller. Roman. Aus dem Russischen von Andreas Tretner. ISBN 978 3 421 04552 2. 378 Seiten. 22,90 €. Deutsche Verlags Anstalt München 2012