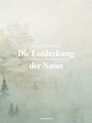weitere Infos zum Beitrag
Etappen einer Erfahrungsgeschichte
Eine Zeitreise durch die Naturbetrachtung. »Die Entdeckung der Natur« von Jürgen Goldstein.
29.06.2013 | Hamburg
Nicht zufällig heißt die Reihe, in der Jürgen Goldsteins Erfahrungsgeschichte der Natur bei Matthes & Seitz erschienen ist, Naturkunden. In 16 Kapiteln berichtet Goldstein von Horizontüberschreitungen durch Seefahrten und Bergbezwingungen vom 14. Jahrhundert bis heute, und zeigt an Beispielen von Petrarca bis McCandless wie sehr die Wahrnehmung der Natur durch Zeitgeist und persönliche Hintergründe beeinflusst werden.
Anhand persönlicher Notizen der „Abenteurer“ zeichnet er lebendig und unterhaltsam „einen Entwicklungsbogen nach, der von der zaghaft einsetzenden Lust am Schauen über die spektakulären Naturerkundungen bis zur heutigen Anschauungsmüdigkeit reicht.“
Als Ausgangspunkt für seine Reise durch die Naturerfahrungen wählt Goldstein die These, der Mensch sei ein „Tier mit Borderline-Symptomen. Er hat ein gestörtes Verhältnis zu natürlichen Grenzen.“
Während Petrarca die Aussicht vom Mont Ventoux durch angelesene Zitate wahrnimmt, tritt Kolumbus der Natur staunend und mit Ehrfurcht gegenüber. Die „Wilden“ jedoch, die diese Natur bewohnen, sind für ihn nichts als skurrile Fundstücke. Aber auch die überwältigende Erfahrung der Natur gelingt ihm nur mit den Stilmitteln des Alten, er orientiert sich an Marco Polos Reiseberichten. Ebenso wie bei Petraca bestimmt das Gelesene die Wahrnehmung.
Auch bei Maria Sibylla Merians Blick auf die Natur gehen zunächst religiöse Anschauungen und die Erforschung der Natur eine Verbindung ein: „Es ist die Entwicklung, die Entfaltung, die planvolle Veränderung, die sie beschäftigt: in der eigenen wie in der äußeren Natur.“ In Surinam will Merian die lebendigen Zusammenhänge der in Amsterdam ausgestellten Insektenexponate erforschen. Ihr vorurteilsfreier Blick (sie reiste auf eigene Kosten, ideel und wirtschaftlich unabhängig), gehorcht in erster Linie der Neugier. Während des zweijährigen Aufenthaltes in Surinam emanzipiert sich Merians Blick zunehmend von Religion und Zeitgeist. Goldstein bescheinigt ihren Beschreibungen und Bildern „erste Momente dessen [¡K] was eine Naturalisierung des Blicks genannt zu werden verdient.“
Forster bricht nicht aus Neugierde und nicht aus freiem Willen zu einer Weltreise auf. Die Niederschrift seiner Erfahrungen, mit dem Blick eines Zeichners, veranlasst Lichtenberg dazu, ihn einen „Hexenmeister der Prosa“ zu nennen. Insbesondere bei seiner Beschreibung Tahitis zeichnet Forster Wortgemälde aus einfachen Strichen. Anders als Kolumbus, ist er, wenn er die Tahitianer beschreibt, fähig, von der eigenen Kultur abzusehen, der Begrenztheit und Subjektivität des eigenen Blickes ist er sich durchaus bewusst: „Ein jeder hat aber auch seine eigne Art zu sehen. Nationalcharakter, Nationalpolitik, Erziehung, Klima, und was sonst nicht alles? sind ebenso viele Häutchen im Auge, deren jedes die Strahlen anders bricht, wenn schon das anatomische Messer sie nicht finden kann.“
Wenn Goethe den Brocken besteigt, steht erneut der Konflikt zwischen innen und außen im Vordergrund. Die Natur dient Goethe als „Befestigungszeichen der Götter.“
Bei Lichtenberg äußert sich derselbe Konflikt in einer „wunderbaren Seele“, die gefangen ist, in einem verkrüppelten Körper, der ihn Zeit seines Lebens zum Außenseiter macht. Über die stürmische Überfahrt nach Helgoland, während der er sich am Mast festbinden ließ, schreibt er: „Etwas größeres habe ich nie gesehn. Das unaufhaltsame im Gantzen, die menschliche Verwegenheit und der Geist der sich hierin zeigt, verbunden mit dem Donner der Wogen denn es ist ein wahrer Donner, was man aus der Ferne hört, haben mir in Wahrheit Thränen, ich weiß nicht wie ich sie nennen soll, der Andacht, des Entzückens oder der Demüthigung vor dem grosen Urheber ausgepreßt.“
Für Humboldt bedeutet die Natur, namentlich das Meer, eine Fluchtmöglichkeit aus der Enge seiner strengen preußischen Erziehung. „Jeder Mensch ist ein Produkt seiner Eltern und der Zeit“, schreibt er, „die Natur aber ist das Reich der Freiheit.“ Diese Freiheit besteht nicht zuletzt darin, Grenzen anzugehen, der Natur zu trotzen. Der Ehrgeiz, der Erste zu sein, ist an die Stelle der Neugier einer Maria Sybilla Merian getreten. „Das, was unerreichbar scheint“, bemerkt Humboldt, „hat eine geheimnisvolle Ziehkraft; man will, dass alles erspähet, dass wenigstens versucht werde, was nicht errungen werden kann.“
Mit Chateaubriand beschreibt ein Romantiker den Vesuv. Für ihn ist „die Naturbeschreibung ein Kunstgriff, sich selbst und seinen Weltbezug auszudrücken.“ Ein Umschwung findet statt. Die kurze Phase, in der die Natur möglichst vorbehaltlos betrachtet wurde, scheint zu Ende gegangen zu sein. Nun sind es erneut die Gedanken, die die Beobachtung beherrschen.
Darwin wiederum misst alles, was er liest und selbst schreibt, an der Anschauung. Die Detailtreue seiner Beobachtung geht einher mit der Fähigkeit in, für seine Zeit ungeheuerlich, großen Zeiträumen zu denken. „Er vermag eben beides zu sehen“, schreibt Goldstein, „die imposante Präsenz der Bergwelt und ihre erdgeschichtliche Entstehung, ihre unverrückbare Statik des Augenblicks und ihren Fluss im Laufe der Jahrtausende.“
Für Edward Whymper wird der „unbezwingbare Berg“, das Matterhorn, zum persönlichen Gegner. Mit dem Absturz seines Gefährten beginnt laut Goldstein das Ende des „Goldenen Jahrhunderts des Alpinismus“.
Mit den Tagebucheinträgen von Weike liegen Aufzeichnungen eines zufälligen Reisenden vor, eines einfachen Mannes, der seinen Dienstherren bei dessen Expedition zum Nordpol begleiten muss. Sein Tagebuch liest sich für Goldstein wie ein Testfall von Wittgensteins Satz: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“
Lévi-Strauss richtet in seinen Forschungen das Augenmerk auf die Strukturen der von ihm erforschten Völker und wird somit zum Begründer der „strukturalen Anthropologie“. Auch bei ihm findet man den Willen, der Erste zu sein, in diesem Fall allerdings gefolgt von der Einsicht, zu spät gekommen zu sein und nur noch „halbverfaulte Erinnerungen“ sammeln zu können.
Handkes Beschreibung vom Sainte Victoire dienen Goldstein nicht zuletzt dazu, die Andersartigkeit und die (durch Lévi-Strauss vorbereitetet) Armseligkeit des Ausblicks nachzuweisen, die seit Petraca stattgefunden hat.
Bei Reinhold Messmer hat das Gipfelerlebnis nichts mehr mit Natur und Anschauung zu tun. Es geht nur noch um persönliche Grenzerfahrung. Goldstein schreibt: „Jeder sportliche Triumph greift hier zu kurz, geht es doch um nicht weniger als die Veränderung dessen, was als Wirklichkeit begriffen wird.“
„Der Kreis schließt sich. Der Mensch ist bei seinem Vordringen in die Natur wieder bei sich selbst angekommen.“
Was dieses Buch ausmacht, ist die Eleganz mit der der Kreis geschlossen wird, und seine Attraktivität liegt im Unterschied zu einer reinen Wissensanhäufung, der hier der Mensch als Kundschafter und Teilhaber der Natur entgegengesetzt wird.

Die Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz
Exklusivbeitrag
Jürgen Goldstein. Die Entdeckung der Natur. Etappen einer Erfahrungsgeschichte. Aus der Reihe Naturkunden herausgegeben von Judith Schalansky. ISBN 978 3 88221 992 0. 38,00 Euro. Matthes & Seitz Berlin 2013.
Elke Engelhardt hat zuletzt über »Heimliche Helden« von Ulrike Draesner auf Fixpoetry geschrieben.