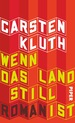Roman
Im Schatten der Macht – Carsten Kluths Politikroman hapert es an der Umsetzung
07.09. 2013 | Hamburg
Der Roman, der den Berliner Politikbetrieb überzeugend einfängt, muss noch geschrieben werden. Ein Buch wie Wolfang Koeppens „Das Treibhaus“, das virtuos mit den aktuellen Themen, Akteuren und gesellschaftlichen Bruchstellen der frühen „Bonner Republik“ jonglierte, sucht man seit der Verlegung der Hauptstadt an die Spree vergeblich. Und auch die Schnittstelle von Ministerialbürokratie und politischem Machtapparat, an der Martin Walser 1996 seinen Helden Stefan Fink („Finks Krieg“) in einen ungleichen Kampf mit dem Staatssekretär Tronkenburg – realiter der frühere Chef der hessischen Staatskanzlei, Alexander Gauland – schickte, ist mittlerweile literarisch weitgehend verwaist. Insbesondere die hauptamtlichen Romanciers scheinen das Thema Politik tunlichst zu vermeiden.
Stattdessen sind es meist (Hauptstadt-)Journalisten und Politikberater, die ihre Einsichten und Erfahrungen in mehr oder minder leicht durchschaubare Schlüsselromane verpacken. Das ist bisweilen amüsant, wie im Fall des früheren Sprechers von Lothar Späth, Manfred Zach, der in „Monrepos oder die Kälte der Macht“ (1996) seinen eigenen Aufstieg (und Fall) an der Seite des früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten karikierte; mitunter ist es aber auch peinlich, wie bei Wolfang Herles, dessen Roman „Die Dirigentin“ (2011) nur selten oberhalb der Gürtellinie stattfindet; in den meisten Fällen jedoch sind die Ergebnisse vor allem eins: nichtssagend und literarisch enttäuschend.
Das gilt leider auch für das Erstlingswerk von Carsten Kluth, der in Berlin als „Berater für Politik und Wirtschaft“ arbeitet.
Der Inhalt des Buches ist schnell wiedergegeben: Harald Kronauer, verheiratet, dreifacher Vater und Richter an einem Berliner Gericht, hat sich für Politik im Grunde nie sonderlich interessiert. Er nimmt seinen Job ernst und ist – zumindest zu Beginn des Buches – das, was man einen guten Vater nennen kann. Seine zweite Karriere als Politiker beginnt überraschend, mit einem Abschiebeurteil gegen einen Flüchtling aus Bangladesch, der aufgrund der Folgen des Klimawandels Asyl in Deutschland beantragt hatte – ein Ansinnen, das Kronauer ablehnt und anschließend in einem Zeitungsinterview begründet. Das bringt ihn in den Fokus einer ominösen Seilschaft aus Befürwortern des sogenannten „Climate Engineering“, einer Technologie, mit der das Wetter manipuliert und die Klimaerwärmung gestoppt werden soll. Jedoch haben sich vorerst die Kritiker der Technik durchgesetzt; die Bundesregierung – unter Federführung des in Nigeria geborenen Staatssekretärs im Umweltministerium Philippe Ebené – hat eine Moratorium gegen die künstliche Veränderung des Klimas erlassen. Dieses soll mit Hilfe Kronauers rückgängig gemacht werden. Eine Gruppe von PR-Beratern, Lobbyisten und Unternehmern, allesamt aus dem Dunstkreis des Altkanzlers Herschel, spannt ihn vor ihren Wagen und setzt ihn als Kandidaten der „Konservativen“ für die nächste Bundestagswahl durch. Um seine Position als Klimaexperte zu untermauern, wird Kronauer von der Firma „Rain on Demand“ (ROD), an der ein Großteil seiner Unterstützer auch finanziell beteiligt ist, auf eine Weltreise zu den Hotspots des Klimawandels geschickt. Die Ergebnisse des Trips werden in dem reißerischen Pamphlet „Die Verteidigung des Westens“ zusammengefasst, das ein Ghostwriter in Kronauers Namen verfasst. Das Buch soll der Kampagne Seriosität und den nötigen publizistischen Schub verpassen. Parallel dazu werden von den Spin Doktoren geschickt Intrigen gegen Ebené gesponnen, um den Posten des Umweltstaatssekretärs nach der Wahl mit Kronauer zu besetzen. Als dieser jedoch selbst das Opfer einer Erpressung wird, setzt er dem Treiben ein Ende und lässt die Geschichte auffliegen. Er begräbt seine politische Karriere, bevor diese richtig begonnen hat.
Kronauer ist als ein politisches Kunstprodukt gedacht, eine Marionette dunkler Mächte, die im Hintergrund des politischen Betriebs die Fäden ziehen. Geschickt entwirft Kluth die Aufstellung seiner Akteure: der Klimaunternehmer Müller, dessen Unternehmen mit dem Moratorium am seidenen Faden hängt, der PR-Manager Velkovic und die Journalistin Steinhusen, die für die mediale Präsenz Kronauers sorgen, die Netzwerkerin Steingast, mit der Kronauer nicht nur eine Affäre unterhält, sondern die auch alle sonstigen Machenschaften koordiniert. Über alledem schwebt Herschel, als Türöffner, der mit seiner Intervention Kronauer die Bundestagskandidatur sichert und obendrein, wie die anderen auch, an den Unternehmungen von ROD finanziell beteiligt ist. Inwieweit Kronauer selbst seine Lage durchschaut, bleibt bis zum Schluss unklar; ebenso die Frage, wo das echte Leben aufhört und die politische Inszenierung anfängt – etwa wenn Kronauers Tochter in der Schule wegen des Abschiebeurteils ihres Vaters gemobbt wird, was dazu führt, dass Kronauers politischer Ehrgeiz kurzfristig angestachelt wird. Das Thema ist klug gewählt; zumal es sich beim „Climate Engineering“ nicht um ein Hirngespinst des Autors handelt, sondern um einen noch jungen Forschungszweig, der in den letzten Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Unter dem Titel „Gezielte Eingriffe ins Klima?“ hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) erst vor kurzem eine Studie dazu vorgelegt, deren Ergebnisse nun in die Beratungen des Weltklimarates einfließen sollen.
An den Zutaten hat es also nicht gelegen, dass „Wenn das Land still ist“ dennoch weder ein überzeugender Politthriller noch ein hintersinniger Schlüsselroman über das politische Berlin geworden ist. Vielmehr ist es die Gesamtkomposition des Buches, die nicht überzeugt. Kluth eröffnet viel zu viele Nebenschauplätze, deren Handlungen sich nicht in das Erzählte einreihen und schließlich ins Leere laufen. Das gilt für die ominöse Beziehung von Kronauers Frau, einer Galeristin, zu einem ihrer Maler, ebenso für Kronauers Eltern, deren Rolle bis zum Schluss schemenhaft bleibt. Die Weltreise, die Kronauer an die Schauplätze des Klimawandels unternimmt, erschöpft sich nach zwei (von fünf) Stationen in einer Aneinanderreihung von Episoden, begleitet von skurrilen Zwischenfällen wie einer Bärenattacke in Sibirien und einer frittierten Spinne, die Kronauer auf einer afrikanischen Insel serviert wird. Sinn und Zweck des Ganzen für den Kontext des Buches erschließen sich jedoch nicht, abgesehen davon, dass so etliche Buchseiten gefüllt werden. Und auch als Figur überzeugt Kronauer letztlich nicht. Was zieht ihn überhaupt in die Politik? Der Wille zur Macht, das wird schnell klar, ist es nicht. Das erkennt man unter anderem daran, dass er beim ersten Widerstand, der versuchten Intrige eines dubiosen Freundes seiner Nichte gegen ihn, die Kandidatur hinschmeißt und die Politik an den Nagel hängt. Das jedoch entspricht nicht dem Typus Machtmensch, den man für gewöhnlich im politischen Geschäft vorfindet; zumal es sich bei dem Delikt, mit dem sich Kronauer vermeintlich erpressbar macht, allenfalls um eine Petitesse handelt.
Carsten Kluth hatte für sein Debüt durchaus die richtigen Ideen. Es ist ihm jedoch nicht gelungen, diese in die richtige Spur zu setzen und daraus einen kohärenten und literarisch ansprechenden Roman zu weben. Die überzeugende Berlin-Mitte Erzählung steht nach wie vor aus.
Carsten Kluth: Wenn das Land still ist. ISBN 978-3-492-05565-9 19,99 € Piper Verlag München/Zürich 2013.
Florian Keisinger hat zuletzt über Walther Rathenau - Ein jüdisches Leben in Deutschland 1867-1922 auf Fixpoetry geschrieben.
Fixpoetry 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken.