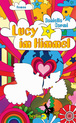weitere Infos zum Beitrag
Roman
Treffpunkt Yellow Submarine. Der israelische Roman „Lucy im Himmel“ von Daniella Carmi macht Mut.
09.09.2013 | Hamburg
Womit beginnen? Wie gibt man eine Handlung wieder, die nicht aus dieser Welt zu sein scheint und deren Protagonisten mit den aberwitzigsten Situationen zurechtkommen müssen?
Eigentlich fängt alles ganz harmlos an. Die Geschichte spielt in einem arabischen Dorf, in dem die Ich-Erzählerin Nadja mit ihrem Ehemann Salim lebt. Die beiden wollen ein Kind adoptieren und bekommen nach langer Wartezeit den dreizehnjährigen Netanel zur Pflege. Aber schon diese Konstellation hat es in sich. Denn Nadja stammt nicht nur aus einer christlichen Familie, die ihrer Ehe mit dem muslimischen Salim ablehnend gegenübersteht, nein, hinzukommt, dass Netanel ein jüdischer Junge ist. Aber auch damit sind die Komplikationen noch lange nicht zu Ende. Denn Netanels Eltern sind geschieden und die säkular eingestellte Mutter streitet sich mit dem ultraorthodoxen Vater aus der Ferne um die Erziehung ihres Sohnes. Zu Beginn dominiert der Einfluss des Vaters. Er schickt den frommen Aron zu Nadja und Salim, damit er mit dem Jungen den Talmud liest. Blöderweise klettert Netanel immer sofort auf einen Baum, wenn er Aron sieht. So kommt es, dass dieser den Moslem Salim unterrichtet, der wiederum alles dafür tut, seinem Gast koscheren Kaffee anzubieten. Soweit so gut. Dann aber erreicht sie ein Brief von einem „Vertreter der Gegenpartei“ mit der Forderung, den Jungen ohne „religiöse Elemente“ zu erziehen.
Damit nicht genug. Netanel ist ein merkwürdiger Junge, genauer gesagt hat er merkwürdige Verhaltensweisen. Anfangs spricht und isst er nichts, klettert – wie schon erwähnt – immer auf Bäume und singt Lieder, die für seine Pflegeltern unverständlich sind. Mit der Zeit finden sie heraus, dass es Beatles-Songs sind. Da seine Mutter Engländerin ist, rufen sie bei Netanel offensichtlich weit zurückliegende Kindheitserinnerungen hervor.
„Doch diesmal erreichten die Lieder Netanel, denn plötzlich fuhr er hoch und rannte zu seinem Mandarinenbaum, umarmte dessen Stamm und weinte…….In dem Lied kam immer wieder das Wort „pie“ vor; das musste so eine Art Kuchen sein, etwas Gebackenes. Ich kannte es nicht.“ Ab sofort avancieren Beatles-Songs zum Haupterziehungsmittel. Ihr Auto wird zum „Yellow Submarine“ umfunktioniert, Natja klettert selbst auf Bäume, ist Lucy im Himmel und Netanel singt über einen „sördjent“ oder eine „lejdi madonna“.
Aus Angst man könnte ihnen den Jungen wegnehmen, versuchen Nadja und Salim jede Partei zufriedenzustellen. Dadurch ergeben sich unglaubliche Situationen: „Wenn Netanel Gebetsriemen anlegte, ließen wir jetzt vorsichtshalber die Rollläden herunter. Vielleicht spionierte ja einer der Nachbarn. Man konnte nicht wissen. Und Salim schaltete den Kassettenrekorder im Hof an, damit man sein Gebet nicht hörte. So ergab es sich, dass genau wenn das Lied von John mit dem Refrain begann, dass für die piepel die Zeit gekommen sei, die pauer zu übernehmen, Netanel das „Höre“ von „Höre, Israel“ sprach. Da konnte ich nun nichts machen.“
Ein Zauber gehe von dem Buch aus, ist im Klappentext zu lesen. Das stimmt, denn das Schöne an der Geschichte ist, dass Daniella Carmi höchst unterhaltsam erzählt, ohne zu belehren. Dennoch erfährt der Leser in den ganzen Tohuwabohu sozusagen en passant einiges über Probleme in dem Land, von dem Salim sagt: „In diesem Teil der Welt ist ignorieren sowieso die beste Taktik.“ Da ist die Rede von einem Araber, der in Schutzhaft sitzt und von der Mauer, „die das Dorf von der Westbank trennt.“ Als der Junge über Nacht verschwindet, stellt Nadja fest, das „waren garantiert denen ihre Ultrafrommen, die haben Netanel mitgenommen…die sind genauso wie unsere.“ Aber – und das macht vielleicht den Zauber aus – die Autorin erzählt mit sehr viel Humor und großem Verständnis für die unterschiedlichen Gruppen in ihrem Land. Da gibt es beispielsweise noch den jüdischen Einwanderer aus Russland, der an Schabbat statt in die Synagoge in eine Kirche geht. Über ihn sagt Nadja: „Wer sind wir, ihn zu richten?“
So ist es nur folgerichtig, dass Nadja und Salim am Ende des Romans den entführten Jungen mit Hilfe eines drusischen Polizisten aus einer Talmudschule befreien und sich mit ihm in einer Schwulenkneipe verstecken. Der Roman endet genau so fantastisch wie er begonnen hat. „Zwischen den glänzenden Brüsten der Diven und Madonnen und den glühenden Hintern hat hier garantiert noch keiner, das schwöre ich dir, einen Mann und eine Frau so seelenruhig tanzen sehen, und sie umarmen einen Jungen mit einer weißen Kippa, dessen Troddeln vom Hosenbund in alle Richtungen flattern, und seine Seele singt Halleluja.“
Daniella Carmi, Lucy im Himmel, Roman. Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer, 143 Seiten, 16,99 €, ISBN 978-3-8270-1074-2, Berlin Verlag 2013
Barbara Zeizinger hat zuletzt über untitled von Joachim Bessing auf Fixpoetry geschrieben.
Fixpoetry 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken.