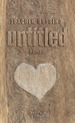weitere Infos zum Beitrag
Roman
Wenn Werther Ketamin gekannt hätte. »Untitled« von Joachim Bessing
05.08.2013 | Hamburg
Joachim Bessings Protagonist leidet an sich und an der Liebe
Was macht jemand, der unsterblich in eine unerreichbare Frau verliebt ist, dessen physische und psychische Verfasstheit von einer entsprechenden SMS oder einem Telefongespräch abhängen? Er schenkt sich und seiner Geliebten das Parfüm „untitled“, aus dem Maison Margiela. Das verspricht, laut Reklame, einen hohen Wiedererkennungswert zu haben und einen Duft, dessen Versuchung man vermutlich nicht widerstehen könne.
Doch der Reihe nach. Der Ich-Erzähler ist ein 39 jähriger Modejournalist, der von sich sagt, dass er nie studiert habe und, weil ihm zu „Krisen und Kriegen, zu Immobilienpreisen oder Sportereignissen“ nichts einfalle, nur über schöne Dinge schreiben könne. Da das Sein bekanntlich das Bewusstsein prägt, ist auch sein übriger Blick auf die Welt von seinem Beruf bestimmt und so werden die im Roman auftretenden Personen hauptsächlich durch ihr äußeres Erscheinungsbild charakterisiert. Auch vom Erzähler erfahren wir gleich auf der ersten Seite, dass er sein „Lieblingsjackett aus navyfarbenem Plastikpiquet“ trägt, sein Champagnerglas füllt und Carine Roitfeld zuwinkt. (An dieser Stelle denke ich noch, das seien meine einzigen Bildungslücken und schaue bei Wikipedia nach). Wir lesen allerdings auch bald, dass er sich in der Welt der Schönen und Reichen nicht wohl fühlt, er ständig weinen muss „angetrunken wie eigentlich an jedem Abend“ ist und Ketamin sowie andere Drogen nimmt, um sich „wieder einzukriegen.“ Der Grund für seine Verzweiflung ist eine Philosophin namens Julia (Julia Speer, wie er immer betont). Mit ihr spricht er bei einem Fest über den antiken Schriftsteller Plotin, schmiert ihr anschließend im Bad des Hausherrn Zahnpasta ins „schöne Gesicht“ und leckt sie „küssenderweise“ wieder ab. Von da an gerät sein Leben aus den Fugen. Denn Julia ist mit Frederick verheiratet. Sie will ihn nicht verlassen, aber auch die Beziehung zum Ich-Erzähler letztlich nicht missen. Und so beginnt für diesen der Leidensweg einer unklaren amour fou. Sie sehen sich selten, schicken sich aber ständig Fotos, Grüße oder Songs. Bald ist er wie besessen von ihr, kauft für sich und sie die gleichen Kleider in verschiedenen Größen, was später darin gipfelt, dass auch Frederick diese Kleidungsstücke für sich kauft, sie also zu dritt Partnerlook tragen. Alles was er hört, sieht, liest bezieht er auf Julia: „wann immer also die Welt wieder einmal drohte, gleich leer vor mir zu erscheinen, wurde ich gerettet durch Beweise ihrer Anwesenheit. Dann fuhr ein Lastwagen an mir vorbei, das Logo der Spedition bestand aus einem besonders auffällig gestalteten J…, im Schaufenster der Parfümerie war ein übergroßer Flakon Untitled dekoriert…“
Er ist ausschließlich mit sich und seinem Herzschmerz beschäftigt. Mehrmals will man ihm als Leser zurufen, dass es nun aber gut sei, aber als seine Sekretärin genau das macht, kündigt er ihr die Freundschaft. Kein Wunder, dass er seinen Job im Verlagshaus verliert und nach Australien zum ersten Mal Economy Class fliegen muss. Dorthin ist er Julia nachgereist und wird kurz vor dem Wiedersehen bei einem Unfall schwer verletzt. Auch das bringt Julia nicht dazu, sich in die eine oder andere Richtung zu entscheiden. Sie ist inzwischen von Frederick schwanger, allerdings bleibt es bei dieser Feststellung und ein geborenes oder abgetriebenes Kind wird im Verlauf des Romans nicht weiter erwähnt. Der Erzähler lässt sich schließlich für eine Weile in Frankreich nieder, wo er seine ganze Energie in ein Gemälde steckt, das er von sich und Julia malen will. Dabei lässt er sich von Vermeer und Jan Van Eyck beeinflussen und dieses Festhalten an Vorbildern ist nur ein Beispiel, weshalb dem Leser schon sehr früh nicht nur wegen der gleichen Dreieckskonstellation Goethes Werther einfällt. Wie dieser ist der Erzähler extrem ichbezogen und mit einer Ausnahme unfähig zu sozialen Kontakten, so dass ihm zeitweise nur seine Therapeutin bleibt. Auch dramatische Ereignisse außerhalb seiner Endlosschleife werden nur unter dem Gesichtspunkt erwähnt, was sie mit ihm zu tun haben. Im Zusammenhang mit einem bestimmten Weiß, das er für sein Gemälde benötigt schreibt er: „Die Hautfarben mischte ich aus japanischem Weiß, das aus den jahrelang gelagerten Schalen von Austern gewonnen wurde. Der Preis zog seit Fukushima streng an…“ Für jede Lebenslage zitiert er Bücher, Filme, Musik, Modemacher und/oder Autoren, als müsse er seine Aussagen jedes Mal von einer Autorität bestätigen lassen. Man merkt, dass der Autor Joachim Bessing ein sehr gebildeter Mensch ist, fragt sich aber, ob er seinen Helden damit nicht überfrachtet. Denn wann sollte dieser sich bei seinem Lebenslauf und Lebenswandel derart intensiv mit der gesamten Pop- Film- und Literaturgeschichte befasst haben? Den Bezug zu Werther liefert Bessing allerdings selbst. Gegen Ende des Romans sieht der Erzähler einen Motorroller, der ein „Sondermodell namens Werther“ ist und kurz danach fällt auch der Name „Klopstock“. Im Gegensatz zu Goethes Helden bringt er sich allerdings nicht um, weil er Angst hat als Toter keine bella figura zu machen. Er trifft sich mit Julia. Was auch sonst.
Joachim Bessing, untitled, Roman, ISBN 978-3-462-04517-8, 19,99 €, Kiepenheuer&Witsch Köln 2013
Barbara Zeizinger hat zuletzt über »Wie keiner sonst« von Jonas T. Bengtsson auf Fixpoetry geschrieben.
© Fixpoetry.com 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com
Sie können diesen Beitrag gerne verlinken