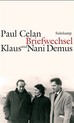weitere Infos zum Beitrag
Briefe
Der Dichter und seine Bewunderer – Paul Celans Briefwechsel mit Klaus und Nani Demus
Als Celan Ende 1952 die Pariser Künstlerin Gisele Lestrange geheiratet hatte, nahm sein Briefwechsel mit den treuen Wiener Freunden, die jedes seiner Werke mit beinahe bedingungsloser Begeisterung aufnahmen, zunehmend den freundlichen Ton familiärer Mitteilungen an, erhebt sich über weite Strecken kaum über dieses Niveau. Erst als die Goll-Affäre - die Witwe des Dichters Yvan Goll bezichtigte Celan des Plagiats an Texten ihres Mannes – immer stärker in den Briefwechsel mit Demus hineinwirkt und den bis dahin freundschaftlichen Grundton der Schreiben immer mehr verdüstert, wird die Lektüre des Bandes wieder spannender, zugleich auch der Anteil der Celanschen Schreiben größer, ihr Inhalt gewichtiger. Tatsächlich erlebt man als erschrockener Leser mit, wie sich der Dichter immer mehr in einen Verfolgungswahn hineinsteigert, überall Missgunst und Schlimmeres wittert, jede auch nur halbwegs kritische Formulierung von Rezensenten als bösartig und charakterlos hinstellt und bei angeblich gegen ihn gerichteten „Kampagnen“ nur mehr oder minder verkappte Antisemiten oder eben „Nazis“ am Werk sieht.
Als schmerzlichste Wunde empfand es der Dichter, dass die Authentizität seiner „Todesfuge“ von einigen wenigen Parteigängern Claire Golls bestritten und damit gewissermaßen die Grabstätte seiner im KZ umgekommenen Mutter geschändet wurde, die er ihr seinem Gedicht errichtet hatte. Speziell über diesen Punkt kam er nicht hinweg, verlor seit Beginn der 60er Jahren mehr und mehr seine psychische Selbstkontrolle, was zu ersten Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken führte. Diese dramatische seelische Entwicklung konnte auch seinem Bewunderer Demus nicht verborgen bleiben. Er folgte noch lange den immer dringlicher werdenden brieflichen Wünschen seines Freundes und engagierte sich für ihn in der Goll-Affäre, versuchte die daran Beteiligten im Sinne des Dichters zu beeinflussen und verfasste auch ein von Celan inspiriertes Papier, das die Gegner ein für alle Mal mundtot machen sollte. Es war allerdings wenig schlagkräftig formuliert und verfehlte seine Wirkung vollkommen.
Die Entwicklung kulminierte am 17. Juni 1962 in einem Schreiben von Demus, worin er nach Beteuerungen seiner „Liebe“ dem Dichter seinen „ganz gewissen Verdacht“ eröffnete, dass Celan „an Paranoia“ erkrankt sei. Das war für den Betroffenen etwa so hilfreich wie der Zuruf an einen ertrinkenden Nichtschwimmer, er möge doch bitte die vorgesehenen Arm- und Beinbewegungen ausführen. Dieser schlagende Mangel an Einfühlungsvermögen in die tatsächliche Situation, der eben alles andere als einen wirklichen Freundschaftsdienst bezeugt, führte dann fast zwangsläufig dazu, dass Celan die Beziehung sofort abbrach und jahrelang schwieg. Erst seit dem Dezember 1968 gab es wieder ein paar Antworten auf briefliche Vorstöße von Demus, aber nach innen hin blieb das Verhältnis nachhaltig zerstört.
Fragt man sich am Ende der Lektüre dieses umfangreichen Bandes, was der Ertrag des Briefwechsels ist, wird man zu dem nüchternen Fazit kommen, dass es sich bei den beiden Schreibenden doch um sehr ungleiche Partner handelt und dass ihre Freundschaft schon deshalb ein halbes Missverständnis war, weil Celans Judentum und seine spezielle seelische Konstitution fast überhaupt nicht thematisiert wurden. Das konnte letztlich nicht gut gehen, und statt eines Bewunderers wäre dem Dichter wohl eher ein Mensch dienlich gewesen, der es zu einem wirkliches Verständnis seiner Besonderheiten gebracht hätte.
Der Briefwechsel wurde von Joachim Seng,, dem Leiter des Bibliothek des Freien Deutschen Hochstifts in Frankfurt, sehr sorgfältig ediert, die Kommentierung der Schreiben auf 250 Seiten lässt kaum Wünsche übrig und ist etwa derjenigen in dem Briefwechsel zwischen Celan und Ingeborg Bachmann weit überlegen. In seinem Nachwort sieht Seng die Rolle von Demus zu wohlwollend, aber das mag auch diplomatische Gründe haben, denn schließlich hatte er es mit einem noch lebenden Beteiligten zu tun.
Als schmerzlichste Wunde empfand es der Dichter, dass die Authentizität seiner „Todesfuge“ von einigen wenigen Parteigängern Claire Golls bestritten und damit gewissermaßen die Grabstätte seiner im KZ umgekommenen Mutter geschändet wurde, die er ihr seinem Gedicht errichtet hatte. Speziell über diesen Punkt kam er nicht hinweg, verlor seit Beginn der 60er Jahren mehr und mehr seine psychische Selbstkontrolle, was zu ersten Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken führte. Diese dramatische seelische Entwicklung konnte auch seinem Bewunderer Demus nicht verborgen bleiben. Er folgte noch lange den immer dringlicher werdenden brieflichen Wünschen seines Freundes und engagierte sich für ihn in der Goll-Affäre, versuchte die daran Beteiligten im Sinne des Dichters zu beeinflussen und verfasste auch ein von Celan inspiriertes Papier, das die Gegner ein für alle Mal mundtot machen sollte. Es war allerdings wenig schlagkräftig formuliert und verfehlte seine Wirkung vollkommen.
Die Entwicklung kulminierte am 17. Juni 1962 in einem Schreiben von Demus, worin er nach Beteuerungen seiner „Liebe“ dem Dichter seinen „ganz gewissen Verdacht“ eröffnete, dass Celan „an Paranoia“ erkrankt sei. Das war für den Betroffenen etwa so hilfreich wie der Zuruf an einen ertrinkenden Nichtschwimmer, er möge doch bitte die vorgesehenen Arm- und Beinbewegungen ausführen. Dieser schlagende Mangel an Einfühlungsvermögen in die tatsächliche Situation, der eben alles andere als einen wirklichen Freundschaftsdienst bezeugt, führte dann fast zwangsläufig dazu, dass Celan die Beziehung sofort abbrach und jahrelang schwieg. Erst seit dem Dezember 1968 gab es wieder ein paar Antworten auf briefliche Vorstöße von Demus, aber nach innen hin blieb das Verhältnis nachhaltig zerstört.
Fragt man sich am Ende der Lektüre dieses umfangreichen Bandes, was der Ertrag des Briefwechsels ist, wird man zu dem nüchternen Fazit kommen, dass es sich bei den beiden Schreibenden doch um sehr ungleiche Partner handelt und dass ihre Freundschaft schon deshalb ein halbes Missverständnis war, weil Celans Judentum und seine spezielle seelische Konstitution fast überhaupt nicht thematisiert wurden. Das konnte letztlich nicht gut gehen, und statt eines Bewunderers wäre dem Dichter wohl eher ein Mensch dienlich gewesen, der es zu einem wirkliches Verständnis seiner Besonderheiten gebracht hätte.
Der Briefwechsel wurde von Joachim Seng,, dem Leiter des Bibliothek des Freien Deutschen Hochstifts in Frankfurt, sehr sorgfältig ediert, die Kommentierung der Schreiben auf 250 Seiten lässt kaum Wünsche übrig und ist etwa derjenigen in dem Briefwechsel zwischen Celan und Ingeborg Bachmann weit überlegen. In seinem Nachwort sieht Seng die Rolle von Demus zu wohlwollend, aber das mag auch diplomatische Gründe haben, denn schließlich hatte er es mit einem noch lebenden Beteiligten zu tun.
Originalbeitrag
Paul Celan: Briefwechsel mit Klaus und Nani Demus. Herausgegeben und kommentiert von Joachim Seng. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 2009