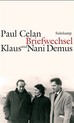weitere Infos zum Beitrag
Briefe
Der Dichter und seine Bewunderer – Paul Celans Briefwechsel mit Klaus und Nani Demus
In demselben Maße wie Literaturwissenschaftler nach dem Tode Paul Celans im Jahr 1970 über dessen Lyrik interpretierend hergefallen sind, scheint der Einfluß des Dichters auf die Generationen nachfolgender Autoren geschwunden zu sein. Die Germanisten haben seine schwer zugänglichen Texte durch die Mangel ihrer diversen „Ansätze“ gedreht, ohne wirklich „Land zu sehen“, und die immer wieder herangezogene „Todesfuge“ ist gar Pflichtlektüre an den Schulen, aber ansonsten gilt Celan nicht wenigen Zeitgenossen, die sich überhaupt noch für Gedichte erwärmen können, als ein verglühter Stern. Im Kontrast zu dieser Einschätzung scheint die Tatsache zu stehen, dass laufend neue Bände mit Briefen des Dichters ediert werden. Dem Band „Herzzeit“ mit der Korrespondenz zwischen Ingeborg Bachmann und Celan, worin erstmals die Liebesbeziehung der beiden Autoren dokumentiert wird, hat der Suhrkamp Verlag im letzten Jahr den Briefwechsel zwischen Celan und Klaus Demus sowie dessen Frau Nani folgen lassen.
Das sind freilich Namen, die nur Fachleuten etwas sagen, und in dieser Tatsache liegt auch ein Dilemma des Bandes begründet. In der umfangreichen Celan-Sekundärliteratur ist Klaus Demus nur eine Nebenfigur, als Lyriker hat er wenig Beachtung gefunden, und auch als Wiener Kunsthistoriker, der er dem Brotberuf nach war, konnte er nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Was ihn hingegen auszeichnet, ist seine sehr frühe Bekanntschaft mit Celan, in die auch seine Frau einbezogen war, und seine Rolle als beinahe unerschütterlicher Bewunderer der Gedichte seines Freundes. Das drückt sich in der seit Mitte 1948 geführten Korrespondenz etwa auch darin aus, dass auf einen Brief Celans mehrere von Demus kommen, die gewöhnlich auch sehr viel länger als die des Dichters sind. Erst auf Seite 54 stößt der Leser bezeichnenderweise auf die ersten wirklich substantiellen Äußerungen Celans.
Hat man sich durch manche länglichen Ausführungen von Demus hindurchgelesen, wird einem noch klarer, dass man sich ganz einseitig nur für die eine Seite dieses Briefwechsels interessiert, für den das Wort Korrespondenz eigentlich unangemessen ist, denn von wirklicher Übereinstimmung oder gar Entsprechung kann bei den beiden Partnern – ungeachtet gegenseitiger Freundschaftsbekundungen – in einem tieferen Sinne nicht die Rede sein. Celan ließ sich die bewundernden Äußerungen des 1927 geborenen Demus, der mithin sieben Jahre jünger war als er, gern gefallen und geizte mitunter auch nicht mit Anerkennung für dessen Gedichte, was seinem kritischen Vermögen kein besonders gutes Zeugnis ausstellt.
Von diesen mehr als problematischen Texten wurden etliche dem Band beigegeben, vermutlich eine Konzession an den noch immer in Wien lebenden Demus, der der Publikation ja zustimmen musste. Seine lyrischen Hervorbringungen wirken besonders in der frühen Phase wie unfreiwillige Parodien von Celan-Gedichten, bedienen sich des nämlichen Metaphern-Repertoires, sind noch beliebiger in ihren hergeholten Assoziationen und neigen zu allem Überfluss zu strapaziösem Ausufern. Übrigens gibt es etliche Briefstellen, an denen Demus selbst zu der Einsicht gelangt, dass es mit der Originalität seines lyrischen Schaffens nicht weit her ist, und immer wieder klagt er darüber, dass er mit seinen Gedichten nicht vorankomme.