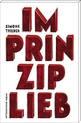weitere Infos zum Beitrag
Roman
Die Rotweinfahne im Wind - Simone Trieder entdeckt die Scheinheiligkeit des Stadtbewohners
Mit dem Einerlei der immer wiederkehrenden Tage ist nicht gut Kirschen essen. Was lange als schöne Alternative erscheint, entpuppt sich mit zunehmendem Grau-Status als quälend und öde, ja, nicht selten als Ein-Öde dessen, was als Lebensentwurf noch darunter liegen mag. Der innere Kreis der Rituale in der Provinzgroßstadt, wie sie Simone Trieder in ihrer Erzählung „Im Prinzip lieb“ beschreibt, erzeugt Überdruss und entweder die Verfügung ins nicht zu Ändernde oder aber gerade den Willen nach Veränderung. Oft allerdings bleibt der zaghafte Wunsch die Mutter des Gedankens, und sonst passiert nicht viel. Allenfalls ein paar verstiegene Dialoge auf irgendeiner Party sind zu bewundern, wie die Verfasserin, lächelnd und ihres – fiktiven, wohlgemerkt – Stoffes gewiss, im Gespräch anmerkt.
„Ich überlege, ob ich weggehe“, sagt Graf ziemlich am Anfang des Buches; und doch findet sich die Hauptperson des Geschehens immer an den nämlichen Stellen wieder ein, beobachtet die Nöte und Pseudo-Nöte der andern, sorgt sich, vermittelt und hat häufig das Gefühl, dass er dabei selbst auf der Strecke bleibt. Allein, die repetive Wiederholungsschleife der Gepflogenheiten dieser Stadt von, sagen wir es unumwunden, eindeutig hallescher Prägung hält ihn; und, teils aus Bequemlichkeit, teils weil es ihm an Mumm und Ideen mangelt, trauert der Graf seinem Ausbleiben der Möglichkeiten nach und bleibt missmutig ‚am Ball‘.
Etwas anders Felix und Iv, die es irgendwie ‚geschafft‘ haben und aber viel mehr noch zu den Staubfängern ihrer Ideale geworden sind. Inmitten einer funktionierenden Ehe und eines sich jüngerhaft scharenden Freundeskreises kommt ihnen ihre pubertierende Tochter abhanden, treibt sich mit den Straßenkids herum, zu denen der Stadt, ihrem Politklüngel, nichts Besseres einfällt, als ihnen feierlich eine Waschmaschine zu schenken. Es nützt einem die schönste und geradlinigste Herangehensweise ans Leben nicht viel, wenn sie einem dabei zusehends verwässert. Gegen das Aufbegehren der Tochter hängt Felix die Rotweinfahne in den Wind, während sich Iv in unaufgeregter Lässigkeit übt und letztlich Recht behält.
In all dem spielt Graf die Rolle des Mediators, wenngleich diese ihm alles andere als liegt. Auf Vivians, der Tochter, nassforsches Anerbieten reagiert er grob – für sie ist es die erste anständige Kommunikation seit langem. Von Felix muss er sich, nachdem er die Erinnerung an ihre gute alte Zeit beschworen hat, dessen oberflächlich-süffisanten Quark anhören. Iv, die von allen Bewunderte, ist mit ihrem Erfolg und ihren Ausstellungen beschäftigt, vom Nutzen ihrer ‚Erziehungsmaßnahmen‘ bleibt sie bis zum Showdown der Geschichte überzeugt. Im Gegensatz zu Iv und Felix sehnt sich Graf, der mit einer zerbrochenen Beziehung und einigen aufwändigen Affären befasst ist, offenbar nach familiärer Nähe, wissend, dass er sie weder bei seinen Freunden noch bei seiner Arbeit für das Provinzblatt bekommt.
„Die Figur der Vivian ist wichtig für mich, einerseits als Gegenpart zu Graf, andererseits als Rückkehrerin, die sich Möglichkeiten offenhält“, meint Simone Trieder, deren literarisches Forschungsgebiet die Suche nach den Verwischungen und Brüchen in der Jetztzeit ist. Die Hallenserin, die fürs Theater und als freie Journalistin arbeitete und sich überregional auch einen guten Ruf als Sachbuchautorin erwarb, zeichnet in „Im Prinzip lieb“ ein triftiges, zuweilen holzschnittartiges Sittengemälde einer verlorenen Generation. Diese sehe schon lange nicht mehr, was aus ihren eigentlichen Plänen geworden ist, und ergehe sich in abgeklärter Scheinheiligkeit. „Ich verurteile keinen“, sagt die Autorin, auf kritische Umtriebe im Buch befragt; vielmehr sei es ihr wichtig, den Finger in die Wunde zu legen, wo sich das Leben durch Alltag und Saumseligkeit abschleift und der Selbstlauf Kapriolen schlägt: mit den Mitteln der Satire oder dem Anschein der Nachvollziehbarkeit.
Frappierend und reizvoll ist dabei, dass nicht nur dem aufmerksamen Betrachter dieser Typ des Durch-die-Welt-Kommers nah und vertraut ist. Man kann ihn auf den Kneipenmeilen, in den sich mehrenden Galerien der Stadt, den angesagten Vierteln des Metropölchens bewundern. Er soll auch schon in dem einen oder anderen Spiegel endeckt und erkannt worden sein. Nach dem Wiedererkennungswerten befragt, antwortet Simone Trieder: „Es gibt schon konkrete Orte im Buch, ich denke aber, sie müssen hier nicht zwingend benannt sein.“ Interessant sei, dass es von Hallensern wie Bewohnern der einen oder anderen ‚Fremdgegend‘ als Schlüsseltext gelesen wird: „Das ist doch ein schöner Effekt.“
Der schleichende Verlust der ‚guten Vorsätze‘ und die Resignation angesichts der äußeren Umstände – das mag kein speziell hallesches Phänomen sein, auch weil es ein geradezu alle Gesellschaftsbereiche erfassendes Problem beschreibt. Allerdings ergibt sich aus der Situation der Stadt, ihrem Zwiespalt und ihrer Unentschlossenheit, ein regelrechter Nährboden für eine solche Geschichte. Die Schlüsselszenen, vom Illustrator Robert Voss wunderbar ins Bild gesetzt, verströmen dabei ein so betörendes wie entlarvendes Bukett des Stillstands und des immer wieder versuchten und – im Keim erstickten Aufbruchs.
Am Ende wendet sich alles wie von selbst, und Graf kann endlich nach Hause. Ob es für ihn eine wirkliche Befreiung sein wird oder die Fortsetzung der Unverbindlichkeit, die sein Leben bestimmt, bleibt offen und fällt der Erschöpfung der Akteure anheim. Die eigentliche Rebellin des Buches, Vivian, knickt ein. Sie begibt sich, aus Bequemheit und Gewohnheit, in den Dunstkreis der aufgeklärten Vernunft zurück. Sie bewahrt sich so ihre Chance für eine neue Rebellion oder, was wahrscheinlicher ist, den Wandel von der pubertären Aufrührerin zum Mitglied einer neuen und letztlich wieder verlorenen Generation.
Simone Trieder: Im Prinzip lieb. Erzählung, mit Illustrationen von Robert Voss. Mitteldeutscher Verlag, Halle 2007.