

(Esther Dischereit; foto © Sabine Groschup)
Esther Dischereit: “Partikel vom Grossgesichtigen Kind”
8-Kanal-Klang-Installation, kuratiert von Georg Weckwerth
TONSPUR für einen öffentlichen Raum 63 / 2014 (Wien, MuQua)

(v.l.n.r.: Stefanie Hoster/Deutschlandradio, Esther Dischereit/Institut für Sprachkunst, Georg Weckwerth/Tonspur, czz; foto © Sabine Groschup)
Opening 24. 8. 2014, Einführung, Christiane Zintzen:
“Partikel vom Grossgesichtigen Kind”. Esther Dischereits Anatomie institutioneller Gewalt¹
(ein fünf-puncte-programm)
1. PSYCHIATRIE
Hand in Hand mit der aufdämmernden Moderne wurden die “Nachtseiten der Seele” entdeckt. Waren diese “Nachtseiten”, das “Abgründige” für die Literatur, für die Kunst, für die Geistesgeschichte äusserst produktiv und prägend, zog die psychiatrische Forschung rasch nach und trat einen enormen Höhenflug an, welcher bis in die Nachkriegszeit reichte.
Seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschland, Österreich und dessen Kronländern unzählige psychiatrische Krankenhäuser gebaut.
Das ging bis in die Jahre nach 1918, wo die Ärzte auf Druck der Versicherungen Methoden suchten zur Unterscheidung von traumatisierten sog. “Kriegszitterern” und sog. “Simulanten”, die es angeblich lediglich auf die Prämien abgesehen hatten.
Dann trat im Besonderen die eugenische Forschung hervor, die in vielerlei Hinsicht den Boden bereitete für das berüchtigte NS-Programm “T4″ zur sog. “Euthanasie”, welcher Tausende von Patienten zum Opfer fielen. In der Wiener Anstalt “Am Steinhof”, die man nun neu nach dem Flurnamen “Am Spiegelgrund” benannte, waren dies im hohen Masse Kinder.
Ihre post mortem entnommenen Gehirne begründeten die steile Karriere der Hirnforschung. Noch in den neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurden Präparate, die vom “Spiegelgrund” stammten, in einschlägigen Forschungslaboren entdeckt.
Wenn Esther Dichschereit als Schauplatz ihrer Text- und Sound-Installation das Gelände einer psychiatrischen Anstalt wählt, begibt sie sich also auf einen symbolisch wie historisch hoch prekären Boden.
Das titelgebende “Grossgesichtige Kind” ist allerdings keine Patientin dieser Klinik, sondern lebt in der – auch für den Wohnraum des Anstaltsleiters vorgesehenen – Verwaltungsvilla.
Wir erfahren über die Psychiatrie nur das, was dieses kleine Mädchen mit dem “Grossen Gesicht” im Areal der Anstalt beobachtet. In 19 kurzen, jäh aufleuchtenden Szenen gestaltet Esther Dischereit ein Panoptikum der kindlichen Wahrnehmungen. Ein Panoptikum freilich, welches eigentlich nur aus winzigen Mosaiksteinchen momentaner Beobachtungen besteht: das Verwaltungsgebäude (übrigens das einzige Haus ohne Gitter). Der Park. Die elterliche Wohnung.
|||
2. INDIZIEN
Und doch ist diesen erratischen, dem Kind meist unerklärlichen Beobachtungen eine eminente Menge von Indizien und Informationen eingeschrieben: Unverkennbare Anspielungen evozieren die von Otto Wagner geplante und ästhetisch durchformte Riesenanstalt “Am Steinhof”.
Aus Indizien hinsichtlich Kleidung, Haartracht, nicht zuletzt mit Hilfe von Zeichen des Zeitgeschichtlichen, können wir das Geschehen in den frühen 50er Jahren situieren. Mit der Diskretion des Indirekten gibt uns Dischereit auch zu verstehen, dass und welche Gewaltzusammenhänge diesen Ort beherrschen.
So zielt der Hinweis auf langgediente Ärzte – und ebensolches Personal – auf die nur ungenügend geahndeten “Euthanasie”-Verbrechen. Und auf die personelle Kontinuität über das Kriegsende hinweg und in der jungen Republik.
Mit dem wie nebenbei eingestreuten Namen Hans Globke wird diese Ahnung zur Sicherheit: Stellt doch der deutsche Verwaltungsjurist im NS-Reichs-Innenministerium (auf den u.a. die Konkretisierung des Nürnberger Gesetzes 1935 zurückgeht) ein Paradebeispiel dar für personelle Kontinuitäten im Deutschland der Adenauer-Zeit. Kontinuitäten, wie sie Wolfgang Koeppen in seine Romantrilogie “Tauben im Gras”, “Das Treibhaus” und “Der Tod in Rom” (1951-54) beklemmend kenntlich gemacht hat. Der Aufstand gegen die politisch-wirtschaftliche Macht dieser “Alten” wurde wiederum zum Gründungsmythos radikaler Gruppen wie der RAF.
Dischereits Evokation häuslicher Gewalt seitens des Familienvaters gegenüber seiner (jüdischen) Frau und (jüdischen) Tochter, räumt jeden Zweifel vollends hinweg: Die Psychiatrie – sei es “Am Steinhof” – sei es jede andere psychiatrische Einrichtung, ist Ort von zyklisch wiederkehrender Gewalt.
|||
3. VERWAHRT, VERKOMMEN, VERSEHRT
Es ist, als wäre es diese “totale Institution” (Erwing Goffman), welche den Wiederholungszwang von Gewalt regelrecht produziert (was, cum grano salis, auch andere Institutionen gilt: Kasernen, Internate, Klöster, Kliniken):
Als wäre der Topos der Psychiatrie mit ihren oft wenig zarten “Heilmethoden” nicht bereits hinreichend belastet, legen sich, Schicht um Schicht, Zeit um Zeit, neue Formen von Gewalt über die Szene. Die Spuren graben sich in Menschen ein, nicht aber in die Architektur.
- Als sei der Notstand während des Ersten Weltkriegs, da Dutzende von Patienten in der menschenunwürdig doppelbelegten Anstalt (8.000 statt 4.000 Patienten) an – Auszehrung zugrunde gingen, nicht genug.
- Als hätte das Syndrom der “Euthanasie” während der Zweiten Weltkriegs das Mass an Gewalt nicht schon vollgemacht.
- Als hätten die brutalen Umstände der völligen Entrechtung von Patienten nicht weit bis in die 70er Jahre gereicht.
- Als wären nicht bis in die 2000er Jahre Menschen infolge paradoxer Medikation einen fragwürdigen Tod gestorben.
- Als hätten – ebenfalls noch über die Jahrtausendwende hinaus – im Innern der Pavillons nicht katastrophale Zustände geherrscht. (Was für die – durch Thomas Bernhard nobilitierte – Pulmologie im westseitigen Teil des Areals übrigens gleichermassen gilt.)
|||
4. LEITMOTIV
Esther Dichereit hat ein sensibles Gespür für solche Gewaltzusammenhänge. Sie hat den Text für die Klang-Installation “Partikel vom Grossgesichtigen Kind” dicht mit szenischen Indizien durchwirkt: Zerbrochenes Glas. Ein einzelner Schuh. Die alles Lebendige schluckende Architektur.
Der musikalische Sound dieser Installation parallelisiert Esther Dischereits leitmotivisches System. Da sind: Die in den Korridoren klatschend hallenden Schritte des “Grossgesichtigen Kindes“. Stets rennend, stets laufend, stets springend, orchestrieren diese Schritte immer wieder neu den Wunsch nach Flucht. Da sind: Die elektronisch verfremdeten und verzerrten Klänge, die der Komponist Frank Wingold auf Basis einer Gitarre entwickelt hat.
Diese Sounds durchlaufen verschiedene Metamorphosen: Da ist ein metallisches Lauten wie dasjenige eines präparierten Klaviers. Da ist der trügerische Frieden der “cleanen”, fast wie Holzblasinstrumente klingenden, Melodiebögen. Da ist der krachende Klang von Hardrock oder Punk, rau und in Obertöne zersplitternd.
|||
5. PLEIN AIR
Auffallend ist: Hörinstallationen wie Esther Dischereits akustisches Shoa-Denkmal in Dülmen (seit 2008) oder die Installation, die wir hier antreffen, befinden sich in einem öffentlichen Raum. Und sozusagen unter freiem Himmel.
Damit wird – anders als in institutionellen und für die Sound-Darbietung optimierten Räumen – kein geringes Mass an Stör-Signalen in Kauf genommen. Verkehr. Menschen. Witterung.
In diesem Preisgeben der Audio-Installation an den Öffentlichen Raum leistet Esther Dischereit einen zwiefachen Verzicht:
1. verzichtet sie auf die wiederholte Gruppierung eines tendenziell “idealen”, fachlich und sachlich versierten Publikums. Womit sie
2. auch die Steuerung langfristiger Rezeption aus der Hand gibt.
Was Sie nun hören, ist also keine Preziose, eingeschweisst in ein ästhetisches Vakuum.
Vielleicht sollten wir dieses dezidiert non-museale Wagnis gerade hier, mitten im Wiener Museumsquartier, ganz besonders deutlich wahrnehmen und wertschätzen.
Hören Sie nun: “Partikel aus dem “Grossgesichtigen Kind’“. Hören Sie: 19 abgezirkelte Szenen (und drei Refrains). Hören Sie: ein Extrakt aus einem grösseren poetischen Projekt. Hören Sie: Die Verwandlung von Prosa in eine Klanginstallation.
Hören Sie: Die Komposition von Frank Wingold. Hören Sie: Stefanie Hosters Regie. Hören Sie: Esther Dischereit und Markus Meyer als Sprecher. Hören Sie: “Das Grossgesichtige Kind” in den verlorenen Korridoren der Psychiatrie.
Hören Sie.
Hören Sie zu.
|||
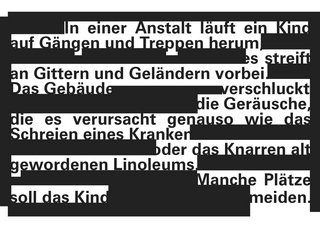
¹Esther Dischereits Buch “Das grossgesichtige Kind” erscheint November 2014 (mit Beiheft zur Klanginstallation) im Birkhäuser-Verlag, Basel
|||
Links:
- Esther Dischereit: Wikipedia | home | Institut für Sprachkunst @ Angewandte Wien
- TONSPUR für einen öffentlichen Raum 63 / 2014 (Wien, MuQua)
- czz @ NZZ 2010, Esther Dichereits Klanginstallation zur Shoa in Dülmen (D): Akustisches Denkmal
|||
- von Christiane Zintzen
in in|ad|ae|qu|at
