
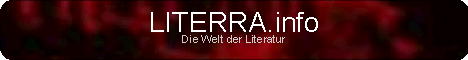
|
|
Startseite > Bücher > Mystery > Bastei > Adrian Doyle > DAS DORF DER TOTEN > Leseproben > Das Dorf der Toten |
Das Dorf der Toten
| DAS DORF DER TOTEN
Adrian Doyle VAMPIRA: Band 10 Sep. 2011, 1.60 EUR |
Llandrinwyth, 1727
Die Zeit der "Zwölften"
Owain Glyndwr überwachte die Säuberung des Taufsteins mit einem Gefühl nie nachlassenden Unbehagens. Der Geistliche war in der Nacht mehrfach schweißnass aufgewacht, ohne eine Ursache dafür zu finden. Er litt normalerweise nicht unter Störungen dieser Art.
Das Kirchenamt in Llandrinwyth bekleidete er nun schon seit über zwanzig Jahren. Eine ausreichende Zeit, um sich hilfreiche Routine anzueignen. Die anstehende Weihnachtsmesse war es demnach also keinesfalls, was ihn aus der Ruhe brachte. Auch jenes zweite Ereignis nicht, zumal er nachts davon noch gar nicht hatte wissen können...
In früher Morgenstunde dieses ersten der "Zwölften" hatte ein temperamentvolles, schon bei der Geburt blondgelocktes Mädchen das Licht der Welt erblickt. In einem kleinen Ort wie Llandrinwyth kein alltägliches Ereignis, weshalb Owain Glyndwr gemeinsam mit dem Vater auch spontan entschieden hatte, die Taufe dieses neuen Erdenbürgers in die Abendmesse einzubinden.
Die Mutter lag natürlich noch im Kindsbett, und Owain Glyndwr war darauf gefasst, ihr – früher noch vielleicht als diesem siebten ihrer Kinder die Taufe – die Sterbesakramente abnehmen zu müssen. Als er dem Haus gegen Mittag seinen Besuch abgestattet hatte, war die Frau nicht ansprechbar gewesen. Das Fieber hatte gelbe Stockflecken in ihr ohnehin verhärmtes Gesicht gemalt, und der schwüle Glanz ihrer Augen verriet, dass sie ahnte, wie es um sie bestellt war.
Der Geistliche schluckte einen Kloß hinunter, der ihn – bei aller "Routine" – in solchen Momenten immer noch überkam. Aber er war sicher, dass auch dies letztlich nicht der Grund des klammen Unbehagens war, das ihn während der Nacht gepeinigt hatte.
"Wir sind fertig", riss ihn eine Stimme aus den trüben Gedanken. Sie gehörte einer der Dorffrauen, die er zu Vorbereitungsarbeiten der geplanten Festlichkeit verpflichtet hatte. "Können wir jetzt gehen?"
Owain Glyndwr nickte, ohne sich – wie es sonst seine Art war – genau zu vergewissern, ob auch alles seinen Vorstellungen entsprach. Mit einer Geste der Linken entließ er die Helferinnen nach Hause, während seine Rechte den Saum der Robe entlangfuhr, als läge dort eine Erklärung für die außergewöhnliche Stimmung, die ihn befallen hatte.
Er wartete, bis die Frauen ihr Werkzeug zusammengerafft und das Kirchenschiff verlassen hatten. Dann wandte er sich selbst dem Ausgang des Gotteshauses zu. Es verkörperte spätgotische Schlichtheit und besaß nicht annähernd den Prunk der großen Kathedralen wie Bangor oder Llandaff.
Owain Glyndwr bedauerte dies jedoch nicht wirklich. Er war zufrieden mit seiner Gemeinde, die im ganzen – diesen neuen Erdenbürger mitgerechnet – nun gerade siebenhundertneunundsechzig Seelen zählte. Er bedauerte auch nicht, als gottesfürchtiger Mann denselben Namen zu tragen wie einer der letzten großen walisischen Helden und Nachfahren der Fürsten Llewellyn.
Als er jetzt vor die Tür trat, roch die Luft, die sich schwer von den geröllbedeckten Hügeln ins fruchtbare Tal senkte, nach baldigem Schnee. Der Himmel war wolkenverhangen und von bleierner Färbung. Kälte trieb weiße Fahnen von Owain Glyndwrs Lippen. Sie verflüchtigten sich wie arme Seelen, die aus den Körpern von Sterbenden hoffnungsvoll in die Obhut des Allmächtigen zurückkehrten...
Obwohl erst später Nachmittag, dunkelte es bereits. In einigen Fenstern der geduckten Häuser brannte Licht. Aus Schornsteinen quoll Rauch, dessen typischen Geruch Owain Glyndwr liebte. Er sog den Atem tief durch die Nase ein, die sich dabei blähte wie die Nüstern eines Pferdes, und strich versonnen über sein dickliches Gesicht.
Unerklärlich spät registrierte er die Versammlung mehrerer Dorfbewohner vor Clough Corwens zweistöckigem Haus.
Es hatte den Anschein, als wäre ein hitziger Streit entbrannt.
Owain Glyndwr kehrte in die Pfarrkirche zurück und holte sich einen wärmenden Mantel aus dem privaten Gemach. Wohlgeschützt gegen den scharfen Wind, der winters unaufhörlich über die schroffen Bergzacken von Snowdonia hetzte, lenkte er seinen fülligen Körper die Straße hinunter. Die Leute sahen ihn nahen und hielten – immer noch erregt, nun aber abwartend – inne.
"Worüber ereifert ihr euch?", richtete Owain Glyndwr dieselbe Stimme an sie, die sie von der Kanzel kannten. Erst jetzt gewahrte er das rassige Pferd, das an einen Querbalken vor Clough Corwens Haus gezurrt war. Sowohl die schwarze Stute als auch der aufwändig gearbeitete, mit Seitentaschen versehene Sattel schlossen es von alleine aus, dass das Tier jemandem aus dem Ort gehörte. "Corwen hat einen Gast?", warf der Geistliche deshalb noch leicht erstaunt hinterher.
Sofort brandete wieder das Geraune los. Erst Owain Glyndwrs hochgereckter Arm schuf Ruhe. "Seid ihr von Sinnen, euch am Tage des Herrn so in Rage zu plärren? Ich frage also noch einmal: Was ist der Anlass? Hat es etwas mit dem Ankömmling zu tun?"
Dafydd Gwilym, sonst ein besonnener Mann, rief mit zornrotem Gesicht: "Gut, dass Ihr kommt, Pfarrer – gut, dass Ihr kommt, wirklich! Geht nur hinein zu Clough, diesem uneinsichtigen Narren, und sagt ihm, dass wir solchen 'Gast' hier nicht schätzen!"
Owain Glyndwr staunte. Er wollte gerade "Warum denn bloß nicht, ihr Leute?" rufen, als sich die Tür von Corwens Gaststube öffnete, und eine schneidend helle Stimme erklärte: "Danke für die zahlreichen Huldigungen, aber ich denke, ich brauche keine Steigbügelhalter...!"
Owain Glyndwrs Augen ruckten nach rechts – und unvermittelt empfand er eine Kälte, gegen die kein noch so warmgefütterter Mantel schützen konnte. Ein flüchtiger Blick genügte, um ihn den Aufruhr unter den Männern und Frauen, denen sich immer mehr Dorfbewohner anschlossen, verstehen zu lassen.
Von irgendwoher hörte er es tuscheln: "Der Hund, an dem sie vorbeiritt, begann erst zu jaulen, dann fiel er zu Boden, zuckte und erbrach sich, ehe er tot liegenblieb!" Und eine andere Stimme wusste zu berichten: "Eine meiner Kühe wurde wahnsinnig, als ich sie vor ihr über die Straße trieb. Ich musste sie sofort schlachten. Aber ihr Fleisch ist vergiftet. Ich werde den Kadaver verbrennen müssen!"
Von überall her tönte das böse Flüstern.
Owain Glyndwr starrte immer noch sprachlos auf die verführerische Frauengestalt. Sie war mit herausfordernd in die Hüften gestemmten Fäusten vor der Tür getreten und warf dabei wild-amüsierte Blicke in die Runde.
Als sie Owain Glyndwr entdeckte, zogen sich die Winkel ihres sündigen Mundes verächtlich nach unten. "Von dir", fauchte sie kehlig, denn sie hatte das Gewand seines Standes auch unter dem Mantel erkannt, "würde ich mir allerdings die Bügel gern halten lassen, Priesterchen! Du könntest mir auch gleich noch die Stiefel sauberlecken! Sie sind etwas staubig vom langen Ritt..."
Ein Aufschrei der Entrüstung ging durch die Menge, und Owain Glyndwr selbst krümmte sich unter unsichtbarer Knute. Die Haut seines Gesichts brannte plötzlich wie Feuer, und das Atmen fiel ihm unsagbar schwer.
Unbeeindruckt stieg die Frau, deren fremdartige, aufreizende Kleidung hie und da auch offene Begierde in Männerblicken weckte, die Steinstufen herab. Ihre Augen waren – bizarr für einen Menschen – gelb, ohne dass ihre Schönheit daran krankte.
Niemand wagte es, den geäußerten Abscheu als Angriff zu deuten und darauf zu reagieren. Alle Versammelten stierten nur gebannt auf die überquellende Weiblichkeit, die sich unter einem karminroten, kostbaren Stoff abzeichnete. Die Fremde schien sich ihrer Wirkung voll bewusst. Mit lasziver Eleganz bestieg sie ihre Stute, nein, sie verschmolz regelrecht damit, als wären sie in Wirklichkeit eine Einheit, die kurzzeitig auseinandergerissen worden war.
Owain Glyndwr begriff, noch während er unbeholfen auf die fremde Reiterin zustolperte, dass es dieser Vorfall war, der ihn bereits eine Nacht zuvor in verstörenden Ahnungen heimgesucht und gepeinigt hatte.
Als schließlich der Sattel dicht vor seinen Augen auftauchte, wäre er vor Scham am liebsten im Erdboden versunken. Er wusste, was nun folgen würde. Aber alle Versuche, sich dagegen zu stemmen, scheiterten unter dem unbarmherzigen Blick der flammend rothaarigen Frau. Sie hielt ihn, selbst als er den Kopf beugte, unentrinnbar gefangen.
Wieder stöhnte die Menge auf. Dieses Mal in einem anderen, von Unglauben getragenen Ton. Eine unersetzliche Saite in Owain Glyndwr zerriss. Er fasste selbst nicht, was er tat. Sein Herz schien zu erstarren, als seine Lippen sich öffneten, den Stiefel der Hexe berührten und die Zunge in nicht mehr kontrollierbarer Gier über das glatte Leder zu tanzen begann...
Er fühlte sich alt wie die Welt.
Sein Schädel war kahl, bis auf einen feinen, spinnwebartigen Flaum, und sein blasses Gesicht, von Falten und Runzeln überzogen wie das eines zwergwüchsigen Methusalem, sah müde aus, immer müde...
Wenn er die Augen schloss, grinste ihn der Tod an.
Obwohl die überwiegende Zahl der "Familie" es ihn nie hatte spüren lassen, litt Tom vor allem unter seinem Aussehen. Hässlich, hässlich, hässlich!, dachte er. Schlimmer noch als der unausweichliche Tod schien ihm dabei, dass er nie eine richtige Freundin haben würde. Kein Mädchen bei klarem Verstand würde sich mit einem Vogel wie ihm einlassen – keines!
Nach jeder Vorstellung schloss er sich in seinem Wagen ein und kroch ermattet ins Bett. Das Raunen, das Gelächter, die Sticheleien der überwiegend gleichaltrigen (aber nicht gleichhässlichen) Besucher verfolgte ihn noch Stunden danach.
Nicht selten hatte er überlegt, seinem Leben ein vorzeitiges Ende zu setzen. Seines Vaters wegen tat er es dann aber doch nicht und setzte sich stattdessen weiteren Qualen aus, die kein Außenstehender auch nur erahnen konnte.
Vielleicht liebte er die Dunkelheit deshalb so sehr. Weil ihr Mantel ihm die Illusion gab, ein sechzehnjähriger Junge wie tausend andere zu sein. Aber das Dunkel war ein schlechter Verbündeter und ließ ihn regelmäßig im Stich. Bei Tag und im Rampenlicht.
Wenn er allein war, lauschte er dem schnellen Schlag seines Herzens. Er wartete immer darauf, dass es einfach einmal aufhören und sein Leben in einem schwarzen Strudel entführen würde.
Die meisten wie er starben an Herzschwäche.
Nicht nur seine Haut war vergreist, auch jedes Organ und jeder Muskel. Kleinigkeiten, wie Stöße, die andere kaum registrierten, brachten ihm wochenlange Blutergüsse ein. Er erinnerte sich genau, dass er – als ihm sein Anderssein erstmals bewusst geworden war – versucht hatte, sich zu verstümmeln. Mit Feuer, glosender Zigarettenglut oder scharfkantigen Gegenständen. Bis sein Vater eines Tages Rotz und Wasser geheult hatte. Die Tränen konnte der Junge noch heute sehen. Manchmal schienen sie vor ihm in der Finsternis zu leuchten...
Seither hielt er durch.
Aber dass er nicht der einzige war, dem das Schicksal ein hartes Dasein auferlegt hatte, tröstete ihn in keiner Weise.
Einmal einen roten Mund küssen, einen warmen Busen streicheln...
Es war die erste Nacht in Mallwyd. Der kleine Ort war von wohligem Schauder erfüllt, seit Tom und seine Leute in einer kleinen Parade durch die Hauptstraße flaniert waren. Die erste Vorstellung war für den kommenden Mittag angesetzt.
Tom richtete sich matt im Bett auf, als er Geräusche von der Tür her vernahm. Mit weit aufgesperrten Ohren hörte er, dass sie von jemandem mühelos geöffnet wurde.
Unmöglich!, dachte er. Er hatte abgeschlossen. Er schloss immer ab! Die Bewegung war ihm in Fleisch und Blut übergegangen.
Etwas in seiner Brust zog sich schmerzhaft zusammen. Die Finsternis verformte sich zu einer rotierenden Spirale. Aber es verging wieder. Keuchend konzentrierte er sich auf weitere Wahrnehmungen. Sehen konnte er nichts. Und die Hand nach der Ziehschnur der Wandlampe auszustrecken, gelang ihm auch nicht. Er war wie erstarrt.
Bis er die Stimme hörte.
"Hab keine Angst! Ich bin es nur!"
"Fee...?"
"Ja, beruhige dich!"
Er sackte regelrecht in die Kissen zurück. "Wie bist du –?"
"Psst...!"
Sie war schon bei ihm. Er spürte den typischen Luftzug und dann ihren kühlen Finger auf seinem spröden Mund.
Als sie sich neben ihn auf die Matratze setzte, spürte er eine Sehnsucht, die er sich nicht einzugestehen wagte. Fee war erst vor kurzem zu ihnen gestoßen und sofort zum uneingeschränkten "Star" des Ensembles aufgestiegen. Weder Tom noch die anderen Familienangehörigen wussten, wie sie ihre Maskerade aufrechterhielt. Aber sie wirkte, bei aller Monströsität, täuschend echt. Das genügte dem Publikum. Noch nie waren die Vorstellungen besser besucht gewesen.
Es wurde viel getuschelt. Unter anderem, dass Fee und Toms Vater ein sehr intimes Verhältnis miteinander pflegten.
Tom beneidete ihn darum.
Fee war – hinter der Maske – die hübscheste und zugleich flippigste Frau, die der "junge Greis" je gesehen hatte. Sie besaß etwas, woran es den meisten Schönheiten mangelte: Persönlichkeit.
Und jetzt hockte sie neben ihm in der Dunkelheit, und er wurde das starke Gefühl nicht los, dass sie ihn durchdringend musterte.
Der Gedanke war genauso abstrus wie ihr Erscheinen.
"Was willst du...?", setzte er erneut an.
"Ich habe mit deinem Vater gesprochen", sagte sie sanft. "Er hat mir erklärt, was mit dir los ist. Er ist in großer Sorge um dich..."
Das war Tom nicht neu. Er war selbst in großer Sorge um sich – verdammt!
"Lass mich in Ruhe! Ich will allein sein!", sagte er schroff.
"Du bist allein. Ich sehe, wie es dich quält. Und –"
"Und?"
"Du hast Angst."
"Wovor sollte ich Angst haben? Jemand wie ich fürchtet nichts!"
"Außer dummen Mitmenschen und den Tod."
Tom nickte schwach und hoffte inständig, dass sie es nicht tatsächlich sehen konnte. "Blödsinn!" bellte er mit überschlagender Stimme.
"Mir kannst du nichts vormachen."
Warum nicht? Was, zum Teufel, willst du von mir? schrie er in Gedanken. Aber er sagte nur: "Geh jetzt! Bitte!"
"Später. Danach. Wenn nicht dir, bin ich es deinem Vater schuldig, es zu versuchen..."
Zu versuchen?
Plötzlich spürte er ihre Hände auf seiner Brust. Auch dort war die Haut welk und empfindlich. Auch dort pochte der Altersschmerz im Körper eines sechzehnjährigen Jungen, der wusste, dass er in spätestens ein, zwei Jahren sterben würde. Mit dieser Krankheit wurde man nicht älter.
Ihre Berührung war zart und von Rücksicht geprägt. Behutsam strich sie höher, umschloss sein Gesicht und sagte mit einer Eindringlichkeit, die Tom noch mehr aufwühlte: "Habe Vertrauen! Ich kann dir nichts versprechen, aber ich werde versuchen, dir zu helfen! Ganz ruhig jetzt!"
Ein bitteres Lachen steckte in seiner Kehle.
Es blieb dort.
Weil er sich eingestehen musste, dass das Zittern aufhörte und sein Herz tatsächlich wieder gelassener zu schlagen begann. Daran änderte sich auch nichts, als Fee vollends zu ihm ins Bett schlüpfte und ihn behutsam in die Arme schloss.
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info





