
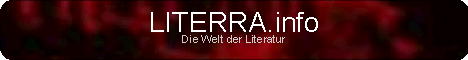
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Harald A. Weissen > Phantastik > Noch einmal Beeren pflücken |
Noch einmal Beeren pflücken
von Harald A. Weissen
Viel fühle ich nicht. Nur dass der Sessel, auf dem ich seit einer Stunde sitze, ziemlich hart ist. Eigentlich sieht seine braun-beige karierte Polsterung recht bequem aus. Aber manchmal trügt der Schein. Die Realität hat sich tief unter der Oberfläche in einer Ecke verschanzt, die so finster und kalt wie die Rückseite des Mondes ist.Durchs Panoramafenster sehe ich weit entfernt die lautlosen Lichter eines vorbeifahrenden Zuges in der Nacht. Sie schweben von links nach rechts, befinden sich im Konkurrenzkampf mit der geisterhaften Spiegelung des Zimmers im Glas - zwei Welten, die endlos miteinander ringen. Eine Weile betrachte ich mein eigenes diffuses Abbild, das vorgebeugt neben einem Geistertisch sitzt. Es starrt mich reglos an. Wartet. Genau wie ich. Und ich frage mich, ob es wohl die selbe Leere fühlt, die in mir herangereift ist.
Ohne bestimmten Grund wende ich mich von der gespiegelten Welt ab und betrachte den realen Tisch. Auf ihm liegen die zerlesenen Zeitungen dieser Woche. Eine hellgrüne, schlanke Vase hält einen Strauss vertrockneter langstieliger Rosen, die ich vor sechs Tagen mitgebracht habe, in aufrechter Position. Trotzdem lassen die dornigen Blumen ihre roten Köpfe hängen. Ihre Blütezeit ist abgelaufen, nichts kann das jemals rückgängig machen. Und mir ist klar, dass uns allen das selbe bevorsteht, ob es uns nun passt oder nicht. Menschliche Blumen mit hängenden Köpfen - trauriger ist nur Regen im November.
Kurz hebe ich den Blick, suche in der Dunkelheit draußen nach den Lichtern des Zuges. Er ist verschwunden. Ich höre das leise Ticken meiner Armbanduhr. Meine Jeans raschelt, als ich den rechten Fuß etwas nach außen drehe. Und ein vom Wind gepeitschter Zweig klopft sachte an die Fensterscheibe.
Ich schaue zurück zum Tisch. Neben der hellgrünen Vase liegt Claudines Zeichenblock, in dem sie persönliche Eindrücke in Form von Kohlestiftbildern gesammelt hat - zuhause liegen Dutzende solcher Blöcke herum. Sie wird das nicht mehr tun. Nie wieder. Vor kurzem gab ihr Körper sämtliche Funktionen auf und man hat sie, von einem blütenweißen Tuch bedeckt, auf einer Bahre aus dem Zimmer gerollt.
Das Zimmer - ich schaue auf, blicke um mich und sehe als erstes die sauberen Wände. Sie sind so makellos sauber, dass es schwer fällt, zu glauben, dass zwischen ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit unerbittliche Kämpfe um Leben und Tod ausgefochten werden. Aber so ist es. Und es spielt keine Rolle, in welchem Winkel dieser Welt man sich aufhält. Der Kampf ums Überleben ist ein einigendes Element. Dann steht da noch das stählerne Ungetüm von einem Bett. Darauf liegen die zurückgeschlagenen Laken und das zerknautschte Kissen, auf dem bis vor kurzem noch Claudines Kopf geruht hat. Ich sehe sie so deutlich vor mir. Sie versucht zu lächeln und schafft es nicht. Die hohen Wangen sind eingefallen, nicht länger weich geformt, die einst leuchtend grünen Augen matt und leer. Die schwarze Korona langen Haars verbreitet die Endgültigkeit eines dunklen Schachts, in den ihr ausgezehrtes, bleiches Gesicht sinkt und sinkt und immer tiefer sinkt. Und sie hört einfach auf zu leben.
Müde reibe ich meine Augen, und als ich wieder aufsehe, erblicke ich den Infusionsständer etwas abseits des Bettes. Daran hängen zwei durchsichtige Beutel mit unleserlichen Etiketten, und Schläuche. Aus dem Augenwinkel erkenne ich ein charakterloses Waschbecken, daneben einen Einbauschrank, in dem noch immer Claudines Kleider, etwas Schmuck und ihre blauen Turnschuhe liegen - diese Turnschuhe, an denen sie so sehr gehangen hat. Ich bin nicht fähig, diese Dinge in die Reisetasche zu packen. Noch nicht.
Lautlos schwingt die Tür, die auf den Flur hinaus führt, auf und eine zierliche thailändische Krankenschwester betritt den Raum, bleibt stehen. Ich habe sie in den Tagen zuvor oft hier gesehen, mit ihr geplaudert und gescherzt. Sie ist eine gütige, mitfühlende Person in mittleren Jahren, Ehefrau eines Mechanikers und stolze Mutter zweier Söhne. Sie hat während dreier Jahre einen Sprachkurs belegt, und in ihrer Freizeit pflegt sie einen kleinen Garten hinter dem Haus, in dem sie mit ihrer Familie lebt. Sie hat mir so vieles von sich erzählt, und jetzt will mir ihr Name nicht mehr einfallen - gibt es etwas schäbigeres?
„Kann ich Ihnen etwas bringen?“, fragt sie mit leichtem Anklang der asiatischen Heimat in der Stimme. „Tee? Oder Kaffee vielleicht?“ Sie zögert, schlägt dann vor: „Soll ich jemanden für Sie benachrichtigen, der Sie abholen kommt?“
Ich will etwas Nettes sagen, bleibe aber stumm. Die wenigen Gedanken in meinem Schädel torkeln wie betäubte Rehe kurz vor dem Zusammenbruch ziellos herum, prallen voneinander ab, und es ist unmöglich, sie in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen.
Genau so lautlos, wie die Krankenschwester die Tür geöffnet hat, schließt sie diese wieder, kommt näher und setzt sich auf den Sessel neben mich. Es handelt sich dabei um das gleiche harte Modell, wie dasjenige, auf dem ich auf etwas warte, das ich nicht benennen kann. „Soll ich die Sachen Ihrer Frau für Sie einpacken?“
Ich schüttle den Kopf, und wider Erwarten bringe ich ein „nein“ hervor. Es beruhigt mich, zu wissen, dass meine Stimme mich nicht ebenfalls verlassen hat. Obschon trocken und rau, klingt sie doch noch immer wie meine eigene.
Die Schwester schweigt und sitzt einfach nur da. Streicht ihren Rock glatt, vermittelt mir in unaufdringlicher Art das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und dafür bin ich dankbar.
Zaghaft greife ich nach dem Zeichenblock und zögere, ihn aufzuschlagen. Darin sind Seite um Seite winzige Stücke von Claudines Innenleben gefangen. Ihre Gedanken, ihre Eindrücke, vielleicht auch Wünsche. Meine Hände gehorchen mir nicht mehr und blättern die erste Seite um. Und ich sehe eine schwarz-weiße Version der mächtigen Steinlöwen, die den Eingang der Klinik flankieren. Sie wirken unbeteiligt, als kümmere sie das Wohl derjenigen nicht, die an ihnen vorbeischreiten. Zwischen ihnen steht ein vielleicht neun- oder zehnjähriges Mädchen mit Zöpfen. Sie schaut mit leerem Blick zu dem linken Löwen, hat sogar eine Hand nach ihm ausgestreckt, als wolle sie ihn schon im nächsten Moment berühren, zögere jedoch aus Angst, er könne sich ihr zuwendenden und mit den steinernen Fangzähnen nach ihr schnappen.
„Ihre Frau hat schöne Bilder gezeichnet“, sagt die Krankenschwester, und ich schrecke auf, da ich ganz vergessen habe, dass sie neben mir sitzen geblieben ist.
„Welche haben Sie gesehen?“
„Alle. Das heißt ... alle in dem Block.“ Sie deutet darauf und faltet anschließend die Hände im Schoss. „Eigentlich mag ich ja fröhliche, bunte Bilder. Aber die Bilder Ihrer Frau sind sehr detailliert. Das gefällt mir. Darin sind Dinge enthalten, die andere Künstler einfach weglassen würden, weil sie meinen, niemand nehme sie wahr. In dieser Liebe zum Detail steckt ein Grad an Intimität, der subtiler und damit weitaus ergreifender ist als simple Schönheit.“
„Claudine“, ich stocke, da mir das Aussprechen ihres Namens Qualen bereitet, „Claudine mochte es nicht, wenn man sie Künstlerin nennt. Ihr war das peinlich. Mehr als einmal ist sie bei einer ihrer Vernissagen rot angelaufen, wenn jemand ihre Arbeit mit Lob überhäufte.“
„Bescheidenen Menschen ist vieles peinlich. Zu vieles. Das macht sie so sympathisch, aber auch verletzlich.“
Ich denke mir, dass sie recht hat und blättere weiter. Das nächste Kohlestiftbild zeigt einen alten Mann auf einem Stuhl in der Cafeteria der Klinik. Er trägt einen Morgenmantel, der ihm sichtlich mehrere Nummern zu groß ist. Dazu eine auffällige altmodische Hornbrille auf einer gekrümmten Nase, die ihm ein vogelartiges Aussehen verleiht. Etwas an seinem abwesenden Blick ist eigenartig, und wenn man genau hinsieht, kann man in den zu großen Pupillen das schwache Spiegelbild einer nackten, schwangeren Frau sehen, die kurz vor der Niederkunft zu stehen scheint. Ich habe Claudine nie danach gefragt, wer diese Frau ist.
Das nächste Bild zeigt ein seitliches Selbstporträt. Claudine steht in ihrem Krankenzimmer vor dem Spiegel, der über dem Waschbecken hängt. Während ihr Kopf mit einem Anflug von Demut zum Zeichenblock geneigt ist, starrt ihr Spiegelbild sie direkt an. Entgegen der meisten anderen Bilder ist dieses aus groben, festen Strichen und vielen dunklen, dräuenden Flächen konstruiert. Auf dunkle Art liegt etwas Prophetisches in ihm, und ich blättere schnell weiter.
„Sie mögen dieses Bild nicht?“
„Nein“, sage ich und staune über die Aufmerksamkeit der Krankenschwester. „Wenn ich es betrachte, glaube ich, dass Claudine geahnt hat, dass es so schnell geht. Klingt das dumm?“
„Warum sollte das dumm sein?“
„Ich weiß nicht“, sage ich und zucke ratlos mit den Schultern. Wie soll ich jemandem ein komplexes Gemenge von Gefühlen erklären, das ich selber nicht begreife, geschweige denn in präzise Worte fassen kann?
Ich blätterte weiter und erinnere mich schon bevor ich es sehe, an das Bild, das als nächstes kommt. Ein Porträt von mir, wie ich neben Claudine am Krankenbett sitze. In der linken Hand halte ich meinen Schlüsselbund - mit dem ich oft unbewusst herumspiele -, meine Rechte liegt auf der Matratze neben der Frau, die ich liebe. Während meine Gestalt aus akkuraten, feinen Strichen besteht und in ihrer Detailgetreue schon fast übertrieben scheint, wirkt der Rest vage, kontur- und texturlos. Als würde sich die Welt mit jedem Meter, den sie sich von mir entfernt, ein kleines Stückchen weiter auflösen. Als würde sie ihre Festigkeit verlieren.
„Ich soll Ihnen etwas ausrichten“, sagt die Krankenschwester plötzlich und ich entnehme ihrem Tonfall, dass sie den Inhalt dessen, was sie mir da ausrichten soll, nicht versteht. „Ihre Frau hat mich gebeten, Ihnen etwas zu sagen, nur für den Fall, dass sie selbst nicht mehr dazu kommt.“
„Was soll das sein?“ Ich betrachte einen Moment länger das Bild der sich in Auflösung befindenden Welt, schaue dann auf.
„Ich soll Ihnen sagen, dass Claudine noch einmal Beeren pflücken möchte. Nichts weiter, nur das. Sie möchte noch einmal Beeren pflücken. Sagt Ihnen das etwas?“
„Beeren ...“, murmle ich und spüre, wie die Welt in ihrer Bewegung erstarrt. Nichts atmet, nichts bewegt oder regt sich, und selbst die Zeit entschließt sich zu absolutem Stillschweigen. Die Luft gefriert, und was wir uns als Leben vorstellen, wird zum eingegossenen Inhalt eines Kristallglases in den Händen eines Kindes. Menschen stehen in Städten wie Puppen in einem Schaufenster, in ihre so unterschiedlichen Handlungen begriffen, herum. Würde das Kind die Kristallkugel schütteln, würde Schnee herumwirbeln und alles unter sich begraben.
„Was hat das zu bedeuten?“, fragt die Krankenschwester.
„Im Sommer vor drei Jahren“, sage ich leise, „hat Claudine während unserer Ferien in der Toskana die Venuskatze beim Beerenpflücken angetroffen.“
„Was ist die Venuskatze?“ Erstaunt hebt die Thailänderin ihre Augenbrauen. Streicht ein weiteres Mal ihren Rock glatt, und ich sehe, dass er keine Falten aufweist. Sie tut es wohl um der Bewegung willen.
„Das selbe habe ich Claudine an jenem Morgen gefragt. Ich erinnere mich noch deutlich, wie sie mit einer durchscheinenden Plastiktüte voller roter Beeren und einem Leuchten in den Augen von ihrem kurzen Ausflug ins Hotel zurückgekehrt ist. Sie hat sich aufs Bett gesetzt, auf den Rücken gelegt, sie hat die Augen geschlossen und mir gesagt, dass sie die Venuskatze im Wald angetroffen und sich mit ihr unterhalten hat.“
„Und wie sieht diese Katze aus? Was macht sie?“
Ich zucke mit den Schultern. „Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie sich vom Rest der Zeit ernährt, die einer Person vom Schicksal noch zusteht. Bei dieser Person handelt es sich immer um ein Mädchen. Ein vierundzwanzig-jähriges Mädchen mit grünen Augen, schwarzem Haar und einer wahnsinnigen Sehnsucht nach Ferne in sich, das den glücklichsten Moment ihres Lebens am falschen Ort verbringt. Dieser Ort ... es ist jedes Mal ein anderer, aber nie zweimal der selbe. Die Venuskatze ernährt sich von der Restzeit dieser Mädchen. Dafür trägt sie Sorge, dass diese Restzeit unvergleichlich, vollendet wird.“
Obwohl ich noch vor einer Minute nicht daran geglaubt habe, schaffe ich es, mich vom Stuhl zu erheben. Ich schaue zu den Rosen mit ihren hängenden Köpfen, lege den Zeichenblock zurück auf den Tisch. Meine Blicke gleiten durch das Innere der Kristallkugel.
Ich starre durchs Fenster hinaus in die eiskalte Nacht. Kein Zug fährt. Alles ist erstarrt.
Unerreichbar weit entfernt sagt Claudine mit Sehnsucht in der Stimme: „Nur noch einmal Beeren pflücken.“
Und plötzlich beginnt es zu schneien.
29. Apr. 2009 - Harald A. Weissen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



