
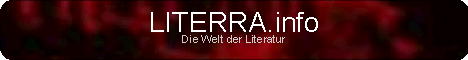
|
|
Startseite > Kurzgeschichten > Vincent Voss > Steampunk > Die Maschine |
Die Maschine
von Vincent Voss
»Am Anfang war das Huhn!«;
Lucardus
Lucardus
Im Zwielicht stampfen Kolben, Ventile öffnen und schließen, es pumpt und faucht, das Gestänge arbeitet, vor, zurück, Dampf entweicht in Stößen zischend, treibt Ketten und Kurbeln an, metallene Röhren und gusseiserne Räder zirkulieren in komplexer Abhängigkeit zueinander. Ein gleichsamer Tanz der Maschine, die sich baumhoch dem Kuppeldach entgegenstreckt und ehrfurchtsvoll über etliche Schritt in Breite und Tiefe ausdehnt. Der erste Maschinenvikar steht am uneinsehbaren Kopfende der Maschine auf einem Gerüst und kontrolliert die Zufuhr der winzigen Mengen Okkulat, das bei Bedarf mit einem verzierten Spatel in eine Klappe gestreut wird. Weitere Maschinenvikare überwachen mit gewundenen Hörrohren die Vitalfunktionen des Eisenwesens, zu ihrem sich verschlankenden Ende leiten Rohre ihr Kondensat in gläserne Bottiche, in denen die Plasmatypografen ihr Gewebe schreiben. Stetig, aber unberechenbar. Sie unterbrechen den Rhythmus und folgen scheinbar geheimen Impulsen, zu denen sie sich in Bewegungen setzen, ihre Typen ausschlagen und Gewebe formen und verdichten. Längs des Gewebes folgen Kryptografen den Bewegungen, notieren sie in ihrem Maschinenbüchlein. Am Ende überwacht der Kardinalpräfekt der Kongregation der Maschine das ausgestoßene Gewebe, trennt Teile nach einem tradierten Schema und überführt sie zum Duplizierer. Nach Fertigung mehrerer Duplikate wird es zur Exegese verteilt. Das Gewebe in einen gläsernen Rahmen gespannt, zieht der Kardinalpräfekt und oberster Kryptograf das Prismenokular heran und aktiviert es über einen Hebel. Zischend fährt es herab, justiert Rädchen um Rädchen im Innern, ehe es für das Gewebe die geeignete Schärfe einstellt. Der Kardinalpräfekt mustert mit strengem Blick die Bereitschaft seiner beiden Untergebenen, die ebenso an ihren Apparaturen Duplikate kryptografieren. Er zieht das Buch Lucardus auf einem Schwenktisch heran, presst seine Stirn an die metallene Stütze und blickt durch die bernsteinfarbene Linse. Bedeutungslose und semantische Formen treiben im faserigen Plasmanebel, chaotische und geometrische Körper warten auf die Zuweisung einer Bedeutung. Abwechselnd werfen die Kryptografen einen Blick auf das Gewebe und in das Buch Lucardus, gelegentlich sehen sie entrückt auf, um anschließend exegetische Ergebnisse auf Pergament zu bannen. Apologetische Fragmente verknüpfen sich zu Sätzen, die das Fundament ihres Glaubens festigen, festgehalten auf den Exegesepapieren, deren Inhalt jeden darauffolgenden Morgen verkündet wird. Und dann: eine Helix schwebt bedeutungsschwanger im Gewebe, eine weitere folgt, eine Kette von Helices, linksgängige, rechtsgängige, der Herzschlag des Kardinalpräfekten beschleunigt sich, er schaut auf. Seine Untergebenen haben die Zeichen auch gesehen. Er nickt, schluckt und übereifrig schauen sie wieder durch die Linsen. Worte der Offenbarung. Eiliger nun wechseln sich die Blicke in das Buch Lucardus und durch das Okular ab, schneller bringt die Feder Buchstabe um Buchstabe auf das Pergament. Die Helixfolge endet mit dem Gewebeabschnitt, jenes von Tinte zu Papier gebrachte Geräusch erstirbt, sie sehen auf, einander an, und der Kardinalpräfekt schreitet mit seiner Exegese zu seinen Kryptografen, um zu vergleichen. Mit einem Monokel prüft er Zeile um Zeile, erstarrt in seiner Bewegung, überlegt, greift zur Feder und setzt zur Korrektur an. Ein Strich.
Zur Erkenntnis müsst ihr ihr folgen.
Zur Erkenntnis müsst ihr ihr folgen.
Der Kryptograf kämpft darum, seine Überzeugung zu verteidigen, man sieht es in seinem Gesicht, der sich öffnende Mund, die sich straffende Haltung, doch die Kraft zur Auflehnung fährt aus ihm heraus und er erschlafft und nickt. Der Kardinalpräfekt legt ihm väterlich eine Hand auf die Schulter.
»Eure Exzellenz«, grüßt der Kardinalpräfekt den Substitut Corovan Ignatius, einer formalen Einladung nachkommend, die ihm Unbehagen bereitet.
»Eure Eminenz«, entgegnet Corovan Ignatius mit einem Kopfnicken, tritt beiseite, lässt den Kardinalpräfekten in sein Zimmer und weist ihm einen Stuhl an seinem Sekretär. Es ist abends und die beiden Männer treffen sich in den Privatgemächern des Vertreters des länger erkrankten Staatssekretärs Seiner Heiligkeit, ein ungewohnter Ort eines dienstlichen Beisammenseins, welches zu Recht das Ungemach des Kardinalpräfekten verursacht.
»Ein ungewohnter Ort und eine ungewohnte Zeit für ein Treffen, meint Ihr nicht?«, gibt der Kardinalpräfekt seinem Misstrauen eine Stimme und setzt sich. Der Substitut, im Begriff, sich ebenfalls zu setzen, verharrt, seine Hände auf den Sekretär gelegt, mustert sein Gegenüber und nickt.
»Ungewöhnliche Ereignisse, die die Wachsamkeit meines Amtes herausfordern, rechtfertigen sowohl den Ort wie auch die späte Stunde unserer Begegnung«, antwortet Ignatius, setzt sich und lächelt, sich seiner Macht durchaus bewusst.
»Und ich versichere euch, die umgehende Folgeleistung meiner Bitte goutiere ich im höchsten Maße«, ergänzt er dankend. Der Kardinalpräfekt strafft seine Schultern.
»Nun, was soll das geheimniskrämerische Brimborium?«, fragt der Präfekt streng, seine Haltung offenbart Verteidigung und Angriff in einem. Ignatius reibt mit dem Zeigefinger seine Nasenspitze und beugt sich vor.
»Ihr verheimlicht mir etwas«, sagt er gedämpft mit prüfendem Blick. Der Impuls der Aufgeregtheit des Präfekten folgt Momente zu spät, sodass die Entrüstung eines Schauspiels überführt wird. Den aufgeregten, brüskierten Attacken ausweichend und mit Sanftmut entgegnend, leitet Ignatius das Gespräch in die milderen Gefilde der dem Ernst der Lage notwendigen Sachlichkeit.
»Euer Eminenz, mir ist zu Ohren gekommen, dass sich die Zeugnisse der Exegese in letzter Zeit widersprechen, nur dass dies, und ich kann Eure ehrenwerten Gründe dafür durchaus nachvollziehen, sogar gutheißen, nicht im Protokoll vermerkt wurde.«
»Kleinigkeiten«, schnauft der Präfekt.
»Nein, ich glaube nicht«, widerspricht Ignatius energisch und Kräfte vergleichendes Schweigen entscheidet über einen Konflikt oder ein Eingeständnis.
»Nun ja, …«, beginnt der Präfekt geläutert, »… in der Tat kam es zu Interpretationsfehlern meiner Kryptografen, jedoch kann ich den Anlass eurer Einladung, die einem Zitat gleich …«
»Ich weiß, ihr habt die ›Fehler‹ sogleich korrigiert. Das war gut!«, lobt Ignatius den in die Enge Getriebenen.
»Dennoch mehren sich die ›Fehler‹ dem Termin der anstehenden Konklave und wir müssen gemeinsam die Ursache ergründen.« Ignatius verschränkt seine Hände über der Brust ineinander und lehnt sich abwartend zurück.
»Wollt Ihr sagen, die Maschine …«, brüskiert sich der Angegriffene erneut.
»Nein, die Maschine irrt nie!« Das Kräftemessen findet hier ein Ende, der Kardinalpräfekt schüttelt, den Blick gesenkt, den Kopf und sieht auf.
»Ich weiß es nicht, Euer Exzellenz. In jüngster Zeit sind die Verkündigungen durch Syntaxfehler geprägt, die sonst nie vorkommen. Unsinnige wie doppeldeutige. Doch die doppeldeutigen verkünden Häresie! Es kann nicht sein!« Nachdrücklich und verzweifelt schlägt er mit der flachen Hand auf den Tisch. Ignatius nickt.
»Ihr habt einen Verdacht?«, fragt er und ein längeres Schweigen, untermalt vom Wind, der um das Gemäuer pfeift, und unterbrochen vom gelegentlichen Zischen der Rohre in den Wänden, setzt ein.
»Das Okkulat«, antwortet der Präfekt. »Kann es am Okkulat liegen?«
»Seid versichert, ich werde Eurem Hinweis auf das Genaueste nachgehen«, antwortet Ignatius und erhebt sich abrupt, um den Präfekten zu verabschieden. Kaum, dass die Tür ins massive Schloss gefallen ist, drückt er an seinem Schreibtisch auf einen unter der Platte befindlichen Knopf, es zischt aus einer Wandnische und der Aufzeichner beendet seinen Schreibvorgang. Später wird Ignatius das Gespräch auf dem Gewebe ein weiteres Mal verfolgen und es bekräftigt seine Vermutung über die Unschuld des Kardinalpräfekten. Was aber ist es dann, das die Worte der Häresie verursacht?
Marrakesch. Zweierlei Angelegenheiten führten Ignatius in die sagenumwobene Stadt, die ihn mahnend an einen Sündenpfuhl erinnert. Zum einen ist es das Okkulat, welches sich, der lucardischen Vorhersehung folgend, aus Gotteshand in diesem Landstrich so üppig aus dem Himmel ergossen hatte und den ostentativen Reichtum des Sultans begründet.
Zum anderen ist es ein geheimes und in hohem Maße prekäres Gewebe, welches seinem Amt zugestellt wurde. Hinweise auf den Verbleib Lucardus’, der, nachdem er einen biblischen Code entschlüsselnd die Maschine erbaut und die Apokalypse vorhergesehen hatte, verschwunden war. Angeblich hatte er auch einige Zeit in dieser Stadt gelebt, zumindest weist ein Briefwechsel zwischen den Ingenieuren Johannes und Lukas darauf hin. Eben jene Briefe führt Ignatius wie einen Schatz während seines Aufenthaltes bei sich.
Kaum, dass er nach einer beschwerlichen Reise dem Luftschiff entstiegen war, wurde er von Ketzermücken geplagt, die ihm einen derart heftigen Fieberwahn beschert hatten, dass er glaubte, der Leibhaftige sei ihm begegnet und folge ihm auf Schritt und Tritt. Erst nach drei Tagen Ruhe konnte er der Einladung des Sultans in sein Luftschloss Folge leisten, immer noch angeschlagen, aber im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, wie er meinte. In die Insignien eines Erzbischofs gekleidet ließ er sich von einer Dampfdroschke zum Lufthafen bringen, wo er erwartet und zum Luftschiff transferiert wurde. Zugegeben: Er war beeindruckt. Nicht ein einzelnes Schloss schwebte, von mächtigen Streben getragen, die zu gold- und sandfarbenen Luftschiffen hoch in den Himmel emporschossen, eine ganze Stadt lebte unter den Wolken. Er musste sich konzentrieren, um das ausgestoßene Kondensat im hellen Blau des Himmels erkennen zu können. Wie viel Okkulat nötig war, um diese Stadt zu versorgen, fragte er sich und erstickte seine aufkeimende Ohnmacht ob der Verschwendung und der Gotteslästerung, die sich in all dem Reichtum des ungläubigen Sultans manifestierte. Er war ein Gesandter Gottes, aber auch ein Diplomat des Vatikans und Marrakesch stellte mit Abstand die größte Menge Okkulat zum Handel bereit. Auf dem Weg zum weißen Marmorschloss fächerten ihm Bedienstete des Sultans demütig frische Luft mit Palmwedeln zu, aber sein Unbehagen vor der anstehenden Audienz konnte sie nicht verflüchtigen.
Der Sultan war ein Mann, dem man ewige Jugend und vollendete Schönheit nachsagte und beides traf, wie Ignatius feststellt, zu. Nach dem Protokoll der Begrüßung und den gegenseitig geäußerten diplomatischen Wertschätzungen befinden sich die beiden Männer allein in einer lichtdurchfluteten Bibliothek mit Panoramablick auf die unter ihnen liegende Stadt und die hohen Gipfel des Atlasgebirges. Mechanische Installationen, Technologien eines neuen Zeitalters, setzen als Miniaturen interessante Akzente und wecken Ignatius Neugier.
»Ihr interessiert Euch für Mechanik?«, fragt der Sultan und Ignatius ist sich nicht sicher, ob eine Note Ironie in seiner Stimme mitschwingt.
»Bedingt. Ich halte mich für einen neugierigen Laien und mein Amt setzt eine gewisse Grundkenntnis voraus«, bestätigt Ignatius die Beobachtung des Sultans. Der Sultan lächelt.
»Nun, ich setzte ebenso ein gewisses Interesse bei Euch voraus, gilt doch der Grund Eures Besuches dem, was ihr Okkulat nennt und das Eure Maschinen antreibt. Diese Apparatur zum Beispiel …«, der Sultan deutet auf jene Miniatur, die Ignatius inspiziert hatte, »… dient der Belebung von Wasser.«
»Belebung von Wasser?«, wiederholt Ignatius bedächtig.
»Ja. Wasser wird gewissermaßen zum Leben erweckt. Es metaboliert, es mutiert und es reproduziert sich.«
Ignatius hat Mühe, seine Überraschung zu verbergen. »Ihr meint, das Wasser vermehrt sich?«, wagt er zu fragen.
»Ja. Eine der essenziellsten Technologien, die uns hier überleben und, versteht mich bescheiden, mein Reich aufblühen ließ«, antwortet der Sultan und erklärt Ignatius Beobachtungen zu den üppigen Gärten, die er unten in der Stadt und auch hier oben hat anstellen können. Dennoch beschert ihm diese Erkenntnis großes Misstrauen, denn es war Lucardus, der der Heiligen Schrift das über Jahrtausende gewahrte Geheimnis über die göttliche Maschinenkunst entlocken konnte, und Ignatius fragt sich, auf welch dunklen Pfaden dieses Wissen in die Hände der Ungläubigen hat gelangen können. Und wie sie es, und dieses Eingeständnis sorgt für physische Leiden in seiner Bauchgegend, weiterentwickeln konnten. Von den wirren Glaubensvorstellungen des Sultanats war dem Vatikan wenig bekannt, und aus Angst, sein Gegenüber zu verletzen, vermeidet Ignatius daher eine theologische Auskleidung seiner Frage, die deshalb umso direkter wirkt.
»Und woher wisst Ihr um die Baukunst solcher Apparaturen?« Die Direktheit irritiert den Sultan, er zögert.
»Ihr wisst es nicht?«, fragt er aufrichtig überrascht. Ebenso aufrichtig beschämt verneint Ignatius.
»Die Göttin selbst schenkte uns dieses Wissen, ehe sie verstarb«, erklärt der Sultan und verschränkt die Hände ineinander. Ignatius wiederholt innerlich und in die Länge gedehnt die Antwort, ehe er vorsichtig und bar jeder verräterischen Betonung nachfragt.
»Eure Göttin ist hier gestorben?«
Der Sultan nickt. »Sie sah voraus, dass der Himmel brennen und das Wasser alles Leben verschlingen würde. In ihrer Voraussicht wies sie meinen Urahnen an, seinem Volk Luftschiffe zu bauen und sie zu retten. Und sie zeigte uns, wie man die göttlichen Tränensteine und ihre Technologie vereinte.«
Ignatius sieht ihn fragend an.
»Okkulat… Tränensteine«, übersetzt der Sultan den für Ignatius unbekannten Begriff.
»Ich verstehe«, antwortet Ignatius, eher um sich zu besinnen, denn um eine fließende Konversation zu betreiben. Der Sultan schweigt wissend und rücksichtsvoll. Dann legt er eine Hand auf Ignatius Unterarm.
»Ihr könnt sie sehen, wenn Ihr wollt«, sagt er sanft und Ignatius kann sich der Kraft des Angebots Dank seiner ausgeprägten Neugier kaum entziehen.
»Sie … liegt hier? In einem Tempel?«
Der Sultan verneint mit einem Kopfschütteln.
»An einem geheimen Ort. So war ihr Wunsch«, antwortet er.
Ignatius wägt seine nächsten Worte sorgfältig ab. »Wenn der Ort so geheim ist, wie Ihr sagt, warum wollt Ihr ihn mir zeigen?«, fragt der Substitut, seine lauernde Haltung durch Naivität überspielend.
»Damit wir uns besser kennenlernen und vielleicht sogar Freundschaft schließen, wenn wir sehen, dass unsere Ansichten gar nicht so unüberbrückbar sind.«
Ignatius fragt sich, ob die Antwort des Sultans mit gleichem Pulver verschossen wurde, und spürt den Arm des Herrschers auf seiner Schulter.
»So wie Ihr mein Gast seid, wünsche ich beizeiten Eure Gastfreundschaft. Erhoffe ich zu viel?«
Ignatius überlegt, ob er dem Wunsch des Sultans entsprechen kann, wägt seine Möglichkeiten ab, ehe er einen Entschluss fasst.
»Über einen Austausch würde ich mich sehr freuen«, antwortet er knapp und hofft auf eine diplomatische Bilanz zu seinen Gunsten.
Der Sultan nickt, lächelt und fährt sich mit dem Zeigefinger über die Unterlippe.
»Sobald Ihr Eure Erkundungen zu dem … Okkulat beendet habt, soll ein Besuch am Grabe der Göttin anstehen. Ihr werdet viel erfahren.«
Es waren keine wirklichen Momente der Stille, denn seit Anbeginn ihres Dienstes atmete die Maschine unentwegt. Aber manchmal schien es, als würde sie nachdenken. Wie jetzt. Die Plasmatypografen stellen ihre Bewegungen ein, unbeschriebenes Gewebe drängt hervor und in dem Loch der zerrinnenden Bedeutungslosigkeit formt sich aus der Leere eine Frage. Viele Fragen. In diesen Augenblicken steigt die Anspannung derart, dass sie zum Greifen scheint. Im Inneren der Maschine konkludieren komplexe Formeln, werden zerlegt und neu zusammengesetzt. Determinanten werden herangezogen, analysiert und zu Prozessen geformt. Zahlenreihen werden codiert und in die Semantik der Sprache gebettet. Ein Typograf holt aus, wie ein Dirigent sein Orchester zum Crescendo führt, schlägt auf dem Höhepunkt aller Erwartungen zu und formt Gewebe. Die Spannung hebt sich um eine weitere Nuance, bis der Kardinalpräfekt die Exegese beendet hat und flüsternd das WORT einem ausgewählten Ohr verkündet. Ebenso geheimnisvoll, wie die Maschine Informationen gebiert, verbreiten sie sich hinter vorgehaltenen Händen, bis ein jeder von ihnen weiß. Die Liturgie zur anstehenden Konklave wurde benannt, die Nachricht wird umgehend mit dem nächsten Luftschiff nach Marrakesch verschickt.
Sie stehen am Rand einer Wüste, die sich bis zum Horizont erstreckt, hinter sich eine Okkulathalle, wo die Ernte gereinigt, gewogen und der Reinheitsgrad bestimmt wird. Einfache, weiße Gebäude, die flirrend in der Hitze stehen. Ignatius wischt sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. Das Vorkommen ist schier unvorstellbar. Selbst in seinen kühnsten Träumen hätte sich Ignatius solche Mengen Okkulat nicht vorstellen können. Es wird von ausgewiesenen Sammlern mit der Hand geerntet, faustgroße Brocken sind keine Seltenheit. Ignatius verfolgt den Ablauf von der Ernte bis zum Transport und kann an keiner Schnittstelle Möglichkeiten finden, wie das Okkulat verunreinigt werden könnte.
»Gut«, sagt er an seinen Dolmetscher gewandt, »ich habe genug gesehen.« Mit der Dampfdroschke fährt er zurück zu seiner Unterkunft. Wenn es nicht das Okkulat ist, was ist es dann, was die Maschine zu … Fehlern verleitet? Bei diesem Wort zieht sich Ignatius der Magen zusammen. Die Maschine macht keine Fehler, reagiert er beinahe physisch auf diesen frevlerischen Gedanken.
In seiner Residenz wartet eine Nachricht aus dem Vatikan auf ihn. Schwindelig vor Zweifel nimmt Ignatius sie dem Boten aus der Hand, holt das Pergament aus dem versiegelten Umschlag und beginnt auf dem Weg vom Foyer in seine Suite zu lesen. Im Aufzug nach oben hält die Kabine zischend und Ignatius taumelt, erschüttert durch die neue Kunde aus seiner Heimat, in seine Gemächer. Die Liturgie zur anstehenden Papstwahl, so bestimmt die Maschine, erfährt zum ersten Mal seit Jahren, Jahrzehnten gravierende Veränderungen. Ignatius vergleicht mühelos aus seinem Wissensfundus das kleinste Detail damaliger Konklaven mit jenen der bevorstehenden. Abfolge, Speisen, Einladungen, alles soll in Nuancen oder in der Gesamtheit verändert werden. Warum? Eine weitere Botschaft, Worte der Offenbarung: Ein Reisender findet Wahrheiten.
Ignatius muss sich setzen. Wahrheiten. Er schluckt. Wahrheiten! Wie kann es mehrere Wahrheiten geben? Wie kann die Maschine mehrere Wahrheiten zulassen, wo es nur die eine Wahrheit gibt? Was passiert hier? Ignatius weitet den Kragen seines Hemds und reibt sich die Schläfen, als es an seiner Tür klopft. Er steht auf, besinnt sich und öffnet sie. Eine junge Frau steht vor ihm, die Haare kurz geschnitten, das Gesicht hübsch, aber nicht schön. Und Ignatius kennt sie, weiß aber nicht woher. Er beherrscht seine aufkeimende Unsicherheit. Von Berufs wegen sollte er imstande sein, einmal getroffene Persönlichkeiten beim Namen zu nennen, sie doch zumindest, sofern sie sich nicht vorgestellt wurden, einer Begebenheit zuordnen zu können. Er versagt. Weder Name noch Begebenheit fallen ihm ein und dieser Umstand behagt ihm nicht.
»Verzeihung«, sagt sie, »ich bin Suleika, eine Nichte des Sultans. Er trug mir auf, Euch zur Grabstelle unserer Göttin zu führen. Ich bin die Hüterin des Grabes.« Sie verbeugt sich leicht und er erwidert diese Geste.
»Der Sultan ist verhindert?«, fragt Ignatius ohne Rücksicht auf einen diplomatischen Fehltritt nach.
»Nein, aber er möchte, dass ich Euch begleite«, sagt sie, dreht sich, ohne eine Antwort abzuwarten, um und geht. Ignatius steht mit offenem Mund in der Tür, zögert und folgt ihr dann.
Auf dem Weg mit der Dampfdroschke durch die engen, staubigen Gassen Marrakeschs kann Ignatius seine tastenden Blicke über das Antlitz Suleikas nicht verhindern. Suleika sitzt still und erhaben, den Blick aus dem Fenster gewandt, vor ihm. Woher bloß? Es lässt ihm keine Ruhe, er kann sich nicht einmal, wie von ihm beabsichtigt, den Weg zur Grabstelle merken. Woher kenne ich sie? Die Droschke hält zischend, Ignatius wird aus seinen Überlegungen gerissen und steigt, Suleika folgend, aus. Weiß getünchte Wohnhäuser strahlen im Schein der Sonne, Hühner stieben auseinander und Wäsche hängt als bunte Flecken über der Gasse zum Trocknen aus. Ignatius hat etwas anderes erwartet, er blickt fragend zu Suleika, die zielstrebig auf ein Haus zugeht und im offen stehenden Eingang verschwindet. Ignatius folgt ihr. Ein einfacher Raum mit einem niedrigen Tisch. Zwei Männer sehen über ihren Teetassen auf und nicken Suleika zu, ohne sich zu erheben.
»Folgt mir!«, fordert sie ihn auf, ihr hinter einem Vorhang eine nach unten führende Treppe ins Dunkel nachzugehen. Es ist deutlich kühler hier, Ignatius hört ein kurzes Zischen und augenblicklich flackert das Licht einer Öllaterne auf. Er blinzelt, um sich an das Licht zu gewöhnen, eine zweite Lichtquelle erwacht, seine Augen erfassen einen Raum. Ein schlichtes Bett steht vor ihm, daneben eine Anrichte. In dem Bett liegen die Gebeine eines Menschen, die Gebeine der Göttin, die Gebeine von …
Ignatius stöhnt auf, fasst sich an die Brust und starrt auf einen Ring an dem Fingerknochen der Verstorbenen. Er starrt auf einen gewundenen Stab auf der Anrichte, auf ein zusammengelegtes Gewand und rezipiert die Worte im Brief Lukas:
Und Lucardus ging, mit nichts weiter als seinem Stab und seinem Gewand, um die Botschaft zu verkünden. Und er wandte sich um und sagte: Wohin ich auch gehe, mein Geist wird zurückkehren.
Ignatius atmet laut aus, sein Blick erfasst ein weiteres Mal das liegende Skelett, den Schädel, den Brustkorb, die Beckenknochen.
»Das ist Eure Göttin?«, fragt er, seine Stimme klingt rau.
»Das ist unsere Göttin, sie starb hier in diesem Haus. Kurz nach ihrer Niederkunft«, antwortet Suleika hinter ihm stehend.
Ignatius nickt, den Zusatz nicht sofort registrierend, überlegt, und ein Schauer durchfährt ihn.
»Niederkunft?«, haucht er die Frage.
»Sie gebar einen Sohn und eine Tochter, die Gründer des heutigen Sultanats.«
Ignatius schluckt trocken, dreht sich um und geht.
»Ich muss gehen«, sagt er. »Sofort!«
Während im fernen Marrakesch der Substitut Corovan Ignatius in seinem Gemach verzweifelt versucht, die Stimmen der Häresie zu ersticken, herrscht in den wuchtigen Gemäuern des Vatikans das strebsame Treiben geschäftiger Vorbereitungen. Die Maschine hat die Litanei des Konvents bestimmt und es gilt, die Anforderungen zu erfüllen. Soutanen wehen eilenden Schritten hinterher, im Minutentakt fahren Dampfdroschken ratternd über das Kopfsteinpflaster, beliefern den Kirchstaat mit notwendigen Gütern von außerhalb, Stimmen erheben sich zu Rufen und Anweisungen und selbst der ruhig einkehrende Herbst scheint von dem Treiben angesteckt und scheucht im aufkommenden, kalten Wind Blätter vor sich her. Derweil versammeln sich die stimmberechtigten Kardinäle zu einem informellen Treffen in der sixtinischen Kapelle, besprechen das anstehende Protokoll und beenden die Zusammenkunft mit einem gemeinsamen Mahl. Biss um Biss werden die Speisen verzehrt.
Proteine – zu Recht tragen sie den Namen Molekularmaschinen und gleichen damit semantisch dem großen Vorbild, das jenen Prozess, der nun beginnt, ersonnen hat – werden aufgenommen, biochemische Prozesse angestoßen und in einigen der Speisenden beeinflussen sie ein seit längerer Zeit inhärentes Wirt-Gast-System. Die Marinaden sind es, die jetzt und bis zur Konklave, die Träger des Wirt-Gast-Systems mit Essigsäure versorgen. In so wohl dosierten Mengen, dass der oktaedrische Nanocontainer, den sie in sich tragen, beständig einer Denaturierung unterworfen wird, bis er jene Stoffe freisetzt, die die Maschine ihrerzeit gewünscht hatte. Unwissend füllen sich die auserwählten Kardinäle weitere Soßen auf, verspeisen sie ahnungslos und spüren keinen Schmerz bei dem in ihnen ausgelösten Lochfraß.
Ignatius fühlt sich in seinem Glauben erschüttert. Seine Abreise wünschte er ohne zeremonielle Festivitäten, so kam es, dass er nun dem Sultan zum Abschied in seinem schwebenden Palast gegenübersteht, die Schultern hängen, sein Blick ist getrübt und er findet kaum die richtigen Worte, vielmehr bringt er stammelnd diplomatische Phrasen hervor und hofft, dass die Unterhaltung in Kürze ein Ende erfährt. Der Sultan erkennt die Gemütslage seines Besuchers und weiß darauf keinen angemessenen Umgang.
»Verzeiht, ich sehe, Ihr seid nicht wohlauf und freut Euch verständlicherweise auf Eure Abreise. Darf ich darum bitten, dass meine Nichte Suleika Euch begleiten wird?« Als hätte sie die Unterhaltung mit angehört, öffnet sich eine Tür und sie tritt herein. Ignatius ist zu schwach, um überrascht zu sein.
»Ja«, antwortet er und will zu seinem Luftschiff. Der Sultan ist mit einem Schritt bei ihm und hält ihn sanft fest.
»Bitte achtet gut auf sie, sie ist ein ganz besonderer Mensch.« Der Sultan sieht Ignatius ernst an und Ignatius nickt. Er hat verstanden und dennoch nagt erneut die Frage in ihm, woher er Suleika wohl kennen könnte.
Ignatius, als Substitut des erkrankten Staatssekretärs zwar einer, wenn nicht sogar der wichtigste Mann im Kirchenstaat, aber kein stimmberechtigter Kardinal, steht mit hinter dem Rücken verschränkten Händen am Fenster und beobachtet zum wiederholten Male den Schornstein der sixtinischen Kapelle. Wie die Maschine prophezeit hat, stieg am siebten Tag schwarzer Rauch auf, es hatte keine Einigung unter den achtunddreißig wählenden Kardinälen gegeben. Und wie die Maschine prophezeit hat, soll am vierzehnten der neue Hirte gewählt und verkündet werden. Es wird einen Umbruch geben. Seither schweigt die Maschine und heute ist der vierzehnte Tag. Ignatius winkt einen Bediensteten herbei.
»Wo ist die Nichte des Sultans?« Suleika war heute Morgen nicht in ihrem Zimmer gewesen, er hatte sie gesucht, aber nicht gefunden. Er hatte sie vermisst? Möglich, aber Ignatius will es sich nicht eingestehen. Sie ist ein besonderer Mensch, hatte der Sultan gesagt, Ignatius kann das bestätigen. Der Bedienstete verneint, Ignatius’ Miene verzieht sich. Er verscheucht ihn mit einer flüchtigen Handbewegung und fokussiert seinen Blick wieder auf die Kapelle. Rauch? Ignatius sieht genauer hin. Rauch! Sein Herz schlägt schneller, seine Unsicherheit, seine durch die auf der langen Reise gewonnenen Erkenntnisse und die dadurch aufgeworfenen Fragen, all dies kann er zukünftig seinem Oberhaupt anvertrauen und auf Lösung in dieser schwierigen Zeit hoffen. »Fumata! Fumata!«, schallt es von draußen herauf und Ignatius eilt auf den Petersplatz, um der Verkündung beizuwohnen. Name um Name nennt er gedanklich, hofft und bangt, ehe er an den Soldaten vorbei seinen Platz in guter Sicht auf die Benediktionsloggia einnimmt. Um ihn herum schwillt das erwartungsvolle Tönen einer aufgeladenen Menschenmenge an, Tauben steigen aufgeschreckt auf, immer noch eilen Interessierte herbei. Das große Fenster öffnet sich, ein Raunen brandet auf und zögerlich tritt der Kardinalprotodiakon hervor. Ignatius kennt ihn gut und wundert sich über dessen Unsicherheit. Eine einfache Geste und die Menge verstummt. Man hört das Flattern der Tauben.
»Annuntio vobis gaudium magnum!1 «
Ohne es zu wissen, bewegt Ignatius die Lippen. Er ist nicht der Einzige. Unzählige Augenpaare ruhen auf dem kleinen Punkt und lauschen der etwas heiseren Stimme, die über Klangverstärker über den Platz weht.
»Habemus Papam!«2
Einzelne Jubelrufe, eine ältere Frau in Ignatius’ Nähe sackt ohnmächtig zusammen und wird von helfenden Händen aufgefangen.
»Eminentissimum ac Reverendissimum…Dominum …«3
Ignatius wird misstrauisch ob der eingelegten Pause, blinzelt, kann aber keine Anhaltspunkte für einen Verdacht in welche Richtung auch immer finden. Aber es war nun mal sein Beruf, Verdacht zu hegen. Er entspannt sich und wartet etwas ungeduldig auf die weiteren Worte.
»… qui sibi nomen imposuit Lucardus II!«4
Ignatius reißt die Augen auf. Es fehlten wichtige Versatzstücke. Welcher Kardinal ist gewählt worden und wer maßt sich an, den Namen Lucardus II zu tragen? Er ist entsetzt und erst jetzt beginnen auch andere, den Bruch in der Liturgie und die Frechheit in der Namensgebung zu erkennen. Der Kardinalprotodiakon tritt zur Seite, eine Gestalt schält sich aus der Fensteröffnung neben ihn, zierlich, doch von einer unerklärlichen Aura umgeben und Ignatius weiß nun, woher er Suleika kennt. Es ist das Antlitz Lucardus’, welches er jahrzehntelang in seinen Studien sah, das ihm leibhaftig in Suleika all die Zeit zugegen war. Tränen schießen ihm in die Augen, er zittert.
Lucardus II tritt an die Brüstung.
Stoßend zischt Dampf, ein Typograf erhebt sich aus seinem Schlaf und schlägt an.
Lucardus II sagt:
»Es ist ein neues Zeitalter angebrochen!«
1 Ich verkünde euch große Freude.
2 Wir haben einen Papst.
3 Seine Eminenz den Hochwürdigsten … Herrn …
4 … welcher sich den Namen Lucardus II gegeben hat.
25. Jul. 2012 - Vincent Voss
Bereits veröffentlicht in:
|
|
QUANTUM
M. Haitel (Hrsg.) |
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info



