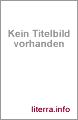|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Phantastik > Wissenschaftliche Erzählungen |
Wissenschaftliche Erzählungen
| WISSENSCHAFTLICHE ERZÄHLUNGEN
Buch / Phantastik |
Charles H. Hinton: "Wissenschaftliche Erzählungen"
Anthologie, Hardcover, 152 Seiten
Edition Büchergilde 2007
Mit dem zehnten Band der von J. L. Borges herausgegebenen Bibliothek von Babel finden sich zum ersten und im Grunde letzten Mal die Wurzeln der Science Fiction in der Sammlung phantastischer Erzählungen vertreten. Der Klappentext spricht scientific romances, ein Begriff, der später sowohl auf die Kurzgeschichten des deutschen Autoren Carl Grunert als auch eine Reihe von frühen Pulpgeschichten angewandt worden ist. Im vorliegenden Fall eine verwirrende Interpretation, denn der Autor Charles Howard Hinton, über welchen es so gut wie kein biographisches Material gibt, legt gleich in seiner Einleitung Wert, sich von Satiren und gesellschaftskritischen Texten wie „Flatland“ abzugrenzen. Borges stellt allerdings heraus, dass Hinton zumindest im 19. Jahrhundert unter anderem auch von H.G. Wells gelesen worden ist, der seine Einleitung der „Zeitmaschine“ an einen Text Hintons anlehnte. Die vier Texte bestehen im Grunde aus zwei kurzen „Vorwörtern“, in denen Hinton seine Prämissen erläutert und zwei Geschichten, von denen eine mehr einem Essay ähnelt, während die andere eine kritische Parabel darstellt.
Hinton entwickelt insbesondere in der „Einleitung“ die Prämisse einer Welt von nur zwei räumlichen Dimensionen, welche in „Flatland“ und später in Hal Clements „Schwerkraftwelten“ und Robert Forwards „Drachenei“ im Mittelpunkt gestanden haben. Es empfiehlt sich, „Flatland“ zumindest in groben Zügen zu kennen, um Hintons Gedankenexperimenten im Kontrast zu der satirischen Erzählung folgen zu können. Ganz bewusst lehrhaft geht der Autor vor: es beginnt mit einem Tisch, auf dem sich Scheiben aus Papier befinden. Das ist die Welt, um die es sich dreht. Die beiden einzigen Bewegungsrichtungen sind vorwärts und rückwärts. Aus dieser Ausgangsprämisse heraus beginnt Hinton über mögliche soziale Kontakte zu spekulieren, die in sein Essay „Eine flache Welt“ einfließen. Neben den sozialen Kontakten beginnt Hinton zu spekulieren, wie die Häuser dieser Bewohner aussehen könnten, wie sie an einander vorbeikommen, sollten sie sich auf den Straßen begegnen und schließlich spekuliert er über die einzigartige Psysiognomie der Bewohner. Seine sehr trocken, aber nicht langweilig vorgetragenen Theorien unterlegt der Autor mit anschaulichen Graphiken. Das es ihm nicht mit allem Ernst ist, zeigt sich, wenn er im ableitenden sozialen Verhalten davon spricht, dass die Väter ihre Söhne nur ins Gesicht schauen können, wenn sie ihre Söhne auf den Kopf stellen. Die nächste Generation lässt sich dieses Verhalten nur eine kurze Zeit Gefallen. Impliziert stellt sich der Leser die Frage, wie diese fremdartigen Wesen sich überhaupt fortpflanzen können. Es sind faszinierende Spekulationen, ohne Augenzwinkern vorgetragen, welche die Lektüre der schon oben angesprochenen exemplarischen, aber empfehlenswerten Werke bereichert.
Der kürzeste Text „Was ist die vierte Dimension“ stellt einen – wie sich später zeigen wird – einflussreichen Artikel dar, in welchem Hinton der Zeit die vierte Dimension zuordnete. Albert Einstein wird Hintons Gedanken später aufnehmen und extrapolieren. Leider enthält die Sammlung nur die Einleitung zu einem wahrscheinlich umfangreicheren Werk. Im vorliegenden Fall wirkt die Kompaktheit der Bibliotheksbände kontraproduktiv. Es wäre sinnvoller gewesen, noch ein oder zwei mehr von Hintons wissenschaftlichen Thesen – der Titel Erzählungen führt ihn die Irre, denn dem Autoren geht es weniger um Prosa als Essay – zu veröffentlichen. So wirkt der Band unstrukturiert und die längste Parabel „Der König von Persien“ nimmt zwei Drittel des Inhalts der Sammlung ein.
„Der König von Persien“ wird auf der Reise durch sein Reich von seinen Begleitern getrennt. Er gelangt in ein abgeschlossenes, weites Tal. Die Bewohner erleiden Lust oder Schmerz bei jeder ihrer Handlungen und ein Weiser zeigt dem König, wie er einen Teil des Schmerzes übernehmen kann. Mit diesem einfachen Trick sollen die Bewohner vor der bisherigen Lethargie gerettet werden. Der König beginnt nach und nach eine Gesellschaft zu formen, während er seinen neuen Untergebenen suggeriert, dass sie bei ihren Handlungen nur Lust empfinden. Dabei kann er als Herrscher keinen direkten Einfluss nehmen und während sein Volk aufzublühen beginnt, vereinsamt er mehr und mehr. Ganz bewusst hat Hinton den historischen Hintergrund der Geschichten aus „1001 Nacht“ gewählt, welche insbesondere im 19. Jahrhundert auch im Zuge der sich weiter verbreitenden Abenteuerliteratur immer populärer wurden. Im Vergleich zu vielen anderen Fabeln oder Parabeln ist in diesem Fall der Hintergrund der Geschichte – das Tal mit seinen sonderbaren Eigenschaften – eng mit den Handlungen des Königs und seiner Reaktion auf das Volk abhängig. Damit verliert der Plot insbesondere zu Beginn seine Allgemeingültigkeit und nimmt sich einen Teil seiner Effektivität. Hinton hängt seine Parabel an den vier im Grunde klassischen charakterlichen Eckpunkten auf: der König, der sich anfänglich als lernwillig, schließlich aber als Opfer seiner eigenen Macht sieht, der „Magier“ - im vorliegenden Text Demiurg genannt, welcher ihm die Macht „schenkt“, der Schüler, welcher die mächtigen Unterstütz und als gesichtslose Masse das Volk, das den neuen Ideen folgen soll. Hinton macht sich nicht einmal die Mühe, den einzelnen Figuren Namen zu geben. So behält seine Parabel eine gewisse Allgemeingültigkeit, die er allerdings wie schon angesprochen mit seinem exklusiven Hintergrund - dem Tal - negiert. Der grundlegende Plot ist geradlinig, auch wenn der Handlungsbogen einige Generationen umfasst. Hinton untersucht das menschliche Handeln auf der Basis des Egoismus und der Vorteilsname. Diese Botschaft arbeitet der Autor sehr scharfsinnig und teilweise auch scharfzüngig heraus. Politisch aktueller ist Hintons ungewöhnliche Botschaft, dass Gesellschaftssystem, die nicht von der Mehrheit des Volkes mehr oder minder bereitwillig getragen werden, auf LANGE Sicht nicht überlebensfähig sind. Die letzte Ebene ist die Glaubensfrage. Kann ein Gott auch böse Taten zu lassen? Wird er dadurch nicht automatisch weniger gut ? Mit dieser zeitlosen Frage setzt sich Hinton sehr intensiv auseinander, ohne dass er eine Lösung anbieten kann oder will. Der Text liest sich insbesondere im Vergleich zu den sekundärliterarischen anderen Beiträgen sehr flüssig, die Dialoge sind pointiert, der Stil ganz bewusst an die arabischen Märchen angelehnt, um im Verlaufe damals wie heute aktuelle, vor allem insbesondere in den alten Zivilisationen heiß diskutierte Themen zu analysieren. Zwischen durch schweift Hintons allerdings in seine pseudowissenschaftlichen Erklärungen der Schmerz - Einheiten und der Reaktionen der Menschen auf die wachsenden Anforderungen. Impliziert scheint sich nur der einfachste Urmensch seiner extremen Emotionen erfreuen zu können. Im Vergleich zu H. G. Wells deutlich pessimistischeren utopischen Modellen konzentriert sich Hinton in erster Linie auf seine theoretischen Elfenbeintürme. Mit der Fabel hat der Autor erfolgreich versucht, seine Gedankenmodelle in die Form einfacher, aber effektiver Prosa umzusetzen. Der Leser muss sich allerdings im Klaren sein, dass in diesem Band im Grunde keine wissenschaftlichen Erzählungen präsentiert werden, sondern Utopien und Parabeln. Dabei legt Hinton deutlich mehr Wert auf den Inhalt als die Form. Wer sich intensiv mit der Geschichte der Science Fiction auseinandersetzt, wird mit der Entdeckung dieses vergessenen Autoren den Bogen zwischen den ersten politischen Utopien insbesondere des 17. Jahrhunderts und den utopischen Romanen eines H.G. Wells vervollständigen können. Alleine aus dieser literarturhistorischen Sicht lässt sich die Aufnahme Hintons in die „Bibliothek von Babel“ rechtfertigen, auch wenn seine Arbeit aus den anderen Bänden aufgrund ihres Inhalts heraus sticht. Wie viele Texte aus den vorangegangenen Jahrhunderten keine einfache Lektüre, es lohnt sich allerdings, Hintons Thesen und Ansichten insbesondere aus der längeren Parabel herauszuarbeiten.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info