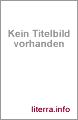|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Phantastik > Das Haus der Wünsche |
Das Haus der Wünsche
| DAS HAUS DER WÜNSCHE
Buch / Phantastik |
Rudyard Kipling: "Das Haus der Wünsche"
Anthologie, Hardcover, 168 Seiten
Edition Büchergilde 2007
Heutzutage ist Rudyard Kipling in erster Linie durch seine Dschungelabenteuer - „Kim“ und „Das Dschungelbuch“ - noch bekannt. Wahrscheinlich weniger durch die originalen Texte, sondern die verschiedenen Verfilmungen. Dabei wird außer acht gelassen, dass Kipling für sein Werk mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Der 1865 in Bombay geborene Kipling hat den Kolonialismus des britischen Imperiums in seinen Jugendjahren selbst erlebt. Erst mit sieben Jahren ist er nach England gekommen. Trotzdem hat er immer mit Achtung vom britischen Empire geschrieben, auch wenn seine Haltung gegenüber der britischen Politik durchaus als kritisch zusammengefasst werden kann. Es ging ihm in seinen sehr unterschiedlichen Geschichten immer um das Schicksal des Individuums in einer komplexer und politisch werdenden Welt. Nicht alle Texte dieser Sammlung sind wirklich phantastisch, aus heutiger Sicht sind sie aber alle exotisch. Das Themenspektrum ist ungewöhnlich breit. Von der klassischen Abenteuergeschichte, für welche Kipling so berühmt geworden ist, bis zu den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Kipling kehrt schließlich mit siebzehn Jahren nach Bombay zurück und begann dort seine für ihn so markanten Geschichten zu verfassen. 1936 starb er hoch geehrt in London. Borges geht in seinem ausführlichen Vorwort auf die Stärken und Schwächen Kiplings Werk und vor allem seine Position zwischen Bernhard Shaw und H.G. Wells als britischer Schriftsteller ein.
Die Titelgeschichte der Sammlung „das Haus der Wünsche“ zeigt Kiplings Stärken, aber auch Schwächen. Zwei alte Frauen erzählen sich gegenseitig an ihren nicht einfachen Leben- dabei erkennt der Leser Kiplings innere Verbundenheit mit dem britischen Imperium. Auf der implizierten Handlungsebene ist es die Geschichte großer Lieben, aber auch großer Opfer. Kipling arbeitet mit Symbolismen, für den Leser bedeutet das gleichzeitig, dass er sich erst in den Text hereinarbeiten muss, um die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ebenen zu verstehen. Der Auftakt dieser Sammlung ist so gänzlich anders von seinen eher an ein jugendliches Publikum gerichteten Geschichten wie „Kim“ oder „Das Dschungelbuch“, dass man doch seine Zeit und ein wenig Muße braucht, um diese Prämissen zu akzeptieren. Eine gewisse Lebenserfahrung hilft dann, um die nicht immer von Kipling gänzlich ausgearbeiteten Ideen – die einzige Schwäche der unterhaltsam, wenn auch gesetzt konzipierten Story – zu verstehen. Wie Borges in seinem Vorwort pointiert anmerkt, reagieren die beiden älteren Frauen weder auf das Alltägliche noch das Wundersame mit dem gleichen Minenspiel. Diese stoische Haltung gegenüber dem Leben und dem ganzen Rest verwirrt auf den ersten Blick, die Pointe muss sich an die Oberfläche der Geschichte kämpfen. Die nächste Geschichte „Ein Krieg der Sahibs“ hat Kipling wahrscheinlich zuerst in einem indischen Dialog geschrieben und dann ins Englische übersetzt. Auf der einen Seite macht es diese affektierte Erzählstruktur unzugänglicher, auf der anderen Seite versteckt diese stilistische Eigenart allerdings Kiplings kritische Botschaft. Die kleine bitterböse Story wird in erster Linie den Anhängern von „Der Mann, der König sein wollte“ gefallen, auch wenn der Autor gänzlich auf eine westlich- imperialistische Perspektive verzichtet hat. Leider bleiben dem Leser die Charaktere fremd und teilweise scheint sich Kipling zu sehr am Geschmack seiner britischen Landsleute in Hinblick auf die devote Haltung der Inder ihren Kolonialherren orientiert zu haben. Wie sehr die unmenschlichen Vernichtungsorgien des Ersten Weltkriegs die Soldaten für ihr Leben gezeichnet hat, arbeitet Kipling sehr prägnant und intensiv in der nächsten Geschichte „Eine Madonna im Schützengraben“ heraus. Der Protagonist wird von seiner Begegnung mit einem Gespenst (?) noch Jahre nach Ende des Krieges heimgesucht. Wie in verschiedenen anderen Antikriegsgeschichten - siehe auch Vonneguts „Schlachthof 5“ - versucht Kipling das Unfassbare in einfache, aber einprägsame Bilder zu bannen. Dem Autoren gelingt es, die Endzeitstimmung in der Schützengraben, die Leichenberge und die greifbare Verzweifelung der jungen überforderten Soldaten sehr gut darzustellen. Das in dieser Umgebung die Begegnung mit dem Übernatürlichen keine Bedrohung, sondern fast einen fatalistischen Ausweg darstellt, wird von Kipling überzeugend und vor allem auf eine geradezu simple Art impliziert. Wie in allen seinen Geschichten gibt es keine vorgefertigten Antworten, der Leser muss sich seinen Weg durch den Dschungel des menschlichen Lebens kämpfen. Damit stellt ihn der Autor auf die gleiche Stufe wie seine Protagonisten. Mit der Kirche als Hort des Aberglaubens und vor allem als Verhinderer des Fortschritts setzt sich Kipling in „Das Auge Allahs“ auseinander. Er reduziert die Kirche auf den Abt eines Klosters, kann so sich besser mit den sehr ambivalenten Positionen der Vertreter des wahren Glaubens auseinandersetzen. Ein Mönch bringt ein Mikroskop mit, dass er einer ausgewählten Anzahl von Menschen zeigt. Die zwei Ärzte entdecken unter dem Mikroskop Krankheitskeime, ihnen gelingt es allerdings nicht, die richtigen Schlüsse ziehen, weil der Abt in seinem Gott als allwissender Schöpfer Bild getroffen die richtige Erkenntnisse sehr gezielt und effizient verhindert.,
Die Kritik an der Kirche ist nicht nur sehr direkt und aggressiv, allerdings gelingt es Kipling nicht, diesen spürbaren Konflikt zwischen den Wissenschaft und dem Glauben nachhaltig und pragmatisch genug herauszuarbeiten. Der Leser hat in einigen Passagen dieser Geschichte des Gefühl, als fehlte Kipling plötzlich der Mut, seine Idee bis zum bitterbösen Ende zu durchdenken. Das Sujet selbst ist interessant extrapoliert, im Vergleich zu den anderen Geschichten der Sammlung sind die Figuren dreidimensionaler und überzeugender gezeichnet worden. Das sie hier nur stellvertretend für ihre Glaubensrichtungen und Ansichten agieren, steht außer Frage, aber Kipling gibt ihnen zumindest eine adäquate Bühne. Mit „Der Gärtner“ schlägt Kipling noch einmal den Bogen zum Ersten Weltkrieg. Mit ruhigen Tönen, sprachlich auch in der deutschen Übersetzung ansprechend schildert er die Suche einer Ziehmutter nach ihrem im Ersten Weltkrieg getöteten Sohn. Der Leser weiß im Gegensatz zu ihr, dass der Sohn schon gefallen ist. Für sie gilt er als offiziell vermisst. Ohne phantastische Elemente aber sehr einfühlsam gelingt es Kipling, im Leser das Bild des Verlusts, der Einsamkeit entstehen zu lassen. Kein Pathos, kein Versuch, den Irrsinn des Krieges überhaupt in Ansätzen erklären zu wollen, eine stumme Anklage gegen das Massenmorden insbesondere in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs.
Die hier versammelten fünf Geschichten sind sicherlich insbesondere die Leser, die bislang mit Kipling wenig oder gar nicht direkt vertraut sind, eine Offenbarung. Es empfiehlt sich, nicht mit den Erwartungen klassischer Abenteuerliteratur an die Texte heranzugehen. Kipling ist ein kritischer, aber nicht lauter Beobachter seiner Zeit gewesen, der sich manchmal zu Lasten der Atmosphäre und der Stimmigkeit bemüht hat, zutiefst menschliche Tragödien zu erzählen und seine Geschichten auf den Leser wirken zu lassen. Er weigert sich konsequent und nachhaltig, seine Plots weiter zu erläutern. Im Außenstehenden Betrachter entstehen eine Reihe von nicht immer angenehmen Bildern, die weiterführenden Erklärungen muss er sich selbst zusammenreimen. Die Sammlung unterstreicht, wie vielseitig Kipling in seinem langen Schaffen gewesen ist und vor allem wie stark er seine Umgebung und vor allem seine Zeit in seinen Geschichten reflektiert hat.
http://www.sf-radio.net/buchecke/bibliothek-babel/...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info