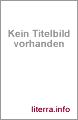|
|
Startseite > Rezensionen > Peter Schünemann > Science-Fiction > Robot Roderick. Kindheit und Jugend einer begabten Maschine |
Robot Roderick. Kindheit und Jugend einer begabten Maschine
| ROBOT RODERICK. KINDHEIT UND JUGEND EINER BEGABTEN MASCHINE
Buch / Science-Fiction |
In Heynes "Bibliothek der SciencefictionLiteratur" werden laut Klappentext ausschließlich "herausragende Werke dieser Literaturgattung" aufgenommen. Nun, Sladeks Romane, hier erstmals zum Doppelband vereinigt, haben dies auf jeden Fall verdient. Dem, der eine Schwäche für interessant gemachte Gesellschaftsbetrachtung, für (oft bitteren) Humor, für Satire oder einfach für Skurriles hat, kann ich die Lektüre der 800 Seiten, obschon sie nicht einfach ist, wärmstens empfehlen.
Die Story, die sich wie Patchwork aus einzelnen Episoden und Dialogen zusammensetzt mit vielen giftgrünen Fleckchen, um beim Bild zu bleiben beginnt mit dem Auftrag eines dubiosen NASABeauftragten an die eher zweitklassige Universität von Minnetonka, USA: Ein humanoider, für die Weltraumforschung geeigneter Roboter soll unter strengster Geheimhaltung entstehen. Ein Team, dessen Kopf und Herz der junge, geniale Workaholic Dan Sonnenschein ist, macht sich an die schwierige Aufgabe. Fortschritte zeigen sich da fliegt der Auftrag als gigantischer Schwindel auf. Zudem fürchtet Dan um sein "Kind": zu vielen Forschern auf dem Gebiet echter künstlicher Intelligenz und ihren Produkten passierten merkwürdige "Unfälle". Es steht zu befürchten, daß auch Roderick sowie seine "Väter" das Ziel von Anschlägen werden. Deshalb wird der kleine Roboter zu einer "normalen", also kaputten Familie in den mittleren Westen gegeben, die ihn wie ein "normales" Kind behandelt, das heißt einem Dauerfernsehbombardement aussetzt, schlägt und im übrigen kaum beachtet. Am Ende wehrt Roderick sich und kann mit etwas Glück zu den Adoptiveltern seines "Vaters" Dan entkommen. Ma und Pa Wood, sympathisch durch ihre hartnäckig bewahrten Träume und ihr Akzeptieren Rodericks als das, was er ist, sind wohl die mit Abstand sympathischsten Figuren des ersten Romans außer ihrem Schützling natürlich. Der Rest ist Schweigen.
Sladek wählt den Hintergrund des klassischen Bildungsromans mit all seinen Ingredienzen (freudlose Kindheit, Umhergetriebenwerden, Wanderschaft, IchSuche, vielfältige Berührung mit Menschen aller Couleur), um seine schonungslos realistische Betrachtung der modernen Gesellschaft (vorzugsweise, aber m.E. nicht nur der USA) umzusetzen. Roderick wird mit immer neuen Seiten, Institutionen und Typen des American Way of Life konfrontiert. Wie schon erwähnt, spielt die Universität von Minnetonka mit all ihren zynischen, depressiven, intriganten, verzweifelten, desillusionierten, desinteressierten, unfähigen oder einfach blöden Studenten und Professoren zu Anfang eine gewichtige Rolle. Da die NASA nicht mehr zahlt, sind Rodericks Schöpfer auf UniFinanzen angewiesen. Die Intrigen um die Gelder lassen tief blicken. Mit Wissenschaft hat all das nichts mehr zu tun. Die "geistige Blüte der Nation" ist degeneriert, kaputt, ausgebrannt.
Wenig später, als Roderick im Hause der Woods lebt und endlich wenigstens liebevolle Eltern kennenlernt, nimmt Sladek das Leben in einer "normalen" amerikanischen Kleinstadt aufs Korn. Höhepunkt: die Zeit, die Roderick in der Public school des fiktiven Ortes Newer verbringen muß. Szenen von schreiendster und bitterster Satire entfalten sich vor dem Leser. Das Lachen vergeht einem. Symptomatisch für das Desinteresse der Lehrer an den ihnen anvertrauten Kindern erscheint, daß Roderick bei ihnen als Junge gilt, der sich für einen Roboter hält: ein Schizoider. Eine Einstellung seiner Mitmenschen, die Roderick immer verfolgen wird.
Da sich der Junge nicht ins Schulgefüge einordnet wie soll er beim Treuegelöbnis die Hand aufs Herz legen, er hat doch keins (bedenkenswertes Bild!) und schließlich noch den Schulcomputer ruiniert, schickt man ihn in die katholische Lehranstalt, wo auch niemand mit ihm zurechtkommt. Sladek kritisiert in diesem Teil der Handlung eine Kirche, die längst zur Institution degeneriert ist und ihre Botschaft verkauft hat. Der Autor nutzt selbst den running joke, den immer wiederkehrenden Gag: Der spielversessene Pater O'Bride, Trainer der Schulmannschaft, kauft alles möglichst billig ein; die Folge ist, daß er sich ständig über neue (und köstlich unklerikale) Verballhornungen des Teamnamens auf der Spielerkleidung ärgern muß. Doch gibt es auch Priester, die über diesen Sportfanatiker hinauswachsen, Pater Warren zum Beispiel, der dem "verstockten" Roderick den Glauben vermitteln soll und dabei seinen eigenen verliert. (Anmerkung: "Verstockt" sind in Amerikas "freien" Schulen offenbar die Kinder, welche eigene Fragen stellen und nicht nur nachplappern.) Roderick führt mit dem von Philosophie und SF begeisterten Pater endlose Streitgespräche. Ein Schmeckerchen für Genrefans ist der Dialog, in dem der Roboter dem Priester die Unstimmigkeiten in Asimovs berühmten Drei Gesetzen der Robotik beweist und zwar mit zwingender Logik. Auch die Sciencefiction selbst wird von Sladek kritisch hinterfragt oder parodiert, wo es nur geht.
Episode folgt auf Episode, ein Dialog löst den anderen ab. Figuren tauchen für einige Sätze oder bestenfalls Seiten auf, verschwinden, tauchen zu ganz anderer Zeit an ganz anderem Ort wieder auf und sind doch zweifelsfrei identifizierbar, denn ihre abgedroschenen Sprüche und ihr Verhalten haben sich nicht geändert. Statisch angelegte Typen; wenige entwickeln sich. So entsteht das Bild einer Gesellschaft, die nicht mehr fähig ist, sich selbst zu kurieren. Nathaniel Hawthorne prägte einmal das Bild von der allseits geachteten Persönlichkeit, deren Seele einem glänzenden Palast gleicht aber irgendwo unter dem kostbaren Parkett liegt eine Leiche begraben. Nun, die Seelen der meisten Protagonisten des Romans erinnern dann schon eher an Leichenschauhäuser bei Hochbetrieb. In den hundertdreißig Jahren, die zwischen dem "Haus mit den sieben Giebeln" und "Roderick" liegen, hat Amerika sich gewaltig verändert. Sieht man Sladeks Roman in solchem Kontext, stellt sich die Frage, ob der Fortschritt wirklich diesen Namen verdient.
Unmöglich zu erkennen, was alles Parodie ist in diesen Büchern. Einiges bestenfalls bemerkt der USAUnkundige. So heißt der Hausarzt der Woods, der Pa vor dessen Herzschlag für kerngesund erklärt, spöttischerweise "Doktor Welby". Der unfähigste Mitarbeiter des "Väter"Teams erhält den Namen "Ben (ein zu klein geratener Benjamin?) Franklin". Die soap opera wird ironisiert, wenn am Ende Pa Ma und Ma Pa ist und er oder sie einst ein(e) SFSchriftsteller(in) war, deren (dessen) Kurzgeschichten Adoptivsohn Dan, den Vater von Adoptivenkel Roderick, zu seinen ersten Ideen inspirierten. TV-Gewinn-Shows, Sektenwesen, Okkultismus, Rassismus... Alles wird von Sladek aufs Korn genommen. So bleibt genug für ein bitterböses Lesevergnügen.
Der Autor setzt nicht vordergründig auf Spannung. Zwar ist da die Verfolgung durch das ominöse Institut, doch selbst das Thema "Killer" nutzt Sladek eher für Gags als für Thrill aus. Besonders das Ende des Jägers ist interessant. Ob Roderick der Verfolgung entgeht das sollte man selbst nachlesen.
John Sladek hat mit den beiden "Roderick"Romanen ganz sicher keine hard core SF geschrieben. Science und fiction bilden bei ihm ohnehin nur Aufhänger für eine großartige Gesellschaftssatire. SFVersatzstücke fügen sich an die des Mainstream, des Thrillers, des Kriminalromans. Und doch entsteht am Ende ein geschlossenes Bild. Die Synthese ist gelungen, die Möglichkeiten der Sciencefiction werden auf eindrucksvolle Art demonstriert, denn sie verleiht dem ganzen Text einen Hauch Besonderheit und viel Witz.
Etwas ähnlich Umfassendes, Klares und Tiefgreifendes wie Sladeks "Roderick"Bücher hätte das neue (?) Deutschland bitter, bitter nötig. Genügend Anlässe für Spott dürften sich zweifellos finden lassen.
<"Roderick" 1980 und "Roderick at Random" 1983, München 1992>
Der Rezensent
Peter SchünemannTotal: 138 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info