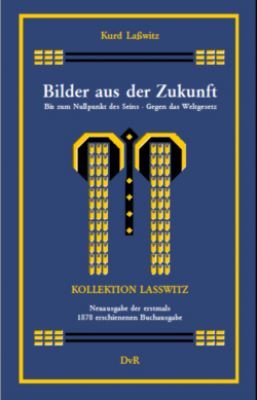|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science Fiction > Bilder aus der Zukunft |
Bilder aus der Zukunft
| BILDER AUS DER ZUKUNFT
Kurd Laßwitz Dieter von Reeken |
In der Vorrede zur dritten Auflage der gemeinsamen Ausgabe der beiden Novellen - 1871 und 1877 einzeln erschienen - unter dem Titel “Bilder aus der Zukunft Zwei Erzählungen aus dem vierundzwanzigsten und neununddreißigsten Jahrhundert” - im Verlag S. Schottländer 1879 veröffentlicht - spricht der Autor Kurd Laßwitz noch vor der Entstehung seiner utopischen Märchen und seinem einzigen echten Science Fiction Roman “Auf zwei Planeten” davon, dass die “Bilder aus der Zukunft” ein Versuch sind, Situationen und Konflikte in literarischer Form zu behandeln, wie sie bei fortschreitender Kultur- und Machtentwicklung der Menschheit für spätere Geschlechter entstehen können. Zwar geht es laut Laßwitz in der Zukunft anders her als in der Gegenwart, doch beiden Novellen verfügen über durchaus leicht erkennbare “gegenwärtige” Grundthemen. Das nicht alles wirklich ernst gemeint ist und die Geschichten in Laßwitz prägnantem humoristischen Stil alternierend mit packenden Beschreibungen verfasst worden sind, spricht für das schon früh in seiner Karriere ausgeprägte Selbstbewusstsein. In den Beschreibungen seiner Protagonisten verzerrt er die Gesichter seiner Protagonisten wie in einem Spiegellabyrinth auf dem Jahrmarkt, wobei - nicht ganz korrekt, aber als Abwehr gegen Kritiker gedacht - die dichterische Phantasie in den Grenzen bleibt, welche dem Autoren die Naturwissenschaften und die Geschichte auferlegt. Die Vorbemerkung zur ersten Auflage hat diesen Faden schon einmal aufgenommen. Hier spricht er von der berühmten Weltformel von Laplace, die schließlich die Bewegung der Atome enträtselt und damit wie eine Pandora Box alle Fragen der Menschen und vor allem Wissenschaftler löst. Laßwitz sieht seine Geschichten als Brücke bis zur endgültigen Auflösung dieser Formel, einen kleinen Blick in die Zukunft zu tätigen, ohne den Kontakt zur Realität zu verlieren. Wie der Herausgeber in seinem wieder bemerkenswert gut zusammengestellten Band der Kollektion Laßwitz herausstellt, ist alleine die Idee, einen Roman über diese Weltformel des Paplace zu schreiben, einen eigenen Roman wert. Ohne viel zu Theoretisieren legt Laßwitz sowohl in den Vorbemerkungen als auch der Vorgeschichte zu dieser Novellensammlung für sich den Rahmen fest, in welchem er als futuristischer Autor, aber nicht als Erzähler von utopischen Märchen agieren möchte. Die Trennung zwischen diesen beiden Subgenres ist in Laßwitzs Werk sehr stark spürbar. Der Autor sucht in dieser Frühphase seines Werkes für sich eine Position, in welcher er seiner Phantasie freien Lauf lassen kann - das gelingt insbesondere in den ersten Kapiteln der Novelle “Bis zum Nullpunkt des Seins” - und gleichzeitig dank des Stilmittels der Satire seinen Mitmenschen einen Eulenspiegel vors Gesicht halten kann. Als Lehrer und Pädagoge lesen sich die ersten Kapitel der zweiten Novelle “Gegen das Weltgesetz” mit der Idee eines programmierbaren Nürnberger Trichters ausgesprochen bissig, aber humorvoll. Herausgeber Dieter von Reeken hat den Band wieder mit einem ausführlichen und bebilderten Vorwort versehen, in welchem auf die Publikationsgeschichte der beiden Novellen einzeln und zusammen eingegangen wird. Im Verlaufe der Kollektion Laßwitz wird auf diese beiden frühen, aber Bahnbrechenden Novellen immer wieder eingegangen, so dass ihre überfällige Neuveröffentlichung im Grunde das Tor zum Vater der deutschen Science Fiction öffnet.
Kurd Laßwitz erste in einer fernen Zukunft spielende Erzählung “Bis zum Nullpunkt des Seins” erschien 1871- sie ist aber 1869 geschrieben worden - nach einigen kleineren humoristischen Beiträgen zum ersten Mal in der Schlesischen Zeitung. Aus dem Text lässt sich nicht nur einiges über sein späteres Hauptwerk “Auf zwei Planeten” ableiten, die Geschichte hat neben Carl Grunert mit seinen wissenschaftlichen Romanzen wahrscheinlich auch den unter Pseudonym schreibenden Tokko mit seinem Epos “Die Automatenstadt” beeinflusst. Noch faszinierender ist die Tatsache, das zumindest eine der bizarren Ideen durchaus von den französischen “Schwermetall” Comiczeichnern hätte umgesetzt werden können: das Geruchsklavier, das nach dem die Menschheit die Musik der Vervollkommnung zugeführt hat, der neuste Schrei geworden ist. Neben den Ohren soll die Nase mit der Musik aktiviert werden, da das Riechorgan der Menschen sich entgegengesetzt des technischen Fortschritts entwickelt hat. Eher ironisch übertrieben bezeichnet der Autor die Nase als Organ der Ideenassociation. Im ersten sehr distanziert geschriebenen Kapitel stellt Kurd Laßwitz seinen Lesern eine Meisterin der Geruchorgel vor: Aromasia, deren Eltern das Instrument schon beherrscht hatte. Die erste Hälfte der Geschichte lebt in erster Linie von der intelligenten und sehr facettenreichen Beschreibung der Zukunft im Jahre 2371. Wie auch in Tokkos Epos “Die Automatenstadt” hat die Menschheit ein Niveau erreicht, das die Grenze zur Dekadenz überschritten hat. Ohne auf die Hintergründe dieser technischen und wirtschaftlichen Entwicklung näher einzugehen - die Spaltung des Atoms lässt sich vielleicht als Katalysator bezeichnen - beschreibt Laßwitz auf den ersten Blick eine aus heutiger Sicht kaum noch erkennbare Menschheit. Der Leser stelle sich die Lustgärten aus Fritz Langs “Metropolis” auf einen ganzen Planbeten extrapoliert vor, um diese originelle und vor allem sehr pointiert geschriebene Einführung nachvollziehen zu können. Die Urlaubsreise in der Luftdroschke unter Ausnutzung der unterschiedlichen Zeitzonen zum Pyramidenhotel wird in leicht abgewandelter Form allerdings in “Die Automatenstadt” über mehrere Kapitel extrapoliert. Mit der Neuveröffentlichung beider Werke, zwischen deren Entstehung immerhin mehr als fünfzig Jahre gelegen haben, wird deutlich, welchen Einfluss Kurd Laßwitz auch auf späteren Schriftstellergenerationen gehabt hat. H.G. Wells wird die Idee des Schläfers in der zweiten Novelle "Gegen das Weltgesetz" nicht unbedingt von Kurd Laßwitz übernommen haben, aber Ähnlichkeiten sind durchaus vorhanden. Dieser hat seinen fränkischen Hausbesitzer und Rentier Friedrich Wilhelm Schulze nach dem amerikanischen Vorbild Rip van Winkle aus der Feder Irving übernommen haben. Schulze lässt sich mumifiziert in Tiefschlaf versetzen, wacht allerdings keine zweihundert, sondern zweitausend Jahre später auf. Diese kleine Episode nutzt Laßwitz zum einen, der typisch deutschen Spießer zu parodieren, welcher fit für die Zukunft gemacht wird, zum anderen aber auch, um eher unglaubwürdig und extrem konstruiert die Liebenden in den Hafen der Ehe zu führen und das letzte Hindernis - bis auf den Schurken, der wieder zu den Sternen strebt - aus dem Weg zu räumen. Die grundlegende Idee einer Zukunftschronik findet sich allerdings auch in H.G. Wells späteren Geschichten wieder. Für die Neuauflage hat Laßwitz darauf verzichtet, die beiden Texte miteinander zu verbinden. Zusammen gelesen runden sie allerdings erst die Erscheinung seiner "Bilder aus der Zukunft" zufriedenstellend bis teilweise wirklich Bahn brechend ab.
In der erste Novelle verläuft die Handlung - vielleicht von Laßwitz unglücklichen Liebesgeschichten beeinflusst - deutlich tragischer als in der zweiten Geschichte. Aber für den Autoren spricht, das er den Mut hat, mit seinen romantisch modernen Märchen sowohl Mann als auch Frau anzusprechen.
Es passt allerdings zum Dichter und nicht modernen Märchenerzähler Kurd Laßwitz, dass es in seinem Universum ein Element gibt, das nicht nur alle anderen Entwicklungen beeinflusst, das stärker ist als die ganze Welt, die minutiös auf den ersten Seiten dieser lesenswerten und zeitlosen Novelle entstanden ist: die Liebe. Aromaisa steht zwischen zwei Männern, die um sie mit sehr unterschiedlichen Mitteln streiten. Von Herz und Hirn zu sprechen wäre angesichts des bitterbösen Endes und vor allem der sehr unterschiedlichen Vorgehensweise vielleicht eine Überinterpretation. Im Mittelpunkt der Katastrophe steht ein Konzert auf dem Geruchklavier, das durch die Manipulation des Instruments fürchterlich außer Kontrolle gerät. Es gibt zwar in dieser futuristischen Welt kein Phantom der Oper, das für seine Liebe über Leichen geht, aber der grundlegende Plot kommt Leroux Tragödie schon sehr nahe und Laßwitz beschreibt den Tod von insgesamt fünf Menschen eher distanziert und beiläufig. Das Bild, das der Autor vor allem auch in sozialer Hinsicht zeichnet, wirkt gegen Ende der Geschichte ein wenig unstimmig.
Titeltechnisch ist für den Schriftsteller sicherlich der absichtliche oder fahrlässige Mord an Menschen der angesprochene Nullpunkt des Seins, der im übertragenen Sinne mit der Verbannung ins All auf ewig fortgeschrieben wird. In Hinblick auf die Strafen wirkt die Geschichte gerade zu revolutionär und absolut humanistisch für die Entstehungszeit. So glaubt der Täter, für seine fahrlässige Tötung von fünf Menschen nur mit zwei oder drei Monaten Zuchthaus und dann einer entsprechenden Verbannung bestraft zu werden. In einer Parabel fasst Laßwitz dann das grundlegende Geschehen noch einmal humoristisch überzeichnet zusammen, um dann den Vorzügen des Kapitalismus über die freie Kunst zu hofieren. Im Vergleich zu seinen späteren Arbeiten wie “Schlangenmoos” und “Sternentau” gehen die einzelnen, eher stilisiert als naturalistisch gezeichneten Figuren fast unter. Immer wieder greift der Autor bei wichtigen Szenen auf die Form der Beschreibung zurück und scheut die Dialoge. Diese stilistische Vorgehensweise lässt auf der einen Seite die Geschichte ungewöhnlich kompakt erscheinen, verwehrt aber auf der anderen Seite den Lesern ein wenig den Zugang zu den in der fernen Zukunft lebenden, aber tief in den Wirren der gegenwärtigen Liebe verwurzelten Charakteren. Weiterhin erdrücken die vielen kleinen Ideen - alleine die ersten beiden Seiten stellen ein Feuerwerk von teilweise skurrilen, dann bizarren und schließlich logisch durchdachten Einfällen dar - teilweise die Figuren. Erst auf den letzten Seiten gewinnen sie an Dreidimensionalität, auch wenn Kurd Laßwitz das Geschehen während des Konzertes mit einer unterschwellig satirischen Note erzählt. Um die Idee von Liebe und Eifersucht, von Verlangen und Leiden besser zugänglich zu beschreiben, hätte Laßwitz stärker an der Sympathieebene zwischen Leser und seinen Charakteren arbeiten müssen. So ist der eigentliche Plot im Grunde das schwächste Element der Geschichte, während der Hintergrund - vom Geruchsklavier über das Odoratorium, in welchem die Tragödie schließlich ihren Lauf nimmt bis zum Pyramidenhotel als Inbegriff der modernen, leicht dekadenten Freizeitgestaltung einer monetärer Probleme enthobener Elite - ungemein farbenprächtig und selbst einhundertfünfunddreißig Jahre nach der Erstveröffentlichung immer noch gut lesbar ist. Interessant ist die abschließende Idee, das Oxyden - der Name ist sicherlich kein Zufall - durch eine Kugel seine Existenz verliert und schließlich ins All transportiert wird. Tropfen und Kugeln spielen in Laßwitzs Werk immer besonders wichtige bzw. tragische Rollen. In Bezug auf sein Vorwort bleibt die dichterische Phantasie nur plottechnisch in ihren Grenzen, während insbesondere die naturwissenschaftlichen Punkte von der Prämisse der Atomspaltung sehr frei extrapoliert worden sind und eine historische Basis extra für diese interessante Zukunftswelt entworfen worden ist. Einen Bogen zurück in die nicht immer leichte Gegenwart schlägt Laßwitz mit einem kleinen Verweis auf die immer noch kriegerischen Auseinandersetzungen selbst in der fernen Zukunft.
Acht Jahre nach ihrer Entstehung bzw. sechs Jahre nach ihrer Veröffentlichung verfasste Laßwitz eine Fortsetzung zu “Bis zum Nullpunkt des Seins”, die mehr als tausend Jahre weiter in der Zukunft spielt. Beruflich ist Kurd Laßwitz inzwischen zum Doktor der Philosophie promoviert und arbeitet seit einem Jahr als Gymnasallehrer in Gotha. Seine Doktorarbeit ist im Rahmen der Kollektion Kurd Laßwitz schon erschienen und ist es sicherlich interessant, dass die Weltformel des Laplace bzw. das Aufspalten der Atome auch in seiner Doktorarbeit die gleiche Rolle spielt wie in seinen ersten literarisch phantastischen Arbeiten.
Mit “Gegen das Weltgesetz” hat Kurd Laßwitz äußerlich eine Fortsetzung zu “Bis zum Nullpunkt des Seins” geschrieben. Die noch weiter in der Zukunft angesiedelte Geschichte erschien in der Schleswigschen Presse. Laßwitz nimmt auch Bezug auf einzelne Ereignisse und Charaktere wie Amrosia aus der ersten Geschichte. Plottechnisch kopiert der Autor allerdings das zugrunde liegende Szenario einer Frau zwischen zwei Männern, von denen der eine nach dem Goethe´schen “und bis du nicht willig, so brauch ich Gewalt” vorgeht, während die Frau ihre wahre Liebe zu schützen sucht. Noch stärker als in der Auftaktstory stilisiert Laßwitz seine Figuren und manifestiert im übertragenen Sinne in ihnen Naturphänomene. Nicht umsonst heißt die Frau Lyrika und vertritt die schönen Geisteskünste, während der Widersacher Atom genannt wird. Alleine der Liebhaber Cotyledo ist ein Zwitter zwischen Forschung und Frohsinn. Auch wenn die eigentliche Geschichte nicht sonderlich interessant ist, sie marschiert rein mechanisch voran, unterstreicht der umfangreiche Hintergrund dieser extrem futuristischen Welt, die Autoren wie Olaf Stapledon sicherlich beeinflusst hat, Laßwizs Phantasie. Es beginnt - wie schon eingangs erwähnt - mit einer Satire auf die modernen Bildungsanstalten. Immerhin hat die Welt die deutschen Schulen als Vorbild genommen. Im Jahre 3877 gehört den Eltern ein Drittel der Rindenschicht des Gehirns der Kinder, ein Drittel wird für das Kind aufbewahrt, wenn sich der Intellekt ausgebildet hat und das letzte Drittel wird von einer öffentlichen Anstalt für allgemeine Bildung nach dem Paragraphen 111 des Unterrichtsgesetzes präpariert. Auch wenn Big Brother nach mehr als 75 Jahre entfernt ist, provoziert Laßwitz mit diesen Ideen das sozialistische Bildungssystem des deutschen Kaiserreichs. Wie mit einem Nürnberger Trichter werden die Gehirne der jungen Menschen mittels Datenübertragung und Fernunterricht mit einem Grundwissen ausgestattet. Die Eltern dürfen die Neigungen in Hinblick auf die Ausbildung ihrer Kinder bestimmen. In der vorliegenden Geschichte sind es Naturwissenschaften und Musik. Im zweiten Kapitel schlägt Laßwitz den Bogen nicht nur zu ersten Story, sondern in das 19. Jahrhundert und beschreibt an Hand vieler Beispielen und als Vorgriff auf H.G. Wells Zeitmaschine die Geschichte der Menschheit bis ins Jahr 3877. Dabei scheint der Mensch seinen intellektuellen, aber nicht technischen Zenit in “Bis zum Nullpunkt des Seins” erreicht zu haben. Dekadenz hat eingesetzt. Erst eine Reihe von Naturkatastrophen hat eine neue Barbarenschicht im Norden entstehen lassen, die mit ihrem kriegerischen Drang die technischen Paradiese der Menschheit bedroht und diese aus ihren paradiesischen Schlafzustand weckt. Auch wenn die Aufzählung dieser historischen Entwicklung den kaum vorhandenen Handlungsfluss der grundlegenden Story ausbremst, ist es faszinierend zu lesen, wie intensiv sich der Philosoph Laßwitz mit der Menschheit beschäftigt hat und einige soziale Strukturen intelligent extrapoliert hat. Eine Reihe von Autoren - unter anderem auch Isaac Asimov mit seiner “Foundation” Serie - werden auf die hier prophezeiten Visionen in ihren Werken zurückkommen. In diese intensiven und sehr detaillierten Beschreibungen integriert Kurd Laßwitz immer wieder verschiedene Erfindungen wie die Gehirnorgel, während das Geruchsklavier mit dem frühen Tod seiner besten Interpretin - am Ende der ersten Geschichte - gänzlich an Bedeutung verloren hat. Andere Ideen werden wieder zurückgebaut. Die Gemeinschaftsküche - da die Kosten für das Zubereiten von Lebensmitteln für die Allgemeinheit zu hoch geworden sind - wird wieder zurückgebaut und die Menschen können wieder alleine in ihren Häusern dinieren. Der Meeresboden ist das letzte Refugium, in welchem der Mensch noch frei forschen kann. Kinder lernen schon das Fliegen in den Luftdroschken und die Freizeitgestaltung steht im Gegensatz zur insbesondere körperlich verpönten Arbeit im Vordergrund. Alleine Roboter oder mechanische Helfer finden sich in Laßwitz Visionen nicht. Er geht nicht weiter auf die alltägliche Arbeit ein. Nur die Barbaren, deren mörderische Kriegszüge die Zivilisation bedrohen, schmieden ihre mörderischen Waffen noch selbst. In einer Anspielung auf die Gedankenkontrolle, welche George Orwell später in “1984” zu einem nihilistischen Höhepunkt treiben wird, diskutiert Laßwitz dank seiner Charaktere die Spezialisierung des Individuums mit allen Vor- und Nachteilen aus. Bislang hat er verzichtet, seiner Zukunftswelt auch die entsprechenden Berufe zu schenken. Nur die Künstler bzw. Forscher werden unmittelbar an ihren Arbeitsplätzen beschrieben. Das für eine derartig hoch stehende Zivilisation Spezialisten notwendig sind, stellt der Autor noch impliziert, aber hintergründig in Abrede. Unabhängig davon bilden viele der Ideen die Grundlagen, auf denen Fritz Lang und Thea von Harbou ihr Metropolis bauen werden. Als Autor hat sich Kurd Laßwitz in diesen sieben Jahren zwischen den Geschichten ebenso weiter entwickelt wie als Mensch. Auch wenn seine eher eindimensional charakterisierten Protagonisten im Handlungsverlauf untergehen, nutzt der Autor sie als Platzhalter für eine Reihe von philosophischen Exkursionen, deren Gehalt auch heute noch interessant ist. Die Welt, welche er für seine Leser schafft, ist nicht nur dreidimensional, sie wird plastisch und überzeugend gezeichnet. Auch wenn sich Kurd Laßwitz teilweise ein wenig zu sehr in seinen ausschweifenden, aber heute noch lesenswerten Erläuterungen verliert, ist es der Ideenreichtum, welcher den Leser förmlich erschlägt. Dabei bemüht sich der Autor, die Balance zwischen Erzählung und Erklärung zu halten. Über weite Strecken - bei beiden Texten mehr gegen Ende des Handlungsbogens - funktioniert dieses Vorgehen sehr gut. Es sind aber die “Erfindungen” - deutlich Bahnbrechender und intelligenter als in fast allen Jules Verne Romanen zusammen -, welche heute noch die Faszination dieser beiden kurzen Texte ausmacht.
Zusammengenommen sind “Bis zum Nullpunkt des Seins” und “Gegen das Weltgesetz” wirklich Bilder der Zukunft. Der Leser hat das Gefühl, einem nostalgisch verklärten Film aus ferner Zukunft zuzusehen, dessen Handlung ganz bewusst auf das Niveau des jeweiligen Publikums reduziert worden ist, der aber in eloquenten Bildern schwelgt und dem Zuschauer ein Feuerwerk von Ideen um die Ohren schlägt, die in einem umfangreichen Roman deutlich besser zur Geltung gekommen wären. Um auf das Vorwort von Kurd Laßwitz und seine Prämissen für Science Fiction zurückzukommen. Er hält sich in seinem gedanklichen Feuerwerk selten wirklich daran. Er beginnt mit einem naturwissenschaftlich philosophischen Exkurs und lässt sich im Verlaufe seiner Geschichten von seinen vielen Ideen mitreißen, die eher bizarr als wirklich wissenschaftlich deduziert sind. Die greifbare Technik hat Kurd Laßwitz stellenweise sehr akkurat vorhergesagt und dabei Autoren wie Carl Grunert sicherlich beeinflusst. Auch die intellektuelle Entwicklung der Menschheit mit Hochphasen und dem notwendigen Rückfall auf ein Niveau knapp oberhalb der Barbarei ist nachvollziehbar und hat sich in der Menschheitsgeschichte seit 1877 mehrmals als wahr erwiesen. H.G. Wells folgt dieser Zeitachse in seinen keine fünfzehn Jahre später veröffentlichten dunklen Visionen, wobei Kurd Laßwitz im Herzen seinen Zukunftsmenschen gegenüber optimistischer ist. Einsame Höhepunkte sind die satirischen Seitenhiebe auf die Bildungspolitik des 19. Jahrhunderts, welche Laßwitz mit sehr viel bissigem Humor in seine Geschichten integriert hat. Aber auch in dessen Zukunft ist der Mensch das schwächste Glied. Egal wie weit sich die Menschheit technisch entwickelt. Für den Lehrer Laßwitz spielen aber die Naturwissenschaften eine ebenso wichtige Rolle wie die Philosophie. Es ist interessant, das er die meisten seiner Figuren zumindest vordergründig auf ihre Fähigkeiten zu reduzieren sucht, auch wenn der Autor diese Entwicklung nicht zum Exzess treibt.
Beide Geschichten sind nicht nur als Beweis für das kraftvolle, experimentierfreudige Frühwerk Kurd Laßwitzs absolut empfehlenswert. Die Neuveröffentlichung im Rahmen der insgesamt grundlegenden Kollektion Laßwitz öffnet die Türen für eine Neubewertung dessen Werkes im Rahmen der Science Fiction des 19. Jahrhunderts. Wie bei allen Bänden dieser Edition hat Herausgeber Dieter von Reeken mit seinem informativem einleitendem Vorwort, der sehr guten Wiedergabe der allerdings einfallslosen Originaltitelbilder bzw. der ersten Textseite als Herausgeber wieder ganze Arbeit geleistet.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info