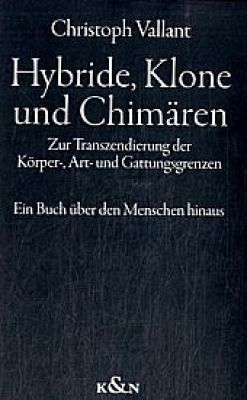|
|
Startseite > Rezensionen > Dr. Franz Rottensteiner > Sekundärliteratur > Hybride, Klone und Chimären. Zur Transzendierung der Körper-, Art- und Gattungsgrenzen |
Hybride, Klone und Chimären. Zur Transzendierung der Körper-, Art- und Gattungsgrenzen
| HYBRIDE, KLONE UND CHIMÄREN. ZUR TRANSZENDIERUNG DER KÖRPER-, ART- UND GATTUNGSGRENZEN
Buch / Sekundärliteratur Christoph Vallant |
Die technische Veränderung des Menschen schreitet voran: Gentechnik, Transplantationsmedizin, plastische Chirurgie und implantierte digitale Prothestik (wie ein mechanisches Herz) werfen Fragen nach dem ontologischen Status des Menschen und seinen Körper-, Art- und Gattungsgrenzen auf.
Der Autor zeichnet die Entwicklung der Antizipation des künstlichen Menschen, eines selbstgeschaffenen Ebenbildes und künstlichen Doppelgängers des Menschen, in Mythos, Poesie und Kunstgeschichte seit der Antike nach. Der Autor zählt vier Möglichkeiten auf, was am künstlichen Menschen alles künstlich sein kann: Hybride (ein menschlicher Körper, der zum Überleben prothetische Artefakte benötigt), Klone (optisch dem „klassischen“ Menschen gleich, aber die genetische Kopie eines anderen Menschen), Chimären (ein humanoides Wesen, in dessen Keime neue, artfremde oder künstliche Gene/Chromosomen eingeführt wurden), Cyborgs (auf ganzem Wesen künstlich hergestelltes Wesen – gewöhnlich versteht man unter einem Cyborg eine Verbindung von Mensch-Maschine, was der Autor als Hybrid bezeichnet); und schließlich Biomaschinen, künstlich hergestelltes organisches Leben.
Bereits Homer erzählt vom Schmiedegott Hephaistos, welche den Kretern einen künstlichen eisernen Wächter Talos schuf und sich selbst von goldenen Jungfrauen bedienen ließ. Einen anderer Weg wird in der Pygmalion-Sage beschritten, der Bildhauer belebte mit Hilfe der Göttin Aphrodite eine Elfenbeinstatue. Ganz ohne göttliche Hilfe soll aber Daidalos Androiden hergestellt haben. Im Mittelalter gab es die Vorstellung magisch oder alchemistisch belebter Androiden; Thomas von Aquin soll einen sprechenden künstlichen Kopf des Albertus Magnus zerstört haben. Weit verbreitet ist die jüdische Legende vom Golem, dem aus Lehm erschaffenen Kunstmenschen. In der Renaissance ging die Entwicklung vom magisch belebten Wesen hin zu mechanischen Konstruktionen. Spielwerke und selbstbewegende Automaten dienen nicht nur der Belustigung, sondern auch zum Selbstverständnis des eigenen Wesens. Im 18. Jahrhundert gab es eine Flut von Geschichten über künstliches Lebens, darunter von Jean Paul, Achim von Armin, E.A.T. Hoffmann und 1817 Mary Shelleys Frankenstein.
Die geistesgeschichtliche Entwicklung folgt dabei folgenden Stufen: der Interpretation des Kosmos als Maschine; die Auffassung des Menschen als Maschine; durch die Renaissanceanatomie und die rationalistische Philosophie wurde das mechanistische Menschenbild entwickelt, was zur Entstehung der cartesianischen Anthropotechnik und der ontologischen Realisation dieser Anthropotechnik am und im Menschen führte.
In der Bibel wird der Mensch als Ebenbild Gottes gesehen, und die Aufforderung Befehl, „Machet euch die Erde untertan“ zum Auslöser menschlichen Schöpfertums. Der Mensch imitiert Gott und wird zum zweiten Schöpfer, zum Herren über die antagonistisch gesetzte Natur, was eine zunehmende Säkularisierung erfährt, die Gott keinen Raum mehr lässt. Der Mensch erfuhr eine Reihe von Kränkungen – die kopernikanische, die die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums rückte, die durch die Sektion herbeigeführte anatomische Kränkung, die den Menschen als Tier unter Tieren zeigte, und schließlich die mit Julien Offray de La Me trie verbundene, die den Menschen zur Maschine erklärte und damit auch zum Objekt von Veränderungen, Um- und Neukonstrutionen machte.
Der Autor zitiert beifällig Konrad Paul Liessmann, der Anthropotechnik folgendermaßen definiert:
Anthropotechnik, so ließe sich sagen, ist die Transformation von Natur in Kultur, angewendet auf den Menschen selbst. Technik ist hier allerdings eher im antiken Sinn zu verstehen, als ein methodisches Verfahren, als eine Kunstfertigkeit zur Erreichung bestimmter Zwecke. Sie hat zur Voraussetzung, dass es keine wie immer geartete Natur des Menschen gibt, die sich selbst genügt oder als Maßstab dienen könnte. Für den Menschen war seine eigene Natur nur das Ausgangsmaterial, das es erst zu gestalten galt. Der Naturmensch war schon immer eine Fiktion. (S. 67)
Von den modernen Autoren beruft sich Vallant vor allem auf Gotthard Günthers Das Bewusstsein der Maschinen (2002) und Jeremy Rifkins Das biotechnische Zeitalter. Die Geschäfte mit der Gentechnik (2000), und er zitiert beifällig Sophokles: „Vielgestaltig ist das Ungeheure, doch nichts ist ungeheurer als der Mensch.“
Die cartesianische Anthropotechnik wird abgelöst von einer Anthropotechnik, die er intra-entelechisch nennt und die von folgenden Charakteristika gekennzeichnet ist: 1) der aus der Kybernetik stammenden Analogie zwischen organischem Leben und transklassischen Maschinen hinsichtlich ihres modus operandi; 2) die Vorstellung, dass der Kanon der verwirklichten Lebensformen nur ein Teil der unendlichen Potentials von virtuellen Formen ist; 3) die Vorstellung organischen Lebens aus der Perspektive der kombinierbaren genetischen Buchstaben unterhalb jeder ausgebildeten Art und Form; 4) der freie Transfer von genetischem Material jenseits von klassischen Art- und Gattungsgrenzen; und 5) die Abkehr von der kontra-naturalen herrischen Technik zu einer die Natur imitierenden Form der Technik, einer imitatio naturae, die zwar Parameter des Werdens justiert dann aber der Natur bei der Entfaltung nur noch zusieht.
Vor allem der letzte Punkt wird jenen nicht einleuchten, die in der Gentechnik und all den anderen neuen Techniken eine Vergewaltigung der Natur sehen und nicht die Anwendung natürlicher Prinzipien.
Aus diesem Buch wird jedenfalls klar, wie unendlich formbar der Mensch ist und wie sehr die Definition von Anfang und Ende menschlichen Lebens und was der Mensch ist, überdacht werden muss angesichts der gewaltigen Möglichkeiten zur Veränderung von Genen und ganzen lebenden Organismen, welche schon die Gegenwart und erst recht die Zukunft bereithält. Der Autor liefert einen interessanten Überblick über die historische Entwicklung und die dadurch aufgeworfenen ontologischen Probleme.
Der Rezensent
Dr. Franz RottensteinerTotal: 59 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
Franz Rottensteiner
wurde am 18.01.1942 in Waidmannsfeld/Niederösterreich geboren.
Studium der Publizistik, Anglistik und Geschichte an der Universität Wien,
1968 Dr. phil.
Rund 15 Jahre Bibliothekar an einem Forschungsinstitut, daneben Tätigkeit für verschiedene Verlage, unter ander...
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info