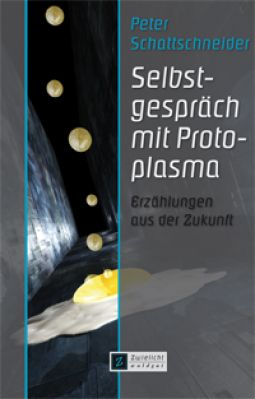|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science Fiction > Selbstgespräch mit Protoplasma |
Selbstgespräch mit Protoplasma
| SELBSTGESPRÄCH MIT PROTOPLASMA
Peter Schattschneider Zwielicht: Band 5 |
Mit “Selbstgespräch mit Protoplasma” legt der Waldgut Verlag in seiner Edition Zwielicht einen Band mit Erzählungen aus der Zukunft des österreichischen Autoren und Wissenschaftlers Peter Schattschneider vor. In den achtziger Jahren hat Schattschneider in der von Franz Rottensteiner - de Autoren des ausführlichen Nachworts - betreuten Suhrkamp Reihe den Episodenroman “Singularitäten” bzw. die Geschichtensammlung “Zeitstopp” veröffentlicht. Er 1950 in Wien geborene Schattschneider unterrichtet am Institut für Festkörperphysik und befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Elektronen und Materie. In den letzten Jahren - dieser Begriff ist relativ, da keine der Geschichten aus diesem Jahrtausend stammt - hat Schattschneider seine Texte in erster Linie im Computermagazin “C´t” veröffentlicht. Franz Rottensteiner stellt in seinem Nachwort die Besonderheit der Science Fiction Kurzgeschichte für das Genre heraus und charakterisiert die inzwischen noch trostloser gewordene Veröffentlichungssituation. Er geht aber mit keinem Wort auf das - nicht unbedingt negativ gesprochen - Alter der Kurzgeschichten ein. Es wäre schön, wenn Peter Schattschneider auf insgesamt drei Nachdrucke aus seinen antiquarisch noch erhältlichen Suhrkampbühern verzichtet und zumindest ein oder zwei neue Texte beigefügt hätte. In seinen manchmal ein wenig zu positiven Analysen versucht Rottensteiner die Intention Schattschneiders herauszuarbeiten. Viel wichtiger ist dagegen, dass er den wissenschaftlich nur durchschnittlich bis gar nicht ausgebildeten Lesern einige wichtige Hinweise gibt. Alleine die letzte mathematisch experimentelle Kurzgeschichte “Tinkerbell” verfügt über ein Glossar an Fachbegriffen. Obwohl Franz Rottensteiner bei einigen Texten auf den Pointen eingeht, empfiehlt es sich, mit dem Nachwort zu beginnen und sich so ein Bild über den Schriftsteller und vor allem auch Wissenschaftler Peter Schattschneider zu machen.
In den hier zusammengefassten Geschichten spielt Peter Schattschneider auf einem intellektuellen Niveau nicht nur mit den Grundideen des Genres und betrachtet sie dank seiner solide gezeichneten Charaktere mit einem gewissen Sense of Wonder, sondern er setzt sich verstärkt mit den Unzulänglichkeiten der menschlichen Gesellschaft in einer technologisch forteilenden Welt auseinander. In “Pflegeleicht” - 1991 wie drei Jahre später die ebenfalls in der Sammlung vertretene Geschichte “Brief aus dem Jenseits” mit dem Kurd Laßwitz Preis ausgezeichnet - spielt Schattschneider die Idee eines Kindes aus der Fabrik durch. Natürlich haben die Designer die Makel im menschlichen Reifeprozess eliminiert und das Wachstum perfektioniert. Aber auch hier lassen sich kleine Pannen nicht ausschließen, für die es notfalls immer noch die Juristen gibt. Eng am Rand zur Farce nutzt Schattschneider die leeren Floskeln der Werbebranche und zeigt die naive Abhängigkeit des Konsumenten von Gebrauchsanleitungen ohne eigenen Willen. “Zwiedenker” dagegen spielt in einer emotionslos gewordenen, anscheinend von Maschinen geplanten Gesellschaft mit einer Verbindung zu “unserer” natürlich chaotischen Gegenwart. Dabei entpuppt sich die schon 1984 veröffentlichte Geschichte als eine Mischung aus Fassbinders “Welt am Draht” und intellektueller Vorgänger zu Virtual Reality Filmen wie “Matrix”. Allerdings fehlt der Geschichte die persönliche Ebene. Dem Leser gelingt es zu wenig, einen Bezug zu den eher eindimensional gezeichneten Charakteren zu finden. Dadurch verliert die Beziehungsgeschichte ein wenig an Effektivität. Noch einen Schritt weiter geht der Autor in “das reduzierte Ich” - dem Episodenroman “Singularitäten” um schwarze Löcher entnommen - in dem er einen brillanten Schüler mit einer Erfolg versprechenden modernen Schule konfrontiert. Je tiefer der Leser in diese Geschichte eindringt, um so unwirklicher wird die Realität. Die Idee, sehr gute Schüler mit neuen Herausforderungen zu konfrontieren und sie dadurch zu leiten oder zu manipulieren, ist sehr gut umgesetzt. Am Ende schwenkt Schattschneider allerdings in Philip K. Dicks Themenwelten ab, ohne den Reiz der Story zu negieren.
In “Superzyte” und “Schnippchen” extrapoliert Schattschneider die Idee Mensch- Maschine weiter. Während in der Zeitreiseglosse mit einem allerdings enttäuschenden und eher wie ein Kapitulation vor der eigenen Schöpfung wirkenden Ende versucht ein Hacker einen Computer zu manipulieren und eine Art Möbiuszeitschleife zu entwickeln. Dagegen ist “Superzyte” eine Satire auf den immer mechanischer werdenden Literaturbetrieb, in dem inzwischen Computer in den Genres Krimis, Liebesgeschichten und natürlich Science Fiction die Arbeit übernommen haben. Als ein Programmierer dem ihm anvertrauten Schreibcomputer etwas mehr Grammatik beibringen möchte, löst er eine Kettenreaktion aus, die zum Erwachen eines Intellektes führt. Während das Ende vorhersehbar ist, überzeugt die fiktive Science Fiction Geschichte in der Mitte des Buches. Sie symbolisiert das Erwachen des Intellekts. Anfänglich absichtlich sperrig geschrieben ist die Botschaft klar herausgearbeitet. Beide Texte stammen noch aus den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts und unterstreichen, wie weit Schattschneider auf spielerisch intellektuellem Niveau seinen insbesondere deutschen Mit Science Fiction Autoren voraus gewesen schade. Schade ist nur, dass zum Beispiel “Superzyte” wie “das wirtschaftlichste aller Systeme” Schattschneiders Sammlung “Zeitstopp”, “Das reduzierte Ich” dem Episodenroman “Singularitäten” entnommen worden ist. Diese Überschneidungen hätten vermieden werden sollen. In eine ähnliche Richtung wie “Schnippchen” schilt schließlich “Tinkerbell”, ein mathematisches Experiment. Ein Student findet die Aufzeichnungen eines inzwischen verschwundenen Professors. Sie sind verschlüsselt. Durch einen Zufall findet der Student die Lösung in der Quadratur des Kreises und wird von den Aufzeichnungen fasziniert wie auch schockiert. Am Ende zeichnet sich auf einer deutlich intellektuelleren und deswegen auch schwerer zugänglichen Ebene eine ähnliche Problematik ab wie in “Schnippchen”. Wer sich nicht die Zeit nehmen will, Pointen der Geschichten selbst zu entschlüsseln, wird ein wenig enttäuscht auf das Ende reagieren. Als Text selbst ist “Tinkerbell” stellenweise ein wenig zu sperrig geschrieben und nicht alles ist wirklich auf den ersten Blick nachvollziehbar. Hier hat das theoretisch- mathematische Problem den Plot getrieben, die eigentliche Handlung tritt deswegen ein wenig zu sehr in den Hintergrund und lässt die Geschichte distanziert und extrem konstruiert erscheinen, während “Schnippchen” ein ähnliches Problem aus einer verspielten, experimentelleren Ebene betrachtet. Nicht zuletzt aufgrund des indirekten Humors ist “Schnippchen” die lesenswertere der beiden Geschichten.
Die Titelgeschichte “Selbstgespräch mit Protoplasma” gehört zu den Höhepunkten der Sammlung. Schattschneider spielt mit dem Text gewordenen Klischee der First Contact Geschichte. Die Menschen nehmen Kontakt mit den Emulianern auf, einer Amöbenlebensform. Danach entwickelt sich eine insbesondere von pointierten Dialogen getriebene Farce, bei welcher der Autor insbesondere mit den Definition von Intelligenz und Menschlichkeit spielt. Es ist nur folgerichtig, dass Schattschneider auch den Mensch- Maschine Komplex in ähnlicher Absicht untersucht. “Emulitis” zeigt drastisch die Folgen eines zu exzessiven “Konsums” der neuen Medien auf und impliziert, das Mensch und Maschine mehr und mehr untrennbar verbunden sind. Das offene, dunkel humorvolle Ende lässt sich den Leser über diese ungewöhnliche Synthese nachdenken und wirkt im Vergleich zu den teilweise etwas zu konstruierten Enden anderer Storys dieser Sammlung effektiver.
Ein weiteres Thema, das sich wie ein roter Faden durch Schattschneiders Arbeiten zieht, ist das satirische Spiel mit der Gegenwart, das er mittels technischer Exzesse ins Groteske übersteigert. In der ebenfalls mit dem Kurd Laßwitz Preis ausgezeichneten Geschichte „Ein Brief aus dem Jenseits“ konfrontiert er seine in einem technischen Nirvana lebenden Figuren mit der Realität der technologiefeindlichen Außenseitergeneration und zeigt überspitzt auf, was mit Menschen passiert, die durch das natürlich angeblich narrensichere computergesteuerte Netz fallen. „Hausmacht“ dagegen ist eine klassische Rosenkrieggeschichte in näherer Zukunft spielend. Leider konzentriert sich Schattschneider in der zweiten Story zu wenig auf die Pointe, die übertrieben eingeläutet und wenig überraschend präsentiert wird. Dagegen überzeugt „Ein Brief aus dem Jenseits“ vom an Daniel Keyes „Charlie“ erinnernden Auftakt über den grell satirisch und provozierend ausgestalteten Mittelteil bis zu seinem konsequenten Ende. Einzelne Schachzüge wirken aus der Distanz von mehr als zwanzig Jahren vorhersehbar und zu wenig überraschend, aber zusammengefasst ist die Warnung vor einer Kapitulation vor der modernen Zeit, vor der allwissenden und dem Menschen alles abnehmenden Technik zeitlos und wird konsequent zynisch, aber nicht nihilistisch präsentiert.
Schattschneider ist aber auch ein typischer Pointenschreiber. In „Diamantendeal“ - mit einem Zitat aus „Per Anhalter durch die Galaxis“ als Einführung - basiert die Auflösung des Plots auf der Unwissenheit physikalischer Phänomene auf einem fremden Planeten. Humorvoll kurzweilig geschrieben, aber auch im Vergleich zu vielen anderen Texten der Sammlung ein wenig zu einfach konzipiert. Dagegen ist „GIPS unlimited“ deutlich vielschichtiger angelegt, reduziert aber schließlich auf Auflösung des Dilemmas auf eine vorhersehbare Variante. Ein Techniker konfrontiert einen Computer mit einem Problem und will ihn in eine unlösbare Aufgabe zwingen. Um sich aus dieser Notsituation zu befreien, wählt der Computer einen unorthodoxen Weg, der aber nur aufgrund der Naivität des Programmiers funktionieren kann.
„Das wirtschaftlichste aller Systeme“ - der Titel ist zynisch - ist eine der frühesten Arbeiten Schattschneiders dieser Sammlung. Die Geschichte stammt aus dem Jahre 1982. Die Extrapolation der Globalisierung und vor allem Computerisierung ist kompakt und richtig vorhergesagt. Am Beispiel eines Akademikers, der während der Unizeit seine Freundin aus den Augen verliert und später sich als einfacher Handwerker verdingen muss, legt Schattschneider die Schwächen der modernen Industriegesellschaft und den stetig wachsenden Leistungsdruck bloß. Alternativen bietet der Autor aber weder in dieser noch in anderen Texten an. Zwar schreibt Franz Rottensteiner, dass Schattschneider mit seinen offenen Fragen den Leser zum Nachdenken anregen möchte, aber ein wenig Problemlösung würde mancher Geschichte dieser Sammlung auch gut tun. Unabhängig von der Tatsache entpuppt sich das wirtschaftlichste aller Systeme als eine Art Frankensteinlösung. Dabei legt Schattschneider mehr Wert auf die schockierende Lösung als eine wirklich überzeugende wissenschaftliche Grundlage. Im Vergleich zu den späteren Arbeiten stilistisch noch etwas einfacher, belehrender gehalten ist die Story ein guter Beweis für die qualitative, aber nicht unbedingt inhaltliche Weiterentwicklung, welche Peter Schattschneider durchlaufen hat.
„Selbstgespräch mit Protoplasma“ ist eine empfehlenswerte Sammlung von reinen Science Fiction Geschichten. Alleine die Tatsache, dass im Waldgut Verlag überhaupt ein sehr positiv gesprochen derartiger Anachronismus veröffentlicht worden ist, muss herausgestellt werden. Die verstreuten Texte des augrund seiner beruflichen Einspannung eher selten publizierenden Schattschneiders bilden eine gelungene Ergänzung zu den ersten Veröffentlichungen im Suhrkamp Verlag. Mit einer präzisen wissenschaftlichen Grundlage seziert Schattschneider sehr pointiert und scharfsinnig die möglichen gesellschaftlichen Exzesse und zeigt, wie „krank“ das Verhältnis Mensch- Maschine, aber auch Realität gegenüber künstlicher Irrealität geworden ist. Dabei lässt sich zwischen den Zeilen die aus Schattschneiders Sicht sich negativ entwickelnde Gegenwart gut erkennen. Als Wissenschaftler ist er dem technologischen Fortschritt nicht unbedingt negativ gegenüber eingestellt, warnt aber vor der geistigen Kapitulation des Menschen vor der künstlichen Intelligenz. Insbesondere die Virtual Reality Texte stellen einen interessanten, wie intellektuellen, aber nicht nur theoretischen Gegenpol zu den „Matrix“ Exzessen dar. Bedenkt der Leser auch noch, das keine der Geschichten jünger als zehn Jahre ist, wird die Tatsache unterstrichen, wie frühzeitig sich Schattschneider als Intellektueller auf einer gehobenen Ebene mit den Spätfolgen des inzwischen auch wieder in Vergessenheit geratenen Cyberpunk auseinandergesetzt hat. Nur ein oder zwei neue Texte exklusiv für diese Sammlung geschrieben hätten die empfehlenswerte wie lesenswerte Anthologie positiv abgerundet.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info